Sie befinden sich hier auf der Seite, die einen kleinen Eindruck zu den
Auswirkungen von Niedrigwassersituationen, insbesondere in der Lausitz
Ich wünsche allen Interessierten viel Spaß beim Lesen dieser Seiten
AKTUELLES
Wasser reicht noch in Berlin
Bilanz Trotz Trockenheit gilt die Versorgung als gesichert. Einschränkung im Verbrauch soll es nicht geben.
Berlin. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Monate wirkt sich auf den Grundwasserspiegel in Berlin aus – die Wasserversorgung ist aber nicht gefährdet.
Infolge von mehr Regenfällen im Jahr 2023 hatte sich der Grundwasserpegel im
vergangenen Jahr etwas erholt, seit Februar dieses Jahres geht er aber wieder zurück, teilten die Berliner Wasserbetriebe mit.
Die
Lage für die Wasserversorgung sei aber nicht kritisch.
….Einschränkungen wie etwa ein Rasensprenger-Verbot seien daher nicht notwendig…
...Die
Wasserbetriebe versuchen, mit Aufklärungskampagnen zu mehr Bewusstsein beim
Wasserverbrauch anzuregen….
…Die Berliner Wasserbetriebe verkauften im Jahr 2024 mehr als 214 Millionen Kubikmeter Trinkwasser,
das waren rund drei Millionen Kubikmeter mehr als im Jahr zuvor.
Die
Abwassermenge in den Klärwerken blieb mit knapp 265 Millionen Kubikmetern
weitgehend gleich….
Investitionen auf
Rekordniveau
…Erstmals investierte das Unternehmen mehr als eine halbe Milliarde Euro in die eigene Infrastruktur – ein Rekordwert.
Ein Großteil davon ging in den Ausbau der Klär- und Abwasserpumpwerke, vor allem ins Klärwerk Waßmannsdorf.
Fast ebenso viel Geld investierten die Wasserbetriebe ins Kanal- und
Rohrnetz…
….Der Umsatz stieg um 28 Millionen auf rund 1,3 Milliarden Euro.
Unterm Strich machte das landeseigene Unternehmen einen Gewinn von 166 Millionen Euro, rund 55 Millionen weniger als im Jahr davor.
Das
sei vor allem auf höhere Material- und Personalkosten zurückzuführen, sagte
Vorstandschef Frank Bruckmann….
dpa
Quelle: zitiert aus dpa, 21.06.2025
Kreise verbieten Wasserentnahme
dpa
Quelle: zitiert dpa, 20.06.2025
Spree und Schwarze Elster in Not
...Die Spree und die Schwarze Elster führen in der Lausitz jetzt so wenig
Wasser, dass die Speicherseen schon angezapft werden müssen....
...Das Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg hat deshalb angewiesen, dass
die Talsperre Spremberg schon jetzt Wasser für die Spree abgeben muss....
Anm.:
Das ist eigentlich neben dem Hochwasserschutz eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Talsperre zu leisten hat.
Der damit verbunden Erholungseffekt ist dabei ein angenehmes Nebenprodukt.

Niederschläge fehlen in Brandenburg seit Monaten. Die Talsperre Spremberg muss deshalb massiv Wasser für die Spree abgeben . Foto: Michael Helbig
...Der Wasserfluss der Schwarzen Elster wird kontinuierlich aus dem
Speicherbecken Niemtsch (Senftenberger See) gestützt....
...An der Spree in Cottbus sind seit Januar lediglich 127 Millimeter
Niederschlag gemessen worden....
...Das ist aktuell noch weniger Regen als in den extremen Trockenjahren von
2018 bis 2020 und 2022....
...Die anhaltende Trockenheit wirkt sich auf das Wassermanagement in der
Fläche aus: Die Gewässerunterhaltungsverbände sind angewiesen worden, den
Abfluss von Spreewasser in Nebengewässer und Grabensysteme wie den
Hammergraben und den Priorgraben wie auch die Pretschener Spree zu
reduzieren....
...Der Grund: Seit Juni wird der Mindestabfluss von 4,5 Kubikmetern Wasser
pro Sekunde am Unterpegel Leibsch (Königs Wusterhausen), am Ausgang des
Spreewaldes, bereits dauerhaft unterschritten....
...Wenn die Spree aus der Lausitz nicht genug Wasser bringt, drohen
unmittelbar Engpässe bei der Versorgung von Berlin mit Trinkwasser....
...Derzeit werden am Pegel Leibsch nur noch etwa 3,5 Kubikmeter Wasser pro
Sekunde erreicht....
...Die Talsperre Spremberg muss deshalb stufenweise Wasser abgeben, um das
mittlere Spreegebiet in Bewegung zu halten....
...Zwischen 8,6 und aktuell 9,8 Kubikmeter pro Sekunde werden nun
abgelassen, damit genug Wasser in Leibsch ankommt....
...Im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster ist das Trinkwasser zwar
gesichert....
...Aber in der Schwarzen Elster selbst ist der Abfluss wegen der viel zu
geringen Niederschläge stark zurückgegangen....
...Am Verteilerwehr Kleinkoschen bei Senftenberg werden nur noch 186 Liter
pro Sekunde gemessen....
...Deshalb muss der Senftenberger See, das Speicherbecken Niemtsch, schon
Wasser abgeben....
...Am Messpegel Biehlen liegt der Abfluss aktuell bei 0,625 Kubikmetern pro
Sekunde....
...Das entspricht den Brandenburger Wasser-Experten zufolge etwa der Hälfte
des mittleren Abflusses für den Monat Juni....
...Der Wasserstand im Senftenberger See ist wegen der Abgabe in die Schwarze
Elster bereits gesunken: auf 98,85 Meter NHN (Normalhöhennull)....
...Aktuell wird die Schwarze Elster zusätzlich zum Wasser aus dem
Senftenberger See noch mit Wasser aus der Grubenwasserreinigungsanlage
Rainitza der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
aufgehöht, um den Fluss solide am Laufen zu halten.... Kathleen Weser
Quelle: zitiert aus lr-epaper, 19.06.2025
Angezapft wird vor allem Grundwasser
Potsdam. In Brandenburg ist der Trinkwasserverbrauch innerhalb von zwölf Jahren stark angestiegen, in Berlin dagegen leicht.
Das
geht aus Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.
Die
öffentlichen Wasserversorger gaben 2022 demnach insgesamt
153
Millionen Kubikmeter (m³) Trinkwasser in Berlin und
107,8
Millionen m³ in Brandenburg an Haushalte und Kleingewerbe ab.
Der
Trinkwasserverbrauch pro Kopf lag dabei in Brandenburg bei 117,6 Litern pro
Tag gegenüber 104,7 Litern im Jahr 2010.
In
Berlin stieg er leicht auf 114,4 Liter pro Tag gegenüber 112,9 Litern 2010.
In Brandenburg wurde Trinkwasser 2022 zu 96,4 Prozent aus Grundwasser und zu 3,6 Prozent aus Uferfiltrat gewonnen.
Ganz
anders das Verhältnis in Berlin mit 44,4 Prozent Grundwasser und 55,6
Prozent Uferfiltrat.
Die gesamte Wassergewinnung (öffentlich und nicht-öffentlich) lag 2022 in beiden Ländern bei fast 987 Millionen Kubikmetern.
Den
größten Anteil hatte dabei das Produzierende Gewerbe, gefolgt von der
Energiewirtschaft, die Wasser hauptsächlich zur Kühlung nutzt. In der
Landwirtschaft wurde vor allem Grundwasser für die Flächenbewässerung
genutzt. red
Quelle: zitiert aus lr epaper, 25.03.2025
Anm. zum nachfolgenden Artikel:
Derartige Untersuchungen zur Grundwasseranreicherung wurden schon in den 1970-er Jahren
im Rahmen einer Studie „Sicherung der
Trinkwasserversorgung der „Hauptstadt der DDR“ Berlin von der
damaligen Wasserwirtschaftdirektion (WWD)Spree-Oder –Neiße durchgeführt.
Um mögliche Grundwasserinfiltrationen zu
untersuchen, wurde im Raum Hohenbinde (Untere Spree) ein Versuchsgebiet
betrieben.
Im gleichen Zeitraum liefen Untersuchungen zur
Ermittlung von Staulamellen für Seen im unteren Spreegebiet für eine
mögliche wasserwirtschaftliche Bewirtschaftung, u.a. am Schwielochsee bei
Beeskow.
Leider geraten derartige Untersuchungen (wenn denn diese Studie und die Untersuchungsergebnisse überhaupt noch auffindbar sind) schnell in Vergessenheit.
Besonders, wenn sich der „Wasserhaushalt“ nach
niederschlagsreichen Perioden wieder „erholt“.
Brandenburg soll Wasser für Dürrezeiten speichern
Forschung Die Spree versorgt die Mark und die deutsche Hauptstadt – damit könnte Ende der 2030er-Jahre Schluss sein.
Wissenschaftler setzen Hoffnung auf eine neue
Technologie.
Die Spree, als wichtigster Fluss zwischen der Lausitz und Berlin, ist mit rund 400 Kilometern Länge eher klein. …
Experten haben nun offenbart – damit könnte Ende der 2030er-Jahre Schluss sein.
In heißen Sommermonaten kommt womöglich kein Tropfen
Wasser mehr in Berlin an. Eine neue Technologie lässt hoffen….
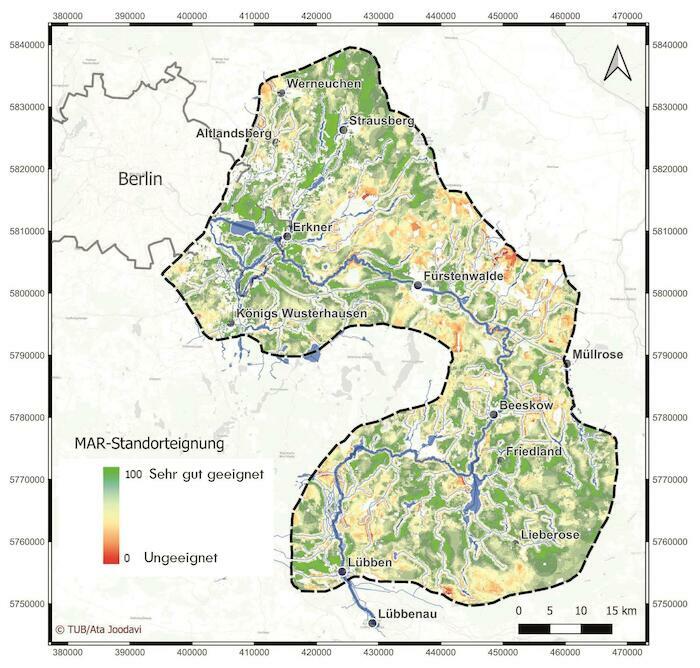
Die Grafik zeigt, wo sich geeignete Standorte für die künstliche Grundwasseranreicherung befinden (hellgrün).
Die
Forschungsergebnisse der TU Berlin beziehen sich auf das untersuchte Gebiet
der Unteren Spree
Industrie und Landwirtschaft könnten das künstlich gespeicherte Wasser
nutzen.
...Trockenheit auf der einen Seite, ein steigendes Risiko von Starkregen- und Hochwasserereignissen auf der anderen. ….
...Dieser Frage geht Prof. Dr. Irina Engelhardt, Professorin im Fachgebiet Hydrogeologie an der Technischen Universität Berlin, nach
als Teil des Forschungsprojektes „SpreeWasser: N“.
Ihr Vorhaben
untersucht die Machbarkeit von Infiltrationsbrunnen, die überschüssiges
Wasser in einen Grundwasserkörper einleiten und dort speichern können….
…Rohre zu einem Brunnen leiten. Über den sogenannten
Infiltrationsbrunnen wird es dann dem Grundwasserleiter zugeführt und dort
gespeichert. …
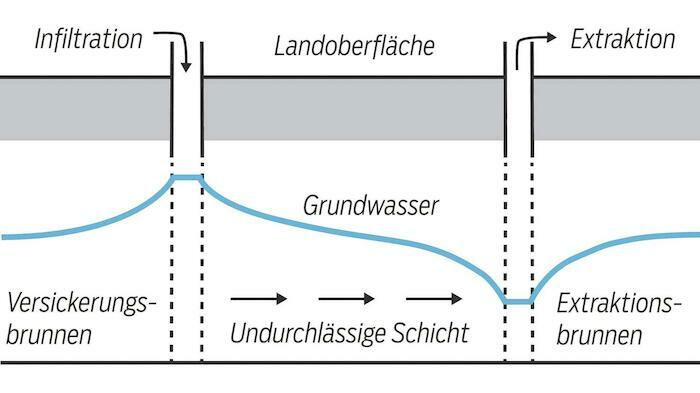
Die Abbildung zeigt das Prinzip der Grundwasserinfiltation: Überschüssiges Wasser wird über Rohre zum Brunnen geleitet.
Entweder passiert das im Herbst/Winter („Wasserüberschuss“),
so dass es im Sommer („Wassermangel“) entnommen werden kann oder es verbleibt im Grundwasserkörper zwei bis drei Jahre,
wobei die Wasserqualität dabei
prifitiert.
Foto: Sebastian Lehmann, Quelle: INOWAS
…Geeignete Senken oder Seen können zum Zwischenspeichern genutzt werden.
Irina Engelhardt hat hierzu das Einzugsgebiet der Unteren Spree,
also das Gebiet zwischen Spreewald und
Berlin, untersucht….
Susann Mertz
Quelle: zitiert aus lr
epaper, 22.03.2025
IHK: Wasser ist
Standortfaktor in der Lausitz
Wasserkonferenz in Cottbus
Cottbus. Wasser ist für die Unternehmen nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus ein wichtiger Standortfaktor.
„Die Wirtschaft muss darauf vertrauen können, dass die wirtschaftliche Lage nicht weiter unter Druck gerät, weil Wasser knapp wird“,
sagte IHK-Hauptgeschäftsführer André Fritsche vor der dritten Wasserkonferenz Lausitz.
„Der Erfolg des Strukturwandels hängt an den Lösungen im Wassermanagement.
Spätestens 2038 mit dem Ende des Kohleabbaus wird es trocken in der Lausitz, sollten wir nicht jetzt gegensteuern.“
Die Wasserkonferenz Lausitz wollte am Donnerstag
(27.03.2025)
in den Blick nehmen, wie
sich der Strukturwandel in der Wasserwirtschaft gestaltet.
dpa
Quelle: dpa, 28.03.2025
Anm..:
Hier können Sie einen Beitrag des RBB zu der "Wasserkonferenz" vom 27.03.2025 sehen:
Der Wasserpegel wird weiter
sinken
Gutachten Schlechte Aussichten für Badegäste: Der Großsee kann seinen Wasserstand nicht stabil halten.
Die
Ursachen liegen im undichten Fundament und dem sinkenden Grundwasserspiegel.
…Der Pegel sinkt, der weiße Sandstrand beim Campingplatz wird Jahr um Jahr
breiter. Seit 2019 pumpt die Leag deshalb zusätzliches Wasser in den See…

Die
Wasserkante des Großsees bei Tauer zieht sich seit Jahren zurück. Blickk auf
den Badestrand vom Rettungsturm aus.
Foto: Michael Helbig
bild 2

Das
Foto von 1980 zeigt den damaligen Wasserstand. Heute verläuft die Uferlinie,
wo auf dem Bild die große wasserrutsche steht.
Foto: Privatarchiv Rene Jahn
…1,40 Meter Pegelstand sollte die Messlatte im See bereits 2020 anzeigen, so das erklärte Ziel dieser Maßnahme.
Das wurde allerdings nie erreicht. Im Gegenteil. Mit jedem Sommer rückt das Ziel in weitere Ferne.
Ein
aktuelles Gutachten bestätigt, was Anrainer und Stammgäste schon seit
längerem vermuten: Ein stabiler Pegelstand im Großsee bleibt auch in Zukunft
Utopie…
Pegel des Großsees instabil
…„Es muss eine Art Loch im See geben“, vermutet René Jahn, Pächter des Waldcampingplatzes am Großsee, bereits seit einigen Jahren.
Das Gutachten
zeigt jetzt, dass der Campingplatzbetreiber nicht ganz Unrecht hatte….
…Es
ist nicht ein Loch, durch das der See sein Wasser verliert – das ganze
Fundament des Sees ist undicht. Genauer gesagt:
Der
See liegt nicht in wasserdichtem Erdmaterial, sondern in sandig-kiesigem
Grund – Ablagerungen, die nach der Eiszeit hier entstanden sind….
…Der Großsee ist also keine Badewanne, die isoliert befüllt werden kann, sondern unmittelbar mit dem Grundwasser verbunden.
Deshalb zeigen auch die Maßnahmen der Leag nur wenig Wirkung. Durch die sandig-kiesigen Ufer fließt das Wasser, das
in
den See gepumpt wird, in alle Richtungen in den nächsten Grundwasserleiter
ab….
…„Wenn man versucht, einen See, der auf Grundwasser angewiesen ist, mit Grundwasser zu stabilisieren,
da beißt sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz“, fasste Sebastian Fritze, Präsident des LBGR in Cottbus, das Problem schon vor
Veröffentlichung des Gutachtens zusammen…
….Hauptverantwortlich dafür macht das Gutachten den Klimawandel. Wegen der
klimatischen Veränderungen bilde sich immer weniger Grundwasser neu….
…Außerdem liegt der Großsee in einem Gebiet, in dem die Grundwasservorkommen durch den Tagebau Jänschwalde beeinflusst werden.
Eine Auswirkung auf den
Großsee kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, so das Gutachten….
Empfehlungen des Gutachtens
….Der angestrebte Zielwasserstand wird nicht erreichbar sein, so die Erkenntnis aus dem Gutachten.
Weil das eingeleitete Wasser nicht im See
bleibt, soll auch die Wassermenge, die in den See gepumpt wird, nicht erhöht
werden….
….Da zu erwarten ist, dass sich die Klimaveränderungen auch in Zukunft negativ auf die Grundwasservorkommen in der Region (Anm.: ???)
und damit den Pegel im Großsee auswirken, empfiehlt das Gutachten einen sparsamen Umgang mit den
Grundwasservorräten
ohne genaue Maßnahmen zu
formulieren….
Die
Seen im Gebiet des Tagebaus Jänschwalde
…Neben dem Großsee liegen auch der Kleinsee, der Pinnower und der Deulowitzer See im Einzugsgebiet der Grundwasserabsenkung für den Tagebau Jänschwalde.
Während im Deulowitzer See wie im Großsee der Pegel trotz Wassereinleitung
ständig fällt, hat der Wasserstand im Kleinsee sich nach einer Wassereinleitung wieder einigermaßen stabilisiert.
Auch im Deulowitzer See
ist der Wasserpegel in den vergangenen Jahren wieder etwas gestiegen, das
zeigt ein Monitoring der Gewässer…. moe
Luise Mösle und Stefanie
Krautz
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 27.09.2024
Branitzer Park in Cottbus: Pegel sinken – ist Fürst Pücklers Erbe in Gefahr?
…Die Spree ist so voll, dass der Ostsee selbst im Hochsommer Wasser bekommt. Gleichzeitig sinken im Branitzer Park in Cottbus die Pegel….
… Der Weg windet sich unter hohen Bäumen durch den Branitzer Park. Gleich geht es einen seichten Hügel hinauf und öffnet den Blick zum Schloss über den Schwarzen See.
Der macht seinem Namen allerdings gerade mehr Ehre, als gedacht. Der Untergrund des Gewässers liegt feucht und dunkel da. …
..Alle Gräben und Seen im Pückler Park führen aktuell ungewöhnliches Niedrigwasser.

…Der Pegel im Branitzer Park ist deutlich gesunken. …Schließlich führt die Spree, aus der sich auch die Gewässer des Parks speisen, ausreichend Wasser….
…Ingolf Arnold klärt auf. „Das ist ein Stresstest.“ Der Hydrologe begleitet die Geschicke des Branitzer Parks seit Jahrzehnten und berät die Stiftung.
Durch den Kohleausstieg werde die Spree in Zukunft deutlich weniger Wasser führen.
Der Fluss, so betont es der Wasserexperte, habe in den vergangenen 70 Jahren unnatürlich viel Wasser geführt.
Hinzu kommen die veränderten Niederschläge und die höhere Verdunstung.
Wasser wird also durch den Klimawandel und das Ende des Bergbaus erneut ein knappes Gut für den Park….
Der niedrige Pegel macht sich in allen Gewässern des Branitzer Parks bemerkbar. Die Faschinen werden sichtbar.
Die
Holzkonstruktionen sichern die
Uferkanten.
Pücklers Ärgernis löst sich erst 100 Jahre nach seinem Tod

Schlamm und vermodertes Laub: Der Schwarze See im Branitzer Park führt
Niedrigwasser
Foto: Peggy Kompalla
….Deshalb seien hydrologische Untersuchungen nötig, um herauszufinden, was der Park verträgt.
…Sprich: Mit welchem Minimum an Wasser er zurechtkommt, ohne dabei Schaden zu nehmen.
Genau das werde aktuell simuliert.
Dafür seien zunächst Daten des Normalzustands erhoben worden….
…Der schwankende Wasserspiegel sei im Übrigen ein ständiges Ärgernis des Fürsten gewesen, erzählt Parkkenner Ingolf Arnold.
Das Problem wird allerdings erst mehr als 100 Jahre nach Pücklers Tod im Jahr 1984 gelöst.
Weil der Tagebau dem Park das Wasser abzugraben drohte, entwickelten die Fachleute Schutzmaßnahmen.
Deshalb wurde unter anderem ein Wasserzuleiter von der Spree gebaut. Der garantiert dem Branitzer Park seither eine kontinuierliche Wasserzufuhr….
…Der Stresstest laufe in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und auch mit dem Fischereiberechtigten im Park. …
.. Am Nachmittag des 19. Juli (2024) werde die Wasserzufuhr wieder allmählich hochgefahren...
…Die erhobenen Daten und die Erkenntnisse daraus seien wichtig für den Park, betont Ingolf Arnold.
Schließlich gehe es darum, welche Priorität dem Gartendenkmal von Fürst Pückler in Zukunft eingeräumt wird, wenn die Spree in Dürrejahren wenig führt…. Peggy Kompalla
Quelle: zitiert aus lr-online.det, 20.07.2024
Ausführlich unter (mit Bezahlschranke):
Berlin und Brandenburg wollen Elbe und Ostsee anzapfen
Wasserknappheit Regen kann das Problem der schwindenden Reserven in der Region nicht lösen.
Jetzt sollen länderübergreifenden Leitungen das Trinkwasser sichern. Die Rohre könnten noch weiter reichen.
….Im vergangenen Jahr (2023) ist in Berlin mit mehr als 700 Litern pro Quadratmeter fast doppelt so viel Regen gefallen wie im Jahr zuvor.
Zudem haben die Berliner weniger Wasser verbraucht. Der durchschnittliche Tagesbedarf ist von rund 113 Litern auf 109 Liter pro Kopf gesunken….
…Um wieder auf das Niveau der Vor-Dürre-Jahre zu kommen, bräuchte die Region Berlin-Brandenburg mindestens noch zwei ähnlich regenreiche Jahre wie 2023…
…Doch ob Regen oder nicht, in Spree und Havel, aus denen Berlin derzeit einen großen Teil seines Wasserhaushaltes deckt,
werden die Pegel langfristig auch ohne krasse Hitzesommer weiter sinken. Ein Grund dafür ist unter anderem das für 2038 beschlossene Ende der Lausitzer Braunkohleförderung.
Experten warnen schon jetzt, dass die Spree deutlich weniger Wasser führen wird, weil aus den Tagebauen dann kein Grundwasser mehr in den Fluss gepumpt wird…
…Die Regierungschefs von Sachsen, Brandenburg und Berlin haben dazu am vergangenen Freitag (14.06.2024) bei einem Treffen in der Hauptstadt eine Erklärung unterzeichnet.
Ziel ist ein gemeinsames und schnelles Handeln.
Die drei ostdeutschen Bundesländer fordern zudem vom Bund mehr Unterstützung bei der zukünftigen Wasserversorgung in der Lausitz sowie in der Region Berlin-Brandenburg….
Anm.:
Zum wievielten Mal eigentlich … es ist wieder einmal Wahlkampf in Brandenburg
Mieter sind Hauptverbraucher
…Während zu den größten Wasserverbrauchern in Brandenburg unter anderem die PCK-Raffinerie in Schwedt oder große Spargelbauern zählen, sind es in Berlin eher die privaten Haushalte.
Unter den Top 20 Wassernutzern in der Hauptstadt finden sich laut Wasserbetrieben alle großen Wohnungsbauunternehmen.
Unter den Top 30 werden unter anderem die Deutsche Bahn, die Bäderbetriebe sowie Vattenfall aufgezählt….
….Beide Länder sind auf auskömmliche Pegelstände in Spree und Havel angewiesen und fördern das kühle Nass aus den gleichen Grundwasserschichten….
…Die Berliner Wasserbetriebe schlagen deshalb schon seit Jahren vor, sogenannte Verbundleitungen zwischen Berlin und dem Umland herzustellen,
um kurzfristig auftretende Versorgungsspitzen sowohl zwischen Berlin und Umland als auch zwischen einzelnen Umlandverbänden auszugleichen….
…Derzeit arbeiten Berlin und Brandenburg an einer gemeinsamen Wasserstrategie.
Diese soll Ende dieses Jahres (2024) auf dem Tisch liegen, kündigte Franziska Giffey (SPD), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe, an….
…Unter anderem wird im Rahmen des "Masterplans Wasser 2050" auch eine Fernwasserversorgung der Region aus der Elbe diskutiert…
…Möglich wäre langfristig auch eine Trinkwassergewinnung für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg aus der Ostsee. Dazu müssten aber entsprechende Entsalzungsanlagen gebaut werden….
…Um die Trinkwasserversorgung zu sichern und sich auch weitestgehend unabhängig zu machen, investieren die Berliner Wasserbetriebe
vor allem in bessere Abwasserreinigung sowie in neue Wasserwerksstandorte wie Jungfernheide und Johannisthal…
Bild Münchehofe
…Die aktuellen Grenzwerte würden aber jetzt schon eingehalten… Neben den Kläranlagen fließt viel Geld in den Umbau Berlins zur Schwammstadt.
Mit der Hilfe von speziellen Rinnen, Bepflanzung und Versickerungsfläche will man dafür sorgen, dass nicht zu viel Regenwasser verloren geht….
…Die … Anlage - Stahnsdorf - wird bis 2034 als fertigzustellender Komplettneubau geplant, der die neuen Techniken von Beginn an umfasst
und doppelt so viel Abwasser reinigt wie das heutige Werk, das derzeit auch rund ein Drittel des Brandenburger Abwassers entsorgt beziehungsweise
wieder zu Trinkwasser aufbereitet….
Deutlich weniger Einnahmen
…Die Krux an der aktuellen Bilanz:
Aufgrund der aus Ressourcen-Sicht positiven Wetterlage wurde weniger Wasser verkauft,
und der gestiegene Aufwand für die Mitbehandlung von Regenwasser wird nicht vergütet.
So nahmen die Berliner Wasserbetriebe auch weniger ein und der Jahresüberschuss fiel um 46,4 Millinen auf 219,9 Millionen Euro.
Die Trinkwasserpreise werden aber laut Wirtschaftssenatorin Giffey auch in den kommenden Jahren stabil gehalten…. Maria Neuendorff
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 19.06.2024
Anm.:
Das Problem „Wassernot“ ist hinlänglich bekannt, aber immer wieder wird in regelmäßigen Abständen darüber berichtet –
ohne das praktisch etwas passiert.
Gründe, die das Problem zusätzlich verschärfen, sind u.a.:
Überproportionales Bevölkerungswachstum in Berlin
Zusätzliche Ansiedlung von Industrien, z.B. TESLA
in insgesamt angespannter Wassersituation
„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn“
Dieses Zitat aus Goethes Faust, beschreibt den derzeitigen Stand der Bemühungen der Länder, eine Wassernot zu verhindern hervorragend.
Ad pia propensos vota rogate deos!
Die Lösungsvorschläge liegen doch auf dem Tisch.
Länder fürchten Wassernot
Brandenburg, Berlin und Sachsen sehen Bund in der Pflicht.
Kohleausstieg wird zum Problem.
Potsdam/Berlin. Die drei ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Berlin und Sachsen fordern vom Bund
mehr Unterstützung bei der zukünftigen Wasserversorgung in der Lausitz und in der Metropolregion Berlin- Brandenburg.
Nach dem für 2038 beschlossenen Ende der Lausitzer Braunkohleförderung erwarten Experten,
dass die für die Trinkwasserversorgung in Berlin wichtige Spree deutlich weniger Wasser führt, weil aus Tagebauen kaum noch Grundwasser in den Fluss gepumpt wird.
Anm.: Für diese Erkenntnis benötigt man keine Experten.
…Eine eingeschränkte Wasserverfügbarkeit dürfe die Lebensgrundlagen wie auch den Strukturwandel in der Region nicht gefährden,
heißt es in einer Erklärung, die die Regierungschefs von Sachsen, Brandenburg und Berlin am Freitag (14.06.2024) bei einem Treffen in der Hauptstadt verabschiedeten….
Finanzierung gefordert
…In der Erklärung wird darauf verwiesen, dass die Kohleverstromung in der Lausitz einen großen Anteil an einer verlässlichen Energieversorgung in Deutschland hatte und noch habe.
Im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg seien nun zusätzliche Veränderungen des Wasserhaushaltes der Lausitz zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund stehe der Bund in der Pflicht, nötige wasserwirtschaftliche Anpassungen finanziell abzusichern….
…Der Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree drohen einer Studie des Umweltbundesamts zufolge große Engpässe.
Mit dem Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz könnte der Fluss demnach in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen.
Das Amt rät zu Wasserüberleitungen zur Spree aus benachbarten Flüssen wie Elbe, Lausitzer Neiße und Oder. Das könnte beispielsweise mithilfe von Leitungen oder
Tunnellösungen in Verbindung mit Wasserspeichern geschehen. dpa
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 15.06.2024
Anm. zum vorherigen Artikel:
Dieses Problem ist der Wasserwirtschaft (siehe Vorschläge der BTU Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie, Prof. Grünewald) schon lange bekannt,
dazu bedurfte es keiner (neuen) Studie des Umweltbundesamtess
Es folgt ein Zitat aus der Laudatio anlässlich des 80. Geburtstages von Prof. Grünewald, BTU Cotbus-Senftenberg:
Quelle: Märkischer Bote, 31.05.2024
Zitat Anfang
„Prof. Grünewald war es auch, der sich als Erster öffentlich über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Elbewasser-Überleitung zur Spree
äußerte und dabei damals (vor 25 Jahren) vielfach Spott erntete.
Prof. Grünewald wird aber nicht müde zu mahnen,
dass aktuell in der Gesellschaft kaum auf älteres, sorgfältig erarbeitetes Wissen zurückgegriffen wird
und stattdessen mit vielen Steuermillionen immer wieder neue Untersuchungen angestellt werden.
Dies trifft sowohl auf die Hochwasservorsorge als auch auf die absehbaren wasserwirtschaftlichen Folgen des Kohleausstiegs zu.“
Zitat Ende
Der Kampf gegen das Wasserdefizit der Spreee
Pläne Der Fluss ohne die permanente Zufuhr von Wasser aus den Lausitzer Tagebauen ist für die Wasserwirtschaft noch eine Horrorvorstellung.
Aber langsam werden Lösungswege sichtbar, wie das Gewässer in Zukunft aussehen könnte
….Ein festinstalliertes Gremium soll künftig das knapper werdende Spreewasser bilanzieren und verteilen.
Vertreter aus Sachsen, Brandenburg und Berlin,
die sich schon bisher regelmäßig zu der Arbeitsgruppe Fließgewässer zusammenfanden, sollen die neue Verwaltungseinheit, einschließlich einer Geschäftsstelle, bilden…
…Bereits heute fehlen bis zu 60 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, um alle gewünschten Aufgaben und Ziele zu jeder Jahreszeit zu erfüllen.
Und dieses Defizit wird eher noch wachsen….
….Zu berücksichtigen ist sowohl die Trinkwasserversorgung bis Berlin als auch der Spreewald.
Eine stabile Wasserführung sei zudem Voraussetzung für weitere Gewerbeansiedlungen. Werde diese nicht gesichert, könne dies weitere Ansiedlungen und Entwicklungen hemmen….
…Ein Großteil des heutigen Spreewassers stammt nicht aus deren natürlichen Quellen und Zuflüssen,
sondern aus aktiven und Sanierungstagebauen in den Fluss gepumpt werde….
Ein neuer Flussquerschnitt?
…Von den jährlich 150 Millionen Kubikmetern Spreewasser stammen in Sachsen 86 Millionen Kubikmeter aus Tagebauen.
Dieser Anteil wird mit der fortschreitenden Rekultivierung und dem absehbaren Rückgang und Ende der Braunkohleförderung immer weiter sinken.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plädiert Stefan Jentsch, Betriebsleiter Spree Neiße der Talsperrenverwaltung Sachsen
für einen Ausbau der Staukapazitäten im Flussbereich. Dafür würden sich die Tagebauseen Lohsa II und Bärwalde aus seiner Sicht besonders gut eignen….

Der Tagebaurestsee Lohsa 11 soll zum Speicher umgebaut werden.
Foto: Peter Radke
..Jentsch geht für Lohsa II von einem Stauvolumen von 90 Millionen Kubikmetern aus.
Derzeit sorgen nur die Talsperren Bautzen und Quitzdorf
mit einem Speichervermögen von knapp 30 Millionen Kubikmetern für eine stabile Wasserführung
auch während der Sommermonate bis in den Herbst hinein.
Hinzu komme in Brandenburg die Talsperre Spremberg. Jenrsch venvies
auch auf sinkende Niederschläge, steigende Temperaturen und damit höhere Verdunstung infolge des Klimawandels….
…Längerfristig sieht der Betriebsleiter auch eine Notwendigkeit, über ein neues Kleid für die Spree, also einen veränderten Flussquerschnitt, nachzudenken.
Bei zurückgehender Wasserführung wäre es sinnvoll, an besonders breiten Stellen das Flussbett schmaler zu gestalten, uni die Wasserführung zu sichern und auch die Verdunstung zu reduzieren….
Wasser aus anderen Flüssen
..Nachgedacht werde in den Gremien verstärkt auch über eine Wasserzufuhr aus anderen Flüssen.
Da der Neiße bereits Wasser entnommen werde und deren Potenzial begrenzt sei, bleibe nur als schon lange diskutierte Variante eine Zufuhr aus der Elbe.
Diese Möglichkeit werde nun verstärkt untersucht…
…Bezüglich der Flutungen der Tagebaurestseen in der Lausitz wird darauf verwiesen, dass damit ein System geschaffen werde, das es in dieser Form noch nirgendwo gebe.
Das mache es einschließlich der wechselnden Niederschläge schwierig, die Endpunkte der Flutung und die jährichen Füllstandsmengen vorauszusagen.
Ähnlich sei dies mit Verdunstungsraten. Dieser Prozess müsse weiter begleitet und erforscht werden…
Angesichts der Herausforderungen durch drohende Eisenhydroxideinträge und Versauerung durch Einfließen von Grundwasser in die entstehenden Seen gebe es zu den Flutungen keine Alternative…
...Auch wenn es gelinge, eine naturnahe Gestaltung der Spree zu erreichen, werde weiter eine Regulierung der Wasserführung erforderlich sein.
Dies stelle eine Generationenaufgabe für die Region dar, betonte der Betriebsleiter….
Wer wofür beim Wasser (in Sachsen) zuständig ist
Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen ist ein Staatsbetrieb mit Hauptsitz in Pirna.
Fünf regionale Betriebe betreuen vor Ort Stauanlagen, Gewässer und Hochwasserschutzanlagen in Zuständigkeit des Freistaats.
Sie sind meist in die Betriebsteile Bau, Stauanlagen und Fließgewässer gegliedert. Dazu gehören jeweils mehrere Fluss- und Staumeistereien
sowie die Untersuchungsstellen der Landestalsperrenverwaltung.
Die großen Brauchwasserspeicher in Ostsachsen - wie die Talsperren Bautzen und Quitzdorf - werden vom Betrieb Spree/Neiße mit Sitz in Bautzen bewirtschaftet.
Dazu gehören die gefluteten Tagebaurestseen bei Knappenrode und Lohsa. Der Betrieb bereitet sich auf die Übernahme weiterer Tagebaurestseen im Lausitzer Seenland vor.
Rund ein Drittel der Gewässer 1. Ordnung in Sachsen betreut der Betrieb Spree/Neiße. An den Gewässern befinden sich mehr als 100 Wehre,
Um Gewässerstruktur und ökologische Durchgängigkeit zu verbessern, werden funktionsuntüchtige Wehre zurückgebaut und noch benötigte umgebaut.
Aber auch der Hochwasserschutz an den Gewässern des Freistaates liegt in Ostsachsen beim Betrieb Spree/Neiße.
In den vergangenen Jahren wurden im Freistaat Sachsen viele Deiche saniert und neue Hochwasserschutzanlagen gebaut.
Für den Hochwasserschutz ist der Betriebsteil Bau zuständig, die Gewässerunterhaltung führen die Gewässermeistereien durch.
Um die Stauanlagen kümmert sich das Gewässermanagement von zwei Standorten aus.
In Lohsa und Görlitz-Hagenwerder lagern in Hochwasserschutzlagern Sandsäcke und andere Materialien für den Notfall. Ronald Ufer
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 04.04.2024
Als Ergänzung zu dem obigen Artikel ist das Klicken auf den folgenden Link
zu empfehlen.
Elbe-Wasser Flüsse retten – kann das funktionieren?
Der Wasserhaushalt in der Lausitz ist durch Braunkohle-Abbau schwer gestört, allerorten fehlt Wasser.
Die Not ist so groß, dass es Ideen gibt, selbst die Elbe anzuzapfen. Könnte das funktionieren? Ein Lausitzer hat dazu eine eindeutige Meinung.
…Es sind Bilder, die sich in die Gehirne der Lausitzer eingebrannt: Die Schwarze Elster ist auf Kilometer ausgetrocknet. Gäbe es nicht gewisse Schutzbarrieren,
könnte selbst die Restlochkette zwischen Senftenberg und Hoyerswerda massiv an Wasser verlieren.
Deshalb hat der Bergbautreibende zwischen Restlochkette und Tagebau Welzow-Süd eine mehrere Kilometer lange Dichtwand errichtet, die über 100 Meter in die Tiefe reicht…
… In den Jahren von 1900 bis 2020 wurden im Zuge des Braunkohlenbergbaus in der Lausitz rund 58 Milliarden Kubikmeter Grundwasser gefördert.
Heute beläuft sich das Grundwasserdefizit nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) auf vier Milliarden Kubikmeter.
Durch den politisch gewollten Kohleausstieg wird die Grundwasserförderung durch den Bergbau immer weiter absinken und perspektivisch ganz eingestellt werden….
…Die entsprechenden Auswirkungen zeigen sich dann vor allem bei der Spree. Da dort bislang die sogenannten Sümpfungswässer des Bergbaus eingeleitet werden,
wird sich das Wasserangebot erheblich verringern. Die Schwarze Elster, früher ebenfalls ein Hauptabnehmer für das bergbaulich gehobene Grundwasser,
wird heute vor allem durch die Rainitza gestützt. In den trockenen Sommern muss außerdem Wasser aus den Tagebauseen zur Stützung der Elster eingesetzt werden….
…Die Idee, von der Elbe einen Kanal zur Spree und zur Oder zu bauen, ist bereits über 100 Jahre alt….

Das Relief an dem Schwarzheider Wohnhaus lässt bereits ein Schiff auf dem visionären Elbe-Spree-Oder-Kanal fahren. Das Gebäude hat inzwischen massiven Brandschaden erlitten
…Jetzt führt das Umweltbundesamt in seinem Bericht über die wasserwirtschaftlichen Folgen in der Lausitz eine Elbwasser-Überleitung wieder auf.
Und zwar eine Wasserentnahme bei Grödel unweit von Riesa sowie eine Druckrohrleitung zum Knappensee
sowie Einleitungen in die Schwarze Elster und in die Spree.
Zweite Möglichkeit wäre eine Wasserentnahme bei Prossen in der Sächsischen Schweiz und ein anschließender Tunnel bis zur Spree bei Bautzen.
Als dritte Möglichkeit wird die Wasserentnahme bei Prossen sowie die Leitung per Tunnel und Druckrohrleitung zum Knappensee
und die dortige anteilige Überleitung in die Spree angeführt.
Der Knappensee könnte deswegen der zentrale Punkt werden,
weil von dort sowohl das Fließsystem der Schwarzen Elster als auch das der Spree nahe liegen….
Experte rät vom Elbe-Kanal ab
….Altgediente Lausitzer Bergleute, wie der ehemalige Bergmann Walter Karge halten die Elbwasser-Überleitung indes für nicht zielführend.
Aus seiner Sicht brauche sich die Region zum Wasser keine großen Sorgen zu machen…
....So werde in Senftenberg mittels mehrerer Brunnen Wasser gehoben, um eine Vernässung zu verhindern.
Verschiedene Gräben unweit der Schwarzen Elster haben Grundwasseranschluss, bedingt durch ihre Lage im Lausitzer Urstromtal…
… Für das sächsische Umweltministerium gehört die Elbwasser-Überleitung zu einem "breiten Bündel von Maßnahmen, die jetzt zu prüfen sind…
...Das Ministerium schätzt weitere Maßnahmen ebenso dringlich ein, beispielsweise den Wasserrückhalt in der Fläche,
die Wiederherstellung von Auen und naturnahen Flussläufen sowie die Bewirtschaftung von Seen und Speichern….
… Die Brandenburger Grünen haben wegen der Dringlichkeit des Themas ein Positionspapier mit insgesamt elf Maßnahmen erarbeitet.
Gefordert werden unter anderem eine Braunkohlenstiftung mit einem zweistelligen Milliardenbetrag, um die Bergbaufolgen sanieren zu können.
Was die Elbwasser- Überleitung angeht, zeigen sich die Grünen eher verhalten. Sie sagen, dass eine Prüfung des Vorhabens in Ordnung gehe,
aber das nicht unbedingt gebaut werden müsse. Schließlich benötige die Elbe ihr Wasser selbst, und eine Überleitung würde größere Eingriffe in die Landschaft bedeuten….
Der historische Elbe-Spree-Oder-Kanal
…Während des Ersten Weltkrieges wurde an den Plänen für den Elbe--Spree-Oder-Kanal, kurz ESO, gearbeitet.
Dieser sollte auf einer Länge von knapp 160 Kilometern Mühlberg mit Lauchhammer, Cottbus, dem Schwielochsee und Frankfurt (Oder) verbinden.
Der Kanal war neben der wasserwirtschaftlichen Bedeutung auch für den schnelleren Abtransport der Braun-kohle aus dem Lausitzer Revier vorgesehen. trt
Quelle: zitiert aus lr-online, 14.10.2023
Ausführlich unter (leider mit Bezahlschranke):
Nachtrag:
Eine ausführliche Dokumentation zur Geschichte eines „geplanten“ ESO- Kanals finden Sie auch im Beitrag von Ingolf Arnold,
"Lausitzer Sehnsüchten zum europäischen Wasserstraßennetz",
enthalten in
NIEDERRLAUSITZ zwanzig-neunzehn, Jahrbuch Nr.3
ISBN 978-3-937503-23-3
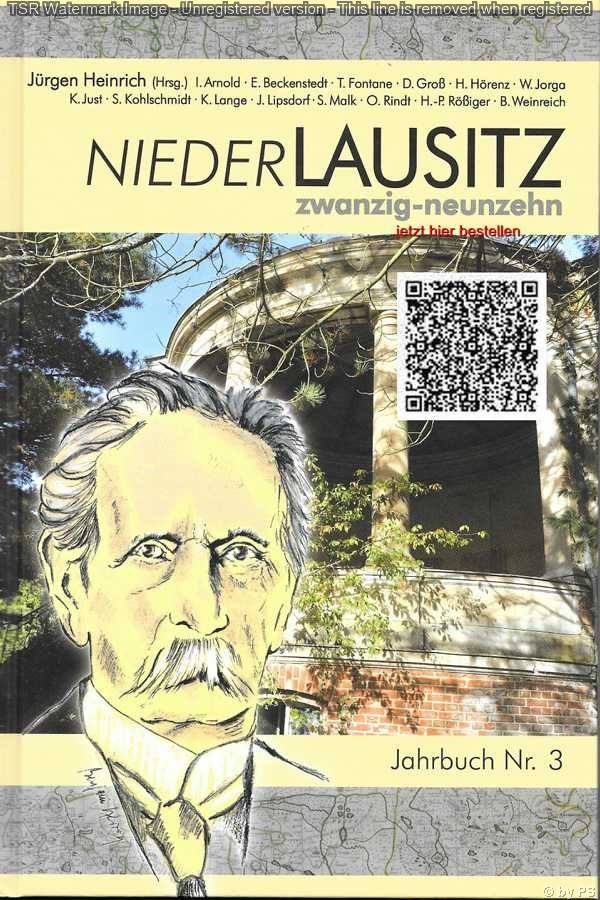
Dürremonitor für Deutschland (August / September 2023)
Warum werden derartige Nachrichten (s.u.) in den Mainstreammedien auf das kleinste Maß reduziert?
Während für Nachrichten zur „Dürre“ ganze Zeitungsseiten kaum ausreichen.
Auf jeden Fall können wir beruhigt sein:
Die Naturgesetzmäßigkeiten, hier der Wasserkreislauf „funktionieren“ noch.
Keine Dürre mehr in deutschen Böden
Leipzig - Die Dürresituation in Deutschlands Böden hat sich durch das feuchte Winterhalbjahr (2023) und den teils sehr nassen Sommer (2023) deutlich verbessert.
„Die Böden sind bis auf eine Tiefe von 60 Zentimetern deutsch landesweit
gut durchfeuchtet - in manchen Regionen sogar nasser als üblich“, so Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig.
Nur in Teilen Ostdeutschlands sei die Dürre im Boden noch stärker ausgeprägt.
Quelle: BILD, 11.09.2023
Alle Jahre wieder ...
Cottbus (und andere Kreise in BB) verbietet Wasserentnahme
Cottbus. Die Stadt schränkt ab heute (22.07.2023) tagsüber die Entnahme von Wasser aus Seen und Flüssen ein.
…Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Unteren Wasserbehörde des Fachbereichs Umwelt und Natur der Stadt Cottbus
ist gestern (21.07.2023) auf www.cottbus.de veröffentlicht worden.
Die Verfügung regelt die befristete Einschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs.
Damit wird die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr untersagt…
.... Die Einhaltung der Allgemeinverfügung wird überwacht….
…Die Unteren Wasserbehörden der benachbarten Landkreise haben mit entsprechenden Einschränkungen
bereits auf die gegenwärtig angespannte wasserwirtschaftliche Situation reagiert…
…Anlass ist, dass der. natürliche Wasserhaushalt auch in diesem Jahr wieder unter den Folgen der Trockenheit der Vorjahre leidet
und die hochsommerliehen Temperaturen die Situation aktuell wieder verschärfen.
Die geringen Niederschlagsmengen haben das Wasserdargebot im Einzugsgebiet der Spree stark zurückgehen lassen.
Es hat sich erneut eine Niedrigwassersituation in den Fließgewässern eingestellt... red/jkl
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 22.07.2023
Das sind die Ergebnisse fehlenden Sach- und Fachverstandes
der politischen Entscheidungsträger und ihrer Berater.
Im nachfolgenden Leserbrief auf den Punkt gebracht.
Trinkwasser wird knapper
Zum Wassersparen
Obwohl wir uns mitten in einer der üblichen Klimaschwankungen befinden, siedelt man mitten im Auto-Land Deutschland
und ausgerechnet mitten in dessen trockenster Region einen riesigen Mitbewerberautobauer an.
Dessen Wasserbedarf hätte man sich zuvor mitteilen lassen können.
Nun ruft ein Wirtschaftsminister im Nachhinein die Bürger zum Wassersparen auf?
Intelligente und ehrliche Wirtschaftsförderung geht anders.
Wieder müssen die Bürger die Folgen der Politik ausbaden und natürlich auch bezahlen.
Für die Politiker gibt es stets nur einen Lösungsweg, die Steuer-
oder Preiserhöhung.
Andreas Heising, Storkow
Die Lüge vom Niedrigwasser im Gardasee

Steine statt Wasser: Gardasee-Insel ist mittlerweile zu Fuß zu erreichen
Unstatistik des Monats: Der Gardasee ist halb leer
Quelle:Epoch Times, 31.05.2023
…Wäre der Gardasee tatsächlich halbleer, dann müsste
mit dem durchschnittlich 135 Meter tiefe See etwas höchst Ungewöhnliches
geschehen sein. Ein Blick auf Zahlen….
Anm.:
Schlagzeilen
…„Beliebtes Urlaubsziel fällt trocken: Gardasee nur noch zu 38 Prozent gefüllt“, alarmierte uns der „Stern“ und befürchtete:
„Drohen Duschverbote und leere Pools?“ Das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ meldete:
Ähnlich berichtete auch das „Handelsblatt“: „Der Gardasee führt so wenig Wasser wie seit 70 Jahren nicht mehr.
Laut neuesten Satellitenaufnahmen erreicht er nur um die 40 Prozent seines Fassungsvermögens.“ (2. Mai, 2023, S. 14) „Merkur.de“ zeigte sogar Satellitenbilder,
die den dramatischen Rückgang des Wassers
demonstrieren sollten – und die „Kronen Zeitung“ warnte: „Dramatisches
Video zeigt austrocknenden Gardasee“….
Was ist mit dem schönen Gardasee geschehen? …
…Verschiedene Medien haben versucht, die Ursachen zu finden: zu wenig Regen, kaum Schneereserven, ein ungewöhnlich trockener und warmer Winter –
und dann die Klimakrise. All dies ist richtig, aber wie
sollen diese Faktoren den Gardasee innerhalb kürzester Zeit zur Hälfte
entleeren?...
..Trotz aller Aufregung in der deutschsprachigen Medienwelt berichteten die Gäste am Gardasee vorort von einem wunderschönen Urlaub.
Auch auf den
Satellitenbildern können wir beim besten Willen keinen Unterschied im
Wasserstand zwischen diesem und dem vergangenen Jahr erkennen. Wo liegt hier
das Problem?
Die Antwort: in der Zahlenblindheit mancher Medien….
Leicht zu
verwechseln: die Referenzklasse
…Woher kommen also die Absenkungen über 38 Prozent, 40
Prozent oder die Halbierung des Wasserstands?
… Der Wasserstand wird an einem Pegel in Peschiera gemessen und misst die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt.
Diese Höhe ist aber nicht die Wassertiefe des Sees, sondern ein
willkürlicher Wert an der Messlatte, der in der Regel leicht unter dem
niedrigsten Wasserstand über viele Jahre hinweg angesetzt wird…
…Der Gardasee ist an der tiefsten Stelle 346 Meter tief
und hat eine Durchschnittstiefe von etwa 135 Metern. Zudem wird er künstlich
reguliert. Das Ablassen von Wasser wird gestoppt, sobald der Nullpunkt
erreicht wird…
… Im Vergleich zum Vorjahr (2022) war Mitte März 2023 der Wasserstand des Gardasees 53 Zentimeter niedriger. Also 53 Zentimeter von etwa 135 Metern – nicht die Hälfte des Fassungsvermögens des Sees oder gar mehr.
Hinzu kommt, dass der
Pegelstand stark über das Jahr hinweg schwankt….Zudem lag er am 22. Mai 2023
auch schon wieder bei 80 Zentimetern – mit steigender Tendenz…
…Der Pegelstand schwankt überdies stark von Jahr zu Jahr. Am 15. Mai 2007 lag er beispielsweise ebenfalls bei 46 Zentimetern wie in der derzeit alarmierenden Meldung.
Zehn Jahre später, am 15. Mai 2017,
lag er dann bei 107 Zentimetern. Jede Veränderung muss man gegen die
natürlichen Schwankungen abwägen….
…Die Geschichten über den halb leeren Gardasee folgen
einem weit verbreiteten Fehler in der Kommunikation…
…Eine absolute Veränderung (der Wasserstand im Gardasee
ist 53 Zentimeter niedriger) wird unnötigerweise in Prozent kommuniziert
(circa 50 Prozent weniger) und damit wird es leicht, die Referenzklasse zu
verwechseln, auf die sich die Prozentangabe bezieht….
…Viele Medien warnen uns vor Fake News. Manche
produzieren diese allerdings gleich selbst, ohne es zu bemerken.
Denken mit Zahlen sollte endlich Teil der Allgemeinbildung werden….
… Mit der „Unstatistik des Monats“ hinterfragen der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Walter Krämer,
die STAT-UP-Gründerin Katharina Schüller und RWI-Vizepräsident Thomas K. Bauer jeden Monat sowohl jüngst publizierte Zahlen als auch deren Interpretationen.
Alle „Unstatistiken“ finden Sie im
Internet unter www.unstatistik.de und unter dem Twitter-Account
@unstatistik.
Der Artikel erschien zuerst
bei
Unstatistik.de
unter dem Titel
„Der Gardasee ist halb
leer“.
Ausführlich unter:
Bei den meisten Bewohnern Brandenburgs bedarf es keines Appells zum
Wassersparen, besonders in Zeiten von Niedrigwasser.
Vielmehr sollte man die Schuld für die entstandene „Notlage“
vielmehr bei den Politikern suchen,
…die obwohl die angespannte Wasserhaushaltssituation in Brandenburg und besonders im Raum Berlin schon lange bekannt ist,
die Ansiedlung von TESLA (mit einem Wasserbedarf einer Kleinstadt
mit 40.000 Einwohnern) befördert haben
…die eine fast ungezügelte Zuwanderung von Menschen nach Berlin (1980: etwa 3,0 Mio, 2020: etwa 3,7 Mio Einwohner) und das engere Umland, die mit Trinkwasser versorgt werden
müssen, zugelassen haben
obwohl Ostbrandenburg schon immer zu den niederschlagsärmsten
Gebieten Deutschlands (auch ohne
Klimawandel) zählt und sich das Wasserdargebot im Einzugsgebiet (hier:
Spree) nicht vergrößert hat
Umweltminister ruft zum Wassersparen auf
Trockenheit Der Landtag Brandenburg will Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte in die Pflicht nehmen - möglicherweise auch mit höheren Preisen.
...Angesichts extremer Trockenheit in Brandenburg haben Vertreter der Parteien und Umweltminister Axel Vogel (Grüne)
am
Donnerstag (22.06.2023) im Landtag zum Wassersparen aufgerufen....
..."Sparen, speichern, wiederverwenden" -
dieses Credo stellte der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke in den Mittelpunkt
der Aktuellen Stunde zu Wasserknappheit und Trockenheit in Brandenburg....
...Dem konnten die Abgeordneten aller anderen Fraktionen folgen....
...Raschke sagte, dass alle Akteure ihren Beitrag zum Ressourcenschutz
leisten müssten....
...Die Behörden würden mit einem Wasser-Check bei Wirtschaftsansiedlungen
auf den richtigen Umgang mit dem knappen Gut pochen, ergänzte Raschke....
...Redner anderer Fraktionen hielten ihm und dem grünen Umweltminister Axel
Vogel vor, die
falschen Schwerpunkte zu setzen, beziehungsweise sich mit der Fülle
teilweise guter Konzepte zu verzetteln....
..Dem jüngst in einem Gutachten
unterbreiteten Vorschlag, einen Wasser-Überleiter von der Elbe zu bauen,
erteilten Vertreter mehrerer Fraktionen eine Absage....
...Axel Vogel brachte indes den Bau von Fernwasserleitungen ins Spiel.... Es werde mit Berlin über eine Versorgung aus der Ostsee gesprochen.
Fragen zu Kosten und Zeitplänen für diese
Rohrleitungen würden derzeit durchgespielt….
Sollte es sich bei dem o.g. Vorschlag tatsächlich um Wasser aus der Ostsee (Salzgehalt der Ostsee setzt sich aus dem einströmenden Salzwasser der Nordsee und dem Süßwasser der Flüsse und des Regenwassers zusammen).
Er liegt zwischen 0,3 und 1,8 Prozent) handeln,
es müssten dann Entsalzungsanlagen
installiert werden.
Mathias Hausding
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 23.06.2023
Schwarze Elster Fluss wächst in Senftenberg zu – darum greift das Umweltamt nicht ein
Die Schwarze Elster ist in Senftenberg kaum noch als Fluss erkennbar. Denn das Gewässer wächst immer mehr zu.
Woher rührt dieses Phänomen? Und welche Folgen hat es für die Senftenberger
und die Elster selbst?
…Die Schwarze Elster hat eine Länge von rund 180 Kilometern. Sie entspringt am Hochstein bei Elstra fließt quer durch die Lausitz sowie die Elbe-Elster-Niederung
und mündet östlich von Wittenberg in die Elbe.
Das Besondere an diesem Fluss: Er präsentiert sich über viele Kilometer kanalisiert. /span>
Zwischen Senftenberg und Hoyerswerda musste das Gewässer
aufgrund der dortigen Braunkohlentagebaue in ein neues Bett verlegt werden….
…Während des Dürresommers 2022 war die Schwarze Elster im Raum Senftenberg über mehrere Kilometer komplett ausgetrocknet.
Fische und
weitere Wasserlebewesen verendeten massenhaft.
Inzwischen führt der Fluss dank reichhaltiger Niederschläge im September (/span>2022) zwar wieder durchgehend Wasser. Außerdem speist die Rainitza,
ein von Großräschen kommender Nebenfluss, ab Senftenberg die Elster.
Doch das Nass ist kaum oder gar nicht erkennbar.
Stattdessen führen die Elsterbrücken über eine Sumpflandschaft…
Röhricht und Laichkräuter statt Wasser in der Elster
…Der Grund: Das Flussbett ist im Raum Senftenberg über viele Kilometer mehr oder weniger komplett zugewachsen.
Röhricht und Laichkräuter bilden dichte,
fast undurchdringliche Bestände. Das ist in der Schwarzen Elster an sich nichts Ungewöhnliches.
Doch in diesem Jahr präsentiert sich dieses Phänomen
besonders ausgeprägt….
…Warum, weiß Sprecher Thomas Frey vom Landesamt für Umwelt (LfU)… o:p>
„Die Schwarze Elster führt auch in diesem Jahr permanent Niedrigwasser, wie in vier der vergangenen fünf Jahre.
Aktuell liegt der Abfluss noch immer unterhalb des mittleren Niedrigwasserabflusses.
…Die langen und häufiger wiederkehrenden Trockenzeiten schreiben die Experten dem sich wandelnden Klima zu. 2022 war die Schwarze Elster
zwischen Tätzschwitz und Senftenberg von Juni bis September
komplett trocken….
Letzter Rückzugsraum für Fische und weitere
Wasserlebewesen
…Dennoch existiere aktuell eine gewisse Wasserströmung….
…Nun kennt wohl jeder Senftenberger die jährlich wiederkehrende Mahd in der Elster.
Anders hingegen im laufenden Jahr: Unter den extremen Bedingungen des Sommers 2022 habe das LfU entschieden, die Krautung auszusetzen…
Erst
wenn wieder mehr Wasser vorhanden ist, könne mit der Mahd begonnen werden…
…Zwar könnte theoretisch auch landseitig gemäht werden. Doch praktisch werde dies nicht passieren.
Der Grund: Naturschutzfachliche und
gewässerökologische Gründe sprächen dagegen….
In Sachsen wird die
Schwarze Elster derzeit gekrautet
…Während auf Brandenburger Seite auf die Mahd in der Schwarzen Elster
vorerst verzichtet wird, ist im Oktober (2022) die Krautung des Flusses
in Sachsen angelaufen….
…Nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung soll aber nicht alles abgemäht
werden. Hier und dort lassen die Krauter Pflanzeninseln stehen.
Der Grund: Schutz der dortigen Lebewesen.
Die Mahd soll von Hoyerswerda
stromabwärts bis zur Brandenburger Grenze unweit von Tätzschwitz fortgeführt
werden….
Torsten Richter-Zippack
Quelle: zitiert aus lr-online, 02.11.2022
Ausführlich unter:
„Die Verteilung
(des
Wassers)
muss gerecht sein“
Ressourcen Wer Wasser fördert, soll dafür bezahlen, fordert
Wolf Merkel vom Branchenverband DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).
Er tritt auch dafür ein, belastende Ewigkeits-Chemikalien aus dem Verkehr zu
ziehen.
Unter dieser Überschrift äußert sich Herr Wolf
Merkel u.a. zu folgenden Fragen:
Auch dieses Jahr war bisher zu trocken. In Brandenburgist zu befürchten,
dass es kaum eine Neubildung von Grundwasser
geben wird. Wie ist die Situation in Deutschland?
Die gute Botschaft ist, dass wir deutschlandweit nicht von einer zurückgehenden Wassermenge sprechen müssen.
Die jährlichen Niederschläge werden in Deutschland in etwa auf dem bisherigen Niveau bleiben.
Das gilt grundsätzlich ebenso für die Neubildung von Grundwasser.
Regional ist das unterschiedlich. Wir haben dazu als DVGW
eine Studie beim Umweltforschungszentrum Leipzig in Auftrag gegeben.
Sie bestätigt: Wir haben genug Niederschläge, uns geht das Wasser
nicht aus. Aber wir müssen für Mangelzeiten vorsorgen.
Wie kann diese Vorsorge aussehen?
Versorger müssen dazu die Klimawandel- und Wasserhaushaltsprognosen für ihre Region kennen. Da tun Bundesländer einiges, um Daten zur Verfügung zu stellen.
Wir haben vor, Erkenntnisse aus den Untersuchungen des Umweltforschungszentrums Leipzig für die Unternehmen nutzbar zu machen.
Jeder Versorger sollte wissen, wie sich das Wasserdargebot in seiner Region
entwickelt. Er sollte auch den Bedarf in den nächsten 30 bis 50 Jahren
abschätzen können.
Was verstehen Sie unter öffentlicher
Trinkwasserversorgung? Fällt das Gießen des Gartens auch darunter?
Darunter verstehe ich die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch - für die Ernährung, Hygiene. den Haushalt.
Ich würde an die Menschen appellieren, in Mangelsituationen das Gartenbewässern oder Füllen der Pools (Anm.: Scheinbar hat jeder Bürger einen Pool) einzuschränken.
Jetzt wäre eine gute Zeit für Kommunen, Konzepte für Engpässe im Sommer zu entwickeln und
um Verständnis bei der Bevölkerung zu werben - nicht erst dann, wenn das
Wasser knapp wird.
Der Verbraucher soll sparen, wenn es knapp
wird. Aber wie geht man mit der Industrie in solchen Situationen um? Muss
dann dort der Verbrauch gedeckelt werden?
Der Bedarf der Industrie wird überschätzt. Von den 25 Milliarden Kubikmeter Wasser, die wir insgesamt im Jahr nutzen, geht etwa die Hälfte an die Industrie.
Das meiste Wasser benötigen Energieerzeuger zum Kühlen. Sie leiten es wieder in die Flüsse ein.
Wir haben jetzt in der Gasmangellage gesehen, dass die meisten Leute lieber persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen, als den Arbeitsplatz zu gefährden.
Dort, wo in diesem Jahr ein Wassermangel
aufgetreten ist, war vermutlich zumeist das vorsorgende Risikomanagement
nicht gut.
Ina Matthes
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 22.10.2022
Anm.:
Die „grünen“ Minister sind dabei das Fahrrad noch einmal zu erfinden....
Nachhaltiges Wassermanagement Brandenburg, Berlin und Sachsen wollen bei Wasserversorgung enger zusammenarbeiten…

Foto: IMAGO / Rainer WeisflogBrandenburg und Berlin müssen ausreichend mit Wasser versorgt werden,
die Sanierung der Tagebaulandschaften ist wasserintensivdie Wirtschaft braucht Wasser - und nicht zuletzt auch die Gewässer.
Das haben nun drei Länder
gemeinsam im Blick.
Brandenburg, Berlin und Sachsen wollen zusammen für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser in der Kohleregion Lausitz sorgen,
um die Probleme in der Wasserwirtschaft zu bewältigen.
Im sächsischen Boxberg (Landkreis Görlitz) haben Sachsens Umweltminister Wolfram Günther,
sein brandenburgischer
Amtskollege Axel Vogel sowie die Berliner Staatssekretärin für Umwelt und
Klimaschutz, Silke Kracher, (alle Grüne) am Montag (19.09.2022) ein entsprechendes Positionspapier unterzeichnet.
Es sieht unter anderem vor, dass eine länderübergreifende Zentrale der Wasserbewirtschaftung eingerichtet
und eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung aufgebaut wird. Brandenburg und Sachsen
arbeiten schon seit Jahren im Wassermanagement vertraglich zusammen,
jetzt wird Berlin mit einbezogen.
Sachsen mit besonderer Verantwortung
Die Herausforderungen mit Blick auf den Kohleabbau sind vielfältig. Brandenburg und Berlin müssen ausreichend mit Wasser versorgt werden,
die Sanierung der Tagebaulandschaften ist wasserintensiv und auch
die Wirtschaft braucht Wasser. Außerdem müssen Grund- und
Oberflächengewässer, wie zum Beispiel Flüsse, genügend Wasser führen.
….Sachsen trage eine besondere Verantwortung für die gesamte Lausitz bis nach Berlin, sagte Umweltminister Wolfram Günther …
"Im Freistaat befinden
sich die Flüsse, Speicher und Talsperren, von denen Brandenburg und Berlin
als Unterlieger abhängen."…
….Der Braunkohlebergbau habe den Wasserhaushalt in der
Region schwerst gestört….
….Dürre und Trockenheit hätten zuletzt überdeutlich gezeigt, dass die Klimakrise mit voller Wucht in Sachsen angekommen sei, so Günther. Der Wasserhaushalt müsse nachhaltig und langfristig stabilisiert werden...
Anm.:
Was wird eigentlich mit der Panikmache: Klimakrise… bezweckt?
Man sollte endlich einmal die hydrologischen und
meteorologischen Daten des Einzugsgebietes der Spree zur Kenntnis nehmen.
…Deshalb fordern die Länder unter anderem die Errichtung einer im Koalitionsvertrag vorgesehenen Stiftung oder Gesellschaft,
die den Rückbau der Kohleverstromung und die Renaturierung
organisiert….
Stabile
Wasserversorgung kein Selbstläufer
… Die "gravierenden Folgen des Kohleabbaus für den Wasserhaushalt" (laut: Vogel) könnten nicht von einer Generation bewältigt werden.
Für die dafür notwendigen Maßnahmen seien zuerst die
Bergbauunternehmen in der Pflicht….
… Es brauche laut Vogel vor allem in niederschlagarmen
Zeiten ein gemeinsames Handeln auf allen Ebenen. ..
"Das gilt für das Einzugsgebiet von Spree, mit dem ökologisch, touristisch und landwirtschaftlich bedeutenden Spreewald, und der Schwarzen Elster gleichermaßen".
Anm.:
Meines Wissen ist das kein Novum und wurde schon in den beiden zurückliegenden Trockenjahren zum Wohle aller Beteiligten erfolgreich praktiziert….
Laut Berlins Staatssekretärin für Umwelt und Klimaschutz, Silke Kracher, spiegle das Positionspapier die maßgeblichen Forderungen aus Sicht der Umweltverwaltungen wider.
Berlin sei für die
Trinkwasserversorgung auf das Wasser der Spree angewiesen. "… Sendung: Fritz,
19.09.2022, 15:30 Uhr
Quelle:
Spree gerettet, die Elster in Not
Klima Der Regen hat nicht alle Wasserspeicher der
Lausitz auffüllen können.
Cottbus/Senftenberg. Die jüngsten Niederschläge um Cottbus und im Spreewald haben
nach der extremen Trockenperiode dieses Sommers
endlich die Wasserspeicher aufgefüllt.
…Die Spree ist im Mittellauf wieder optimal
versorgt. Das bestätigte das Landesumweltamt….
…Die Schwarze Elster aber leidet weiter. Das
Flussbett liegt teilweise noch immer trocken…
…Die Spree hatte zur Niedrigwasseraufuöhung die planmäßigen Mengen aus den sächsischen Speichern verbraucht.
Die Wasserreserven der Talsperren gingen zu Ende. Nun ist der Speicher Spremberg voll.
Das Wasserkontingent der Talsperren Bautzen und
Quitzdorf ist indes knapp. kw
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 02.09.2022
Dürre in Lausitz und Spreewald: Regen rettet nur die Spree, die Schwarze Elster ist weiter in Not – Trockenheit und Wassermangel
Um Cottbus und im Spreewald ist jetzt endlich genug Regen gefallen, um die Wasserspeicher aufzufüllen. Die Spree ist wieder optimal versorgt.
Die
Schwarze Elster aber leidet weiter. Was ist los?
Warum hat die Spree auf einen Schlag wieder genug
Wasser?
…Der Wetterumschwung hat zum Teil extreme Niederschläge im mittleren und unteren Spreegebiet.
Innerhalb von drei Tagen ist nach der extrem langen Hitzeperiode um Cottbus reichlich Niederschlag gefallen.
An der Station Cottbus sind 45,2 Millimeter gemessen worden. Im Oberspreewald, also um Lübbenau, und der Lieberoser Heide ist örtlich noch weit mehr Regen gefallen.
Die
Niederschläge im sächsischen Spreegebiet sind indes weit weniger ergiebig
gewesen….
…Die Spree hat zur Niedrigwasseraufhöhung aus den sächsischen Speichern in
diesem Sommer aber die planmäßigen Mengen gebraucht…
…Die Niederschläge, die im mittleren und unteren Spreegebiet gefallen sind, haben jetzt den Effekt: Die Talsperre Spremberg muss weniger Wasser in die Spree abgeben.
Und
damit wird das nur noch geringe verfügbare Wasserkontingent der sächsischen
Speicher Bautzen und Quitzdorf kann somit weiter geschont werden….
Die Abgabe der Talsperre Spremberg ist auf 7,85 Kubikmeter pro Sekunde reduziert worden....
Warum leidet die Schwarze Elster weiter an akuter
Wassernot?

Die
Schwarze Elster liegt bei Senftenberg teilweise weiter trocken. Es gibt
nicht genug Wasser, um das Flussbett zwischen Kleinkoschen und der Mündung
der Rainitza zu füllen.
© Foto: Patrick Pleul/dpa
…Unverändert leidet die Schwarze Elster unter der Trockenheit. Nach wie vor ist der Fluss oberhalb der Stadt Senftenberg über mehrere Kilometer komplett ausgetrocknet.
Der Abfluss am Pegel Biehlen, unterhalb von Senftenberg, hat am 30. Juli nur 0,387 Kubikmeter pro Sekunde betragen und ist damit deutlich unter dem langjährigen Mittel geblieben.
Und
das, obwohl Abfluss und Wasserstand aus den Talsperren und Wasserspeichern
in Sachsen und dem Speicher Niemtsch, dem Senftenberger See, gestützt worden
sind…
…Die Niederschläge haben der Schwarzen Elster nur kurzzeitig geholfen.
…Zwischen Kleinkoschen und der Mündung der Rainitza liegt der Fluss trocken…
…Am Pegel Biehlen liegt der Abfluss mit nur noch 0,53 Kubikmetern pro Sekunde deutlich unter der für den Monat August mittleren Abflussmenge
von
etwa 1,80 Kubikmeter pro Sekunde.
Dabei bekommt der Fluss auch Wasser aus dem Senftenberger See. Der Wasserspiegel ist nach dem Regen satte fünf Zentimeter angestiegen, der Speicher damit wieder voll.
Zusätzlich erhält die Schwarzen Elster im Stadtgebiet von Senftenberg auch Wasser aus der Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) Rainitza,
die
die Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft (LMBV)
betreibt….

Der
Senftenberger See, der auch als Speicherbecken dient, hat nach dem Regen
beim Wasserstand satte fünf Zentimeter zugelegt.
© Foto: Soeren
Stache/dpa
…Flussabwärts in Bad Liebenwerda liegen die Abflüsse in der Schwarzen Elster mit 1,04 Kubikmeter pro Sekunde
weiter unterhalb des niedrigsten Abflusses von 1,14 Kubikmetern pro Sekunde für die Jahreszeit –
bezogen auf die
vergangenen fast 40 Jahre…
Kathleen Weser
Quelle: zitiert aus lr-online, 01.09.2022
Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):
-trockenheit-und-wassermangel-66253589.html#paywall-tab-anmeldung
Anm.:
Nach den ausgiebigen Niederschlägen in der 3. Dekade des
Monats August 2022 sind
Wasserspeicher fast aufgefüllt
Spree
Die Wassernot der Spree ist nach dem Regen beseitigt,
Cottbus/Spremberg. Der Regen der vergangenen Tage hat die Wassernot im Flussgebiet der Spree entspannt, aber nicht beseitigt.
Der Wasserspiegel der Talsperr e Spremberg ist durch
die Niederschläge um 17 Zentimeter angestiegen, die maximale Speicherhöhe
damit fast erreicht..
e Spremberg ist durch
die Niederschläge um 17 Zentimeter angestiegen, die maximale Speicherhöhe
damit fast erreicht..
….Am Spree-Pegel Leibsch (Dahme-Spreewald) liegt der Mindestwasserabfluss wieder bei 4,6 Kubikmeter pro Sekunde.
Die gefallenen Niederschläge sind damit laut
Flutungszentrale Lausitz "wasserwirtschaftlich kaum relevant"...
sha
Erläuterung:
Mit „wasserwirtschaftlich kaum relevant“ ist gemeint, dass die gefallenen Niederschläge weitgehend oberirdisch abgeflossen sind
und für die Grundwasserneubildung nicht relevant
sind.
So reagiert das Land bei Wassermangel in der Spree
Seit 2021 gibt es in Brandenburg ein Notfallplan bei Wassermangel.
Laut Niedrigwasserkonzept wird die Vorwarnphase Gelb ausgerufen, wenn der Pegel Leibsch innerhalb von sieben Tagen einen Abfluss unter 6,5 Kubikmetern pro Sekunde (m3/s) hat.
Ab 4,5 Kubikmetern gilt die Niedrigwasserphase Rot mit drei Stufen.
Bei Stufe 1 (Pegel liegt unter 4,5 m3/s)
werden bereits die Ausleitmengen in Nebengewässer reduziert und die Entnahme
von Wasser aus Oberflächengewässern beschränkt.
Bei Stufe 2 (Pegel unter 2,5 m3/s) wird die Abflussmenge nochmal reduziert und die Schleusen Krausnicker Strom, Groß Wasserburg
und Leibsch/Dahme-Umflut-Kanal eingeschränkt oder geschlossen. Die
Wasserentnahme aus der Spree wird verboten.
Bei Stufe 3 (Pegel unter 1,5 m3/s) wird das Wasser prioritär durch die Hauptspree und den Puhlstrom geleitet, weitere Schleusen geschlossen,
sodass viele kleine Gräben ganz vom Zufluss abgeschnitten sind.
Aktuell (Stand: 27.08.2022) gilt die Niedrigwasserstufe 2. Der Tourismus im Spreewald ist selbst bei Stufe 3 kaum beeinträchtigt,
weil es zahlreiche Alternativrouten in dem weit verzweigten Wassernetz gibt,
wie der Tourismusverband betont.
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 29. 08.2022
Ausführlich unter (leider nur für Abonnnenten):
….Knappheit ist Politikum
Für Marten Lange-Siebenthaler (NABU) ist der
Klimawandel der maßgebliche Verursacher für sinkende Wasserpegel und
-spiegel.
Doch hinzu komme auch Brandenburgs größer werdender Durst: Neue Wohngebiete, Industrieansiedlungen, die Landwirtschaft alle brauchen Trinkwasser.
Sind die bisher geltenden Grundwasserfördermengen überhaupt noch vertretbar?
In welchen Wechselwirkungen stehen Wasserentnahmen in Schwerpunktwirkungsräumen zueinander?
Was der Mensch
mit dem Wasser unter der Erde anstellt, wird immer politischer, da es
knapper wird.
Brandenburgs sterbende Seen sind ein Symptom dafür….
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 18.08.2022
Anm.:
Bei allen Diskussionen sollte man nicht vergessen, dass kein Wasser
verloren-
geht, denn es gibt einen Wasserkreislauf (Lehrstoff der Unterstufe)
Streit
um zu wenig Wasser
Trockenheit
Das
Bewässern von Gärten steht in der Kritik im Landkreis Spree-Neiße
Guben/Forst. Das Wasser ist knapp in der Lausitz. Die Neiße hat in Guben jetzt einen historischen Tiefstand erreicht. Auch die Spree führt so wenig Wasser wie lange nicht.
Die Vor-und Kleingärten werden aber weiter kräftig bewässert. Mit Trinkwasser. Davon ist in der Region genug da. Noch...
Die Meldung von Mitbürgern, die Wasser verschwenden,
nimmt zu.
Die Debatte, ob dies schlichtes Denunziantentum
oder berechtigte Sorge ist, wird kontrovers geführt.kw
Quelle: Lausitzer Rundschau, 16.08.2022
Anm.:
Bei allen derzeitigen (oft auch herbeigeredeten)
Mangelerscheinungen, wobei der
vermeintliche Wassermangel erst der Anfang ist, angeheizt durch
Panikmache, die fast zu Hysterie führt, auch durch die
Mainstream-Journalisten
geschürt, wird auch das Denunziantentum Hochkonjunktur haben.
Ein alter deutscher Spruch lautet:
Der größte Lump im ganzen Land,
das ist und bleibt der Denunziant.
Bei diesem Thema zeigt sich wie gespalten die Nation ist.
Übrigens, um etwas qualifizierter mitreden zu können, sollte man
sich die Datenlage um „Wasser“ ansehen:
Wasser-Daten in Brandenburg
Das Landesamt für Umwelt hat viele Wasserdaten bereits digitalisiert. Das Pegelportalliefert Hochwasserberichte und Messwerte für die Flussgebiete in Brandenburg,
Eine Karte über Grundwassermessstellen gibt schon Auskunft über die Grundwasserstände und stellt hydro geologische Informationen bereit.
Die Auskunftsplattform Wasser informiert ebenfalls über Grundwasserstände, deren Analysen sowie auch die Pegel mancher Seen und Flüsse.
Vereinzelt lassen sich diese als
Diagramme einsehen.
Allerdings sind die Messwerte von Seen noch nicht vollständig digitalisiert.
"Kontinuierliche, langjährige Beobachtungen des Wasserstandes sind hier mit hohen Aufwendungen verbunden,
dabei bleibt der wasserhaushaltliche Erkenntnisgewinn oftmals gering", erläutert Thomas Frey vom Landesumweltamt.
Daher werden nur wenige Seen beobachtet.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 18.08.2022
Streit um das
Wasser
Nach Hitze-Phase in der Lausitz –so groß ist die Wassernot wirklich
Das Wasser ist knapp nach andauernder Hitze ohne nennenswerte Niederschläge. Lausitzer empören sich über Nachbarn, die Vor- und Kleingärten weiter kräftig bewässern.
Sind das Wasser-Denunzianten oder Mitmenschen in Sorge,
die berechtigt ist?

Die Rasensprenger laufen auf Hochtouren in der Lausitz.
Das steht auch in der Kritik.
© Foto: Roland Weihrauch/dpa
…Die
Neiße
hat in
Guben
einen historischen Tiefstand erreicht. Auch die Spree führt so wenig Wasser
wie lange nicht. Schleusen im
Spreewald
werden geschlossen, die Wasserzufuhr in Nebengewässer gesperrt…. Jetzt droht
das große Fischsterben in den Gräben….
…. Doch der Rasen vor dem Häuschen und die Kleingärten werden weiter kräftig bewässert. Mit Trinkwasser. Davon ist genug da. Noch…
(Anm.: Was soll die Bemerkung „noch“?).
…Das Beregnen von Gärten in der andauernden Hitzewelle ohne nennenswerte Niederschläge wird in Forst beispielsweise auf dem Beschwerdeportal Maerker heftig kritisiert. In Cottbus hat für Empörung gesorgt, dass auf den Grünflächen der Lausitzer Universität die Rasensprenger zur heißen Mittagszeit in Betrieb genommen wurden…
Anm.: Ohne jegliches Hintergrundwissen wird auf dem Beschwerdeportal Maerker denunziert.
Wie ist es jetzt um das Wasserangebot um Guben bestellt?
…Die Sommer sind in der Lausitz in den vergangenen Jahren immer trockener geworden, …sagt auch Ronny Philipp, der Verbandsvorsteher des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes (GWAZ)….
…Der Wasserabsatz im Raum Guben liegt in der
andauernden Hitzeperiode trotzdem genau im Mittel.
„Hier
sind keine besonderen Auswirkungen zu spüren“, sagt Ronny Philipp, der
Verbandsvorsteher des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes (GWAZ)….
… Aus der Wasserfassung Atterwasch können im Wasserwerk Schenkendöbern maximal 6000 Kubikmeter Rohwasser am Tag gefördert werden. Bei 4000 liegt die Menge jetzt.
Im Jahresdurchschnitt werden 3100 Kubikmeter
pro Tag gehoben. Der Versorger hat also noch große Reserven…
...Auch für große Investitionen wie die Ansiedlung der Unternehmen Rock Tech Lithium und Jack Link mit der Bifi-Produktion sind ausreichend Wasserreserven verfügbar.
Der Wirtschaftsstandort Guben
kann und soll weiter wachsen….
Verbote für das Gießen mit Trinkwasser in Trockenzeiten?
…Der Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband betreibt
acht Wasserwerke mit mehreren Wasserfassungen in der Fläche. Auch das ist
ein Vorteil bei der Trinkwassergewinnung im Schongang für das verfügbare
Grundwasser…
…Für das Bewässern der Vor- und Kleingärten hat etwa ein Drittel der Haushalte im ländlichen Raum Guben einen Abzugszähler, im Volksmund auch Gartenzähler genannt…
... Auch hier ist die Abnahme dem
Verbandsvorsteher zufolge seit Jahren etwa unverändert hoch….
….Sie liegt bei gut 80.000 Kubikmetern im Jahr….
zum Vergleich: Trinkwasser für den Hausgebrauch liefert
das größte Wasserwerk Schenkendöbern etwa eine Million (1.000.000) Kubikmeter im Jahr….
Anm.:
Ähnlich sieht die Situation im Versorgungsgebiet der
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG (LWG) aus, siehe
lr-online.de, 22.07. 2022
Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):
…In den frühen
Morgen- und späten Abendstunden zu gießen, müsse an Hitzetagen mit hoher
Verdunstung selbstverständlich sein.
Verbote und
verbindliche Einschränkungen für die Nutzung von Trinkwasser gibt es aber
nicht, betont der GWAZ-Chef….
Die WC-Spülung
schlägt ins Kontor und das Wasser ist weg
…Durchschnittlich verbraucht jeder Einwohner pro Tag 35 Liter sauberes Trinkwasser allein durch die WC-Spülung.
Im Jahr ist das eine
Wassermenge von 12.775 Litern pro Nase, glatt 27 Prozent des persönlichen,
direkten Verbrauches an Trinkwasser…
…Aus dem Klärwerk in Gubin werden täglich etwa 7000
Kubikmeter aufwendig gereinigtes Abwasser in die Neiße abgeleitet…

…Egon Rattei, Agraringenieur und langjähriger Chef der Agrargenossenschaft Forst, mahnt …unermüdlich an,
das Wasser aus den
Kläranlagen in der Landschaft der Region zurückzuhalten….
…Der Bewässerungsbedarf auf den Feldern wird größer. Befürchtet wird,
dass er künftig auch in der Lausitz die
Grundwasserneubildung übersteigen wird….
…Bei kleinen Kläranlagen wie der des Gubener Verbandes in Friedland (Oder-Spree)
ist das Zurückhalten vor Ort eine Option und wird
gemacht, sagt Ronny Philipp….
… Für die große Abwasseranlage in Gubin ist das nach
Recht und Gesetz aber nicht möglich…
Kathleen Weser
Quelle:
zitiert aus lr-online, 15.08.2022
Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):
Anm.:
Aus welchem Grund wurde eigentlich in der Printausgabe der Lausitzer
Rundschau vom 17.08.2022 zum gleichen Text und Thema die „reißerische“ Überschrift:
Wie groß ist die
Wassernot wirklich?
gewählt.
Spree fehlt Wasser Schleusen im Spreewald schließen – Fischsterben möglich

Dieser Teil des Stauseens bei Bagenz (Talsperre Spremberg) ist in den letzten Jahren aufgrund des Wassermangels in der Spree verlandet. Foto: Imago / Rainer Weisflog
Als Folge von Dürre und Wassermangel in der Spree reagiert das Landesumweltministerium mit weitreichenden Konsequenzen:
Ab Montag (15.08.2022) werden zahlreiche Schleusen im Spreewald geschlossen.
Das kündigte das Landesumweltministerium am Sonntag an. Ziel der Maßnahmen sei es, das Wasser in der Hauptspree und den großen Hauptgewässern zu konzentrieren.
…Am Ausgang des Spreewalds in Leibsch seien die Abflüsse auf ein extrem niedriges Niveau gesunken, teilte das Ministerium mit.
Die Umgebung sei ausgedörrt und die Zuflüsse brächten kein Wasser mehr in die Spree…
….Es müssten weitere harte Maßnahmen ergriffen werden,
damit der Abfluss der Spree unterhalb des Spreewaldes nicht komplett zum Erliegen komme.
Damit das Wasser weitgehend in der Hauptspree bleibe, müssen viele Ausleitungen komplett geschlossen oder stark eingeschränkt werden….
….. Das Landesamt für Umwelt bittet alle Gewässeranrainer, trockenfallende Gewässer
an die Landkreise zu melden oder gegebenenfalls eigenständig Fische und andere Wasserlebewesen zu retten und in wasserführende Gewässer umzusetzen. (dpa)
Quelle: zitiert aus Tagespiegel-online, 14.08.2022
Ausführlich unter:
Wassernot in Lausitzer Neiße
Umwelt Am Pegel Guben 2 ist ein neuer historischer Tiefstand gemessen worden.
Guben. Die Lausitzer Neiße führt bei Guben nach der anhaltenden Trockenheit dieses, Sommers so wenig Wasser wie nie zuvor.
Am Pegel im Norden der Stadt, unweit der Eisenbahnbrücke nach Polen, ist das historische Rekordtief von 61 Zentimetern gemessen worden.
Zuletzt war ein Wassernotstand dieses Ausmaßes im . deutsch-polnischen Grenzfluss im Jahr 1985 registriert worden. Normal ist im Monat August ein Wasserstand von 1,39 Metern.
Auch in regenarmen Zeiten führte die Neiße in der Vergangenheit für gewöhnlich ausreichend Wasser.
Das Niedrigwasser hat jetzt auch erste Konsequenzen: Angebote für Touristen - wie das Paddeln - mussten abgesagt werden. ten
Quelle: Lausitzer Rundschau, 13.08.2022
Niederschlagsarme Jahre, zunehmend heiße Sommer, dazu steigender Wasserverbrauch – das sorgt in Polen für hydrologische Dürre.
Die
PiS-Regierung will nun dafür sorgen, dass weniger Wasser in die Ostsee
abfließt.

Polen: Blick von der Słubicer Seite über das
Niedrigwasser auf die Stadt Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Der Pegel der
Oder liegt hier aktuell bei weit unter einem Meter. © Foto: Patrick
Pleul/dpa
…Nachrichten über austrocknende Flüsse und drohende
Versteppung weiter Landstriche prägen die Schlagzeilen in
Polen.
Für die größten Flüsse von Brandenburgs Nachbarregion Lubuskie (Lebuser
Land) meldet das polnische Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft
(IMGW) niedrige Wasserstände…
….So steht die Oder in der Stadt Nowa Sol noch bei 123 Zentimetern, in Slubice- Frankfurt Oder) bei nur noch 74 Zentimetern.
Auch Warthe (Warta) und Netze (Notec) fließen mit niedrigsten Pegelständen durch Westpolen.
122 Zentimeter ist
die Warthe in Posen tief, 157 in Gorzow. All diese Orte sind auf der Karte
des Instituts https:/ /hydro.imgw.pl/#map/)
mit schwarzen Dreiecken markiert, was
Niedrigwasserbereich bedeutet…. '
…Dazu im Vergleich der Messpunkt an der Weichselpromenade in Warschau, wo Polens größter Fluss momentan nur noch 32 Zentimeter tief ist.
In Gubin-Guben misst das Institut in der Lausitzer
Neiße 26 Zentimeter….
…Das IMGW warnte bereits Ende Mai (2022) vor einer bevorstehenden hydrologischen Dürre in mehreren Wojewodschaften,
darunter Lubuskie.
Hydrologische Dürre tritt nach längeren trockenen Phasen ein.
Von meteorologischer Dürren spricht man,
wenn es ein bis zwei Monate trockener als üblich ist.
Von landwirtschaftlicher Dürre, wenn es nach
zwei Monaten und länger Ernteeinbußen gibt.
Erst ab vier Monaten Trockenheit, wenn
Grundwasser und Pegelstände sinken, tritt eine hydrologische Dürre
ein….
….Die polnische Regierung bringt derzeit ein … Programm zur Bekämpfung der Wasserknappheit auf den Weg, das vor allem Maßnahmen vorsieht, Wasser zu sammeln,
bevor es in die Ostsee abfließt….
... Bis zum Jahr 2030 sollen in Polen 15 Prozent der Niederschläge aufgefangen werden…zum Beispiel sollen Rückhaltebecken wie Stauanlagen gebaut werden,
aber auch Flüsse renaturiert, Feuchtgebiete wiederherstellt, Bergbaulandschaften saniert, Wald erhalten und aufgeforstet
und die Praxis
landwirtschaftlicher Bewirtschaftung verbessert werden…
…Wie Infrastrukturminister Marek Grobarczyk
erklärte, geht um 14 verschiedene Maßnahmen im Wert von insgesamt 22
Milliarden Zloty
(4,6 Milliarden Euro)…Nancy Waldmann
Quelle: zitiert aus moz online, 03.08.2022
Ausführlich (leider nur für
Abonnenten) unter:
Wassermangel in Brandenburg Reserven zu 70 Prozent aufgebraucht – Situation an Schwarzer Elster und Spree spitzt sich zu
Die Trockenheit in Brandenburg nimmt zu. Im Monat Juli 2022 fiel noch weniger Niederschlag als in den Vormonaten.
Die Flüsse Spree und Schwarze Elster leiden unter
extremen Niedrigwasser. Und Regen ist nicht in Sicht.

Ausgetrocknet ist ein Teilabschnitt des Flusses
Schwarze Elster in Südbrandenburg. © Foto: Patrick Pleul/dpa
….Mit den steigenden Temperaturen steigen die
Trockenheit, und auch die Waldbrandgefahr nimmt erneut zu…
…Für die Flüsse in Brandenburg und Berlin hat dieses Wetter dramatische Folgen.
Wie das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg am Dienstag (02.08.2022) mitteilt,
geht der Juli 2022 als weiterer viel zu trockener Monat in die Statistik ein. Demnach fiel noch weniger Niederschlag als in den Vormonaten –
insbesondere die
Spree
und die
Schwarze Elster
leiden unter Niedrigwasser….
Nur 16 Prozent
Niederschlag der für Juli üblichen Menge
…Aus diesem Grund ist die länderübergreifende Ad-hoc-AG „Extremsituation“ erneut zusammengetreten,
um die Situation zu bewerten und
Maßnahmen zu beschließen.
Etwas Entwarnung gab das Ministerium an der Spree.
Durch die Speicher in
Sachsen
und die
Talsperre Spremberg
fließe Wasser in für das brandenburgische Spreegebiet.
Die Bereitstellung von Wasser sei auch bis zum Ende des Sommers (2022) gesichert. Auch die Talsperre Spremberg habe
im Juli eine weitestgehend konstante Wassermenge
von durchschnittlich 9,2 Kubikmeter pro Sekunde an das mittlere Spreegebiet
abgegeben….
Schleusen im
Spreewald sollen passierbar bleiben
…Wegen der Trockenheit wurden zur Stabilisierung der Abflüsse seit dem 19. Juli (2022) die Maßnahmen der Phase 2
des sogenannten Niedrigwasserkonzeptes für das mittlere Spreegebiet umgesetzt.
Um die Situation insbesondere im
Spreewald
zu verbessern, wurden ab 1. August (2022) Anpassungen in den Stauhaltungen vorgenommen….
… Das gesamte Gebiet war im Juli (2022) von der Schwarzen Elster extremer Trockenheit betroffen. Die Speicherreserven sind zu 70 Prozent aufgebraucht, so das Ministerium.
Der Flussabschnitt oberhalb der Mündung der Rainitza bis in das
sächsische Landesgebiet hinein führe nach wie vor kein Wasser….
…Ab Senftenberg werde die Schwarze Elster weiterhin durch die Ausleitung aus dem Speicherbecken Niemtsch – dem Senftenberger See –
und die Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) Rainitza gestützt. Aus den
übrigen Zuflüssen komme kaum noch Wasser. Am Pegel in
Bad Liebenwerda
führe die Schwarze Elster weiter ungewöhnliches Niedrigwasser….
Fische in der
Schwarzen Elster verendet
… wegen der angespannten Situation wirde die Ad-hoc-AG
„Extremsituation“ regelmäßig zusammentreten, um die Situation zu bewerten
und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen….
…In den vergangenen Woche waren auch zahlreiche Fische
in der ausgetrockneten Schwarzen Elster verendet, Anwohner berichteten
teilweise von starkem Gestank nach Verwesung….Claudia
Duda
Quelle:
zitiert aus lr-online,
02.08.2022
https://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/wassermangel-in-brandenburg-reserven-zu-70-prozent-aufgebraucht-_-situation-an-schwarzer-elster-und-spree-spitzt-sich-zu-65810979.html
Anm. zum nachfolgenden Artikel:
Was sollen eigentlich derartige effektheischenden Überschriften bewirken ... Hysterie schüren oder ?
Hitzewelle mit Wassernot
Versorgung Cottbus reagiert auf zu geringes Angebot in den Oberflächengewässern.
Cottbus. Die Rasenflächen auf dem Cottbuser Campus der Brandenburgischen-Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg werden in der größten Mittagshitze bewässert.
Der Landesbetrieb Straßenwesen warnt indes, dass Fußgänger und Autofahrer an Verkehrswegen jetzt durch abbrechende Äste der Straßenbäume gefährdet sind.
Es sei viel zu trocken, das Grün werde instabil.
Die Stadt Cottbus hat jetzt verfügt, dass die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Oberflächengewässern untersagt ist.
Wassernot und Wasserverschwendung
Anm.: mit ... Wasservewschwendung .... werden alle Cottbuser Bürger von den Journalisten der LR unter Generalverdacht gestellt
sind an der Tagesordnung derzeit.
Der Trinkwassersabsatz steigt enorm. Noch sind weitere Förderkapazitäten vorhanden.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 23. 07. 2022
Anm.:
Bitte erst einmal den Innenteil dieser Zeitung (Seite 15) lesen, um besonders die Zusammenhänge zu verstehen.
An dieser Stelle soll einmal Peter Scholl-Latour zitiert werden :
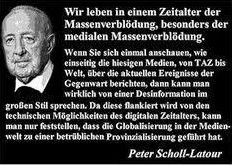
Dürre in Brandenburg: BTU Cottbus-Senftenberg bewässert Rasenflächen in größter Hitze
An der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus werden Rasenflächen in der größten Mittagshitze bewässert..
.Cottbus schwankt beim Wasserverbrauch zwischen Not und Verschwendung.
Anm.:
Welche Aussage soll eigentlich mit diesem Satz getroffen werden?

In Cottbus an der Universität sorgen laufende Rasensprenger in brütender Mittagshitze für Aufsehen. © Foto: Lukas Märkle
…An der Bibliothek der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus trauen Anwohner dieser Tage ihren Augen kaum.
Mittags laufen dort die Rasensprenger auf den Wiesen….
Anm.:
Hier werden Vorwürfe fern von Sach- und Fachkenntnis geäußert ohne den Sachverhalt zu prüfen.
Beginnt so das Denunziantentum?
Lesen Sie bitte weiter….
….BTU-Sprecherin Ilka Seer erklärt auf Nachfrage, das Bewässern in der Mittagszeit sei nicht der Regelfall….In der Regel werde am frühen Morgen und am Vormittag bewässert….
…Wobei sich angesichts überall vertrockneter Rasenflächen die Frage (Anm.: "Frage" des Journalisten) stellt, warum eine Rasenfläche aktuell überhaupt bewässert wird….
…Die Sprecherin äußert sich auch dazu: „Insbesondere würde auch der Bewuchs mit Sträuchern und Bäumen
lange Trockenperioden bei den derzeit herrschenden Temperaturen kaum überstehen“, …
…Die Universität greift nicht auf Trinkwasser zurück, sondern nutze ausschließlich Brunnen-, also Grundwasser….
…Aus Sicht der Universität hätte es auch erhebliche Konsequenzen, wenn die Flächen nicht bewässert würden.
„Den Bereich nicht zu wässern hätte zur Folge, dass die vorhandenen Bäume (Flachwurzler) Schaden nehmen und in dieser besonderen (Hügel-)Lage
bei ungünstigen Windverhältnissen leichter entwurzeln könnten.“…

Rund um das Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ) der BTU in
Cottbus sind große Rasenflächen mit Bäumen und Sträuchern, die aufgrund der
Trockenheit gewässert werden.
© Foto: Michael Helbig
Anm.:
Erst einmal kundig machen …schadet nie
Flächendeckende Bewässerung nicht möglich
…Eine Bewässerung der (Straßen-) Bäume sei prinzipiell zwar sinnvoll,
sagt der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg, Steffen Streu.
Allerdings habe man rund 400.000 Bäume an Straßen in Brandenburg,…
Eine flächendeckende Bewässerung ist da nicht möglich…
Höchststand bei Trinkwasserverbrauch in Cottbus (Mitte Juli 2022)
…Auch im privaten Raum werden bei Temperaturen über 35 Grad der Wasserschlauch und die Gießkanne verstärkt in die Hand genommen. …
….Einige Wasserversorger in Deutschland kommen bereits an Kapazitätsgrenzen bei der Bereitstellung von Trinkwasser. …
…. Auch der hiesige Versorger, die Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG (LWG), stellt „einen extrem erhöhten Wasserverbrauch“ fest….
…Am Mittwoch (20. Juli) wurde der bisher höchste Verbrauch des Jahres mit 30.000 Kubikmetern Wasser registriert…
…Durchschnittlich werden täglich 19.000 Kubikmeter Wasser im Belieferungsgebiet der LWG verwendet….
… Die Kapazitätsgrenze liegt bei „deutlich mehr als 30.000 Kubikmetern“, so Meier-Klodt von der Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG (LWG)…
Keine Trinkwasserknappheit in Cottbus
…Trinkwasserknappheit herrscht also hier in der Region noch nicht vor. Man habe hier eine „sehr gute Grundwasserversorgung“
und die Bestände würden sich auch kaum verändern, sind in den letzten Jahren vielmehr sogar leicht gestiegen ….
Anm.:
U.a. auch wegen der in den vergangenen Jahren zurückgegangenen
Einwohnerzahlen im Versorgungsgebiet
…Die Gründe für den aktuell erhöhten Verbrauch sieht die LWG auch in der Gartenbewässerung durch Privatpersonen….
…Es gebe aber aktuell aus Sicht der LWG auch keinen Grund, das Gießen in Cottbus einzuschränken….
…. Allerdings: Bitte Garten- und Balkonpflanzen abends bewässern. Das ist besser für die Pflanzen und auch für die Wasserversorger…. Lukas Märkle (Volontär)
Quelle: zitiert aus lr-online, 22.07. 2022
Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):
Niedrigwassersituation hält an: Ad-hoc-AG beschließt weitere Maßnahmen (Stand: Mitte Juli 2022)

Der Juni fiel in den Einzugsgebieten von Spree und Schwarzer Elster größtenteils zu trocken aus. Es fehlt an Niedeschlag.
Foto: Pixabay
Cottbus. Die seit dem Frühjahr anhaltende Trockenheit in den beiden Flussgebieten Spree und Schwarze Elster sorgt weiterhin für niedrige Abflüsse. Insbesondere die Schwarze Elster ist mittlerweile von einer außergewöhnlichen Niedrigwassersituation betroffen. Die länderübergreifende Ad-hoc-AG »Extremsituation« hat daher weitere Maßnahmen beschlossen, informiert Frauke Zelt aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg.
…An der Wetterstation Cottbus wurden nur 77 Prozent der für Juni üblichen Niederschlagsmenge erreicht (Bezugsreihe 1981 – 2010).
Gleichzeitig war es ein sehr warmer Monat. Mit durchschnittlich 20,2 °C war der Juni um 3,1 Kelvin zu warm (Station Cottbus, Bezugsreihe 1981 – 2010)…
... Im Gebiet westlich der Spree, im Berliner Umland und im gesamten Einzugsgebiet der Schwarzen Elster war es zudem noch deutlich trockner….
…Der Juli, üblicherweise einer der niederschlagsreichsten Monate des Jahres, ist bisher durch Trockenheit geprägt.
Laut den aktuellen Niederschlagsprognosen, ist auch in der kommenden Woche kaum mit Regen zu rechnen.
Bis zum 13. Juli sind an der Station Cottbus erst 8,8 Millimeter Niederschlag gefallen,
dies entspricht lediglich 13 Prozent der für Juli üblichen Menge von 67,4 Millimetern (Bezugsreihe 1981 – 2010)….
Spree
…Im Spreegebiet wird die planmäßige Niedrigwasserstützung aus den Speichern in Sachsen und der Talsperre Spremberg weiterhin durchgeführt.
Die Reserven sind ausreichend, um bei Bedarf auch bis Ende September (2022) die Niedrigwasseraufhöhung vorzunehmen.
Spätestens ab Oktober ist dies in der Regel aber nicht mehr notwendig….
…Der Abfluss am Unterpegel Leibsch am Ausgang des Spreewaldes (Anm.: und Richtpegel für die Trinkwassergewinnung im Raum Berlin) lag in den vergangenen Tagen und Wochen zumeist zwischen 2,5 und 3,5 Kubikmeter pro Sekunde.
Der mittlere Niedrigwasserabfluss für den Monat Juli beträgt 2,89 Kubikmeter pro Sekunde (Bezugsreihe 1991 bis 2020). Die Abflüsse bewegen sich somit im durch Ad-Hoc AG „Extremsituation“ festgelegten Zielkorridor….
Schwarze Elster
…Im Flussgebiet der Schwarzen Elster ist die Situation im Vergleich zum Spreegebiet deutlich angespannter.
Das gesamte Einzugsgebiet ist in den letzten Monaten von einer wesentlich stärkeren Trockenheit als das Spreegebiet betroffen…..
... Die verfügbaren Speicherreserven im Gebiet sind zu mehr als 50 Prozent aufgebraucht, sodass eine Abflussstützung nur noch eingeschränkt möglich ist...
…Seit Anfang Juni ist der Abfluss am Verteilerwehr Kleinkoschen vollständig zum Erliegen gekommen. Oberhalb der Mündung der Rainitza in Senftenberg bis nach Hoyerswerda in Sachsen,
ist die Schwarze Elster auf weiten Strecken trockengefallen…Die brandenburgischen Gewässerabschnitte wurden von den Mitgliedern der Landesanglerverbandes Brandenburg e.V. in den letzten Wochen abgefischt….
…Das Speicherbecken Niemtsch (Senftenberger See) und die von der LMBV betriebene Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza übernehmen weiterhin die Stützung der Schwarzen Elster ab Senftenberg.
Der Abfluss am Pegel Biehlen liegt aktuell (13. Juli 2022) bei 0,37 Kubikmeter pro Sekunde…
…Aufgrund der Stützung des Abflusses der Schwarzen Elster und hohen Verdunstungsverlusten, ist der Wasserstand des Speicherbeckens Niemtsch zuletzt um etwa vier Zentimeter pro Woche gefallen.
Am 13. Juli 2022 lag der Wasserstand des Speicherbecken Niemtsch bei 98,64 Meter NHN…
…Auch die Reserven in den Seen der Restlochkette, aus der die Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza größtenteils ihr Wasser bezieht, haben sich erheblich verringert….
… Am Pegel Bad Liebenwerda führte die Schwarze Elster aktuell nur noch etwa 0,9 Kubikmeter Wasser pro Sekunde….
... Die Minimalwerte der Trockenperiode 2018 bis 2020 wurden somit unterschritten….
…Aufgrund der prekären Situation im Gebiet der Schwarzen Elster, hat die Ad-hoc-AG „Extremsituation“ entschieden,
in begrenztem Maße bis max. 0,8 Kubikmeter pro Sekunde Wasser aus dem sächsischen Spreegebiet in das Flussgebiet der Schwarzen Elster überzuleiten….
..Dadurch soll die Stützung des Abflusses der Schwarzen Elster im Raum Senftenberg in Höhe von 0,5 Kubikmeter pro Sekunde sowie des Einzugsgebiets Greifenhainer Fließ (Spreegebiet) weiterhin ermöglicht werden…
…Die nächste Sitzung der Ad-hoc AG findet am 1. August 2022 statt. Im Rahmen dieser Sitzung werden die aktuellen Maßnahmen bewertet und bei Bedarf angepasst oder erweitert… pm/sts
Quelle: zitiert aus Wochenkurie OSL,19.07.2022
Ausführlich unter:
Wenn Niederschlag allein nicht mehr reicht

Bild: Patrick Pleul/dpa
Klimawandel mit hohen Temperaturen und wenig Niederschlägen lässt den Grundwasserspiegel in Brandenburg mächtig absinken. Eine Forscherin schlägt nun Gegenmaßnahmen vor. In Nord- und Mitteleuropa gehört Deutschland neben Frankreich, Spanien und Italien zu den Ländern, die seit 1980 am stärksten von Wetter- und klimabedingten Extremereignissen betroffen sind. Experten erwarten im Zuge des Klimawandels eine weitere Zunahme an Häufigkeit und Intensität an solchen Ereignissen, besonders in den Bereichen Starkregen, Hochwasser und Dürreperioden. Brandenburg gehört dabei zu den Gebieten mit dem höchsten Dürrerisiko in Deutschland.
Wie sieht die Zukunft der Wasserversorgung aus?
….Auch wenn das Jahr 2021 mehr Niederschlag brachte, so sinkt der Grundwasserspiegel in einigen Regionen Brandenburgs weiter….
Einfluss des Klimawandels sind hohe Temperaturen
….In Brandenburg wird zu wenig Grundwasser neugebildet, in Deutschland ist nur in Sachsen-Anhalt die Situation schlechter.
Die Ursache ist nicht nur der geringe Niederschlag. Es fehlt auch an natürlichen Wasserspeichern, die schnell große Mengen aufnehmen können…..
Was kann dem Grundwasserspiegel helfen?
….Besonders problematisch ist der schnelle Wechsel zwischen Perioden ohne Niederschlag und Starkregenereignissen.
Da der Boden das Wasser in so kurzer Zeit nicht aufnehmen kann, fließt es in die Gewässer ab und kann das Grundwasser nicht auffüllen.
Nötig wären oberirdische Zwischenspeicher, um den Starkregen später dann in das Grundwasser einzuspeisen. …
...Irina Engelhardt plädiert auch dafür, über das Einspeisen von gereinigtem Abwasser an geeigneten Stellen nachzudenken,
um es dann für die Landwirtschaft zu nutzen. In Israel und Spanien wird so etwas schon seit längerem praktiziert.
In Israel beispielsweise wird 90 Prozent des Abwassers recycelt und für die Landwirtschaft wiederverwendet.
Dafür müssten die Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden, die Arzneimittel und Chemikalien aus dem Abwasser filtert.
Auch eine ständige Überwachung wäre nötig….
.
…Auch Wetter- und Klimavorrausagen sollen verbessert werden, um beispielsweise Landwirten bei Dürregefahr Bewässerungsempfehlungen an die Hand zu geben.
Die Vorwarnzeit soll dabei auf drei bis sechs Monate gesteigert werden…
Konkurrenz um Wasserreserven wird steigen
…Der größte Wasserverbraucher in Brandenburg ist
die
Industrie, der Hauptanteil fällt dabei auf den Bergbau mit 40 Prozent
und
die Energieversorgung mit 25 Prozent des Gesamtwasserverbrauchs.
Die
Landwirtschaft verbraucht nur 2 Prozent des Wassers in Brandenburg….
…Im Projekt "Spreewasser:N" arbeiten Behörden, Industrie, Landwirtschafts-, Naturschutz- und Wasserverbände zusammen mit der Wissenschaft daran,
ein solches Wasserbewirtschaftungs-konzept am Beispiel der unteren Spree zu entwickeln….
Trinkwasserversorgung hat Priorität
…Um diese Maßnahmen zu steuern ist ein Konzept notwendig, das analysiert wie das gesamte System des Wassers auf Wetter, Klimaveränderungen,
Änderungen im Verhalten der Konsumenten und Anforderungen der Industrie und der Umwelt reagiert,
die Ergebnisse bewertet und die Nutzungsinteressen gegeneinander
abwägt, das sogenannte integrierte Wasserressourcenmanagement.
Es
geht darum festzustellen, gibt es bestimmte Kipppunkte, an denen das gesamte
System gefährdet ist und wie soll man darauf reagieren? …
Doch was passiert, wenn das Wasser nicht mehr für alle ausreicht?
…Wassersparen bei den Endverbrauchern allein würde das Problem nicht lösen, auch wenn die Gartenbewässerung sicherlich noch Einsparungspotenzial verspricht.
Brandenburg hat jetzt schon den zweitniedrigsten
Prokopfwasserverbrauch Deutschlands….
Die
Trinkwasserversorgung hat (sicher) erste Priorität.
Was dann folgt, ob Landwirtschaft, Industrie, Tourismus oder Naturschutz, wird eine politische Entscheidung sein,
die von Region zu Region unterschiedlich
ausfallen kann….
Andreas Heins
Quelle: zitiert aus Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 07.06.2022,
19:30 Uhr
Ausführlich unter:
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/06/brandenburg-grundwasser-trinkwasser-duerre.html
Cottbus ruft zu sparsamen Umgang mit Wasser
auf
Dazu hat die untere Wasserbehörde der Stadt Cottbus verschiedene Tipps und Verhaltens regeln zusammengefasst.
Durch eine umsichtige Verwendung der Ressource Wasser kann jeder einen
Beitrag zum Erhalt des Wasserhaushaltes leisten.
Bewährte Maßnahmen zum Wasser sparen sind u.a.:
Es sollten im heimischen Garten oder auf dem Balkon nur wenig durstige, auskömmliche Bepflanzungen,
vorzugsweise solche aus heimischen Sträuchern, Stauden und Bäumen gepflanzt
werden.
Die Anlage von großflächigen Intensiv-Rasenflächen sollte vermieden werden, weil diese oft die Errichtung von privaten Brauchwasserbrunnen
nach sich zieht und so die bereits in Mitleidenschaft gezogenen
Grundwasservorräte beansprucht werden.
Wo möglich, sollten Bodenwasser- und Grundwasservorräte durch Versickerung
des auf befestigten Flächen oder Dachflächen anfallenden
Niederschlagswassers aufgefüllt werden.
Um die Wasserverluste durch Verdunstung so gering wie möglich zu halten,
sollte die Bewässerung nach 21 Uhr oder in den frühen Morgenstunden
erfolgen.
Eine Schicht aus Rindenmulch oder Häckselgut aus dem eigenen Garten oder
klein gehäckseltem Rasenschnitt in Staudenbeeten oder unter Bäumen hält die
Feuchtigkeit.
Das Auffangen von Regenwasser kann für einen Vorrat in den wärmsten Monaten
sorgen, um den Verbrauch von Trink-, Grund- und Oberflächenwasser weiter zu
verringern.
Das Gießen von Pflanzen sollte selten und kräftig erfolgen, da dies den
Boden nachhaltiger und tiefer wässert als häufiges und weniges Gießen.
Weitere Infos/ Fragen an:
Untere Wasserbehörde, 0355/6122755,
umweltamt@cottbus.de
Quelle: Wochenkurier CBSpw, 01.06.2022
Wasser für den Landschaftspark - Wie der Branitzer Park dem Klimawandel trotzen kann
Der Tagebau war einst Fluch für den Branitzer Park und ist heute sein Segen. Denn kein anderer Park in Deutschland ist so eingehend untersucht worden.
Hilft das, dem Klimawandel zu trotzen?

Der
Branitzer Park ohne Wasser ist undenkbar.
© Foto: ©Michael Helbig
Um das Wohl des Branitzer Parks haben sich nicht nur ein Fürst, Landschaftsarchitekten, Gärtner und Botaniker sowie Denkmalspflege gekümmert, sondern auch Hydrologen, Wasserwirtschaftler, Bodenkundler, Geologen und Bergleute. Denn einst sollte der Bergbau bis auf 200 Meter an die grüne Oase von Cottbus heranrücken. Sie musste geschützt werden. Alle Kraft floss in diese Aufgabe. Dann kam das Jahr 1990 und der Tagebau Cottbus-Süd war mit einem Mal passé. Heute können die Gartenschützer nicht nur auf einen großen Wissensfundus zurückgreifen, sondern auch auf lange Datenreihen. All das hilft, um den Park fit für den Klimawandel zu machen.
Ingolf Arnold ist einer der vielen Fachleute, die sich seit Jahrzehnten um
den Schutz des Branitzer Parks bemühen. Er ist 28 Jahre alt, als er Teil des
Expertenklubs wird… Er verdeutlicht: Sein ganzes Berufsleben hat sich der
Cottbuser mit um die Geschicke des Parks gekümmert. Heute mit 67 Jahre teilt
er sein Fachwissen noch immer.

Der
Hydrologe Ingolf Arnold blättert in den gesammelten Akten der einstigen
Expertenrunde, die den Park vor den Auswirkungen des nahenden Tagebau
schützen sollten.
© Foto: Peggy Kompalla
Schon Fürst Pückler erkannte das Wasserproblem im
Branitzer Park
Zuletzt ist Ingolf Arnold Chef-Geologe beim Energieunternehmen Vattenfall
gewesen, das heute unter Leag
firmiert. Dort plant er maßgeblich die Entstehung des Ostsees. Im Ruhestand
führt er das Wasser-Cluster-Lausitz an. Das ist ein
Netzwerk von
Wissenschaftlern und Praktikern,
die die Region im Strukturwandel mit ihrem Wissen um die Wasserwirtschaft
begleiten. Ingolf Arnold ist studierter Bergmann und Fachingenieur für
Grundwasser und durch besagten Expertenklub ein ausgesprochener Kenner des
Branitzer Parks.
…Denn schon Ende des 19. Jahrhunderts ist dem Fürsten klar, dass er das
Wasser, so lange wie nur möglich im Park halten muss. Dafür lässt er im
Kernpark ein Grabensystem anlegen, alle Teiche miteinander verbinden, um auf
diese Weise die Frischwasserzufuhr zu garantieren und um den Außenpark einen
Graben und Wall errichten, die niedergehenden Starkregen auf dem Grundbesitz
zurückhalten….
Seit den 1980er-Jahren sichert ein Spree-Zuleiter die
Wasserzufuhr
Trotzdem …litten die Gewässer im Branitzer Park allzu oft unter dem
schwankenden Grundwasserspiegel. …
…Abhilfe kommt erst mehr als 100 Jahre später. Weil der Tagebau dem Park das Wasser abzugraben droht, entwickeln die Fachleute in den 1980er-Jahren Schutzmaßnahmen. Dafür werden die Pückler’schen Gräben um ein Ringgrabensystem ergänzt und ein Wasserzuleiter von der Spree gebaut. Das garantiert dem Branitzer Park seither eine kontinuierliche Wasserzufuhr…
Die Spree wird in Zukunft deutlich weniger Wasser führen
…. Denn auch der Fluss wird sich verändern…. Der Fluss, so betont es der
Hydrologe, habe
in den vergangenen
70 Jahren mehr Wasser geführt
als natürlich….
….„Das Problem ist nur, dass wir Menschen uns daran gewöhnt haben.“ Hinzu kommen die veränderten Niederschläge und die höhere Verdunstung.
Wasser wird
also durch den Klimawandel und das Ende des Bergbaus erneut ein knappes Gut
für den Park….
….Ingolf Arnold: „Es sind hydrologische Untersuchungen nötig, um herauszufinden, was der Park verträgt. Mit welchem Minimum an Wasserbedarf kommt er zurecht?“
Dafür können die Fachleute nicht nur auf mehrere
Grundwassermesstellen im Park zurückgreifen, die in den 1980er-Jahren
errichtet wurden. Sondern auch auf lange Datenreihen der vergangenen
Jahrzehnte…..
Das Wassermanagement im Park muss angepasst werden
…Zudem müsse, so betont es der Fachmann, rechtssicher mit den Wasserbehörden
geklärt werden, dass der Branitzer Park als Gartendenkmal Wasser aus der
Spree erhält…..
….Für den Wasserfachmann, Parkkenner und -liebhaber ist klar, dass dieses Projekt in den nächsten vier Jahren umgesetzt werden sollte.
„Das ist
ambitioniert, aber wichtig.“…
….Mit der Baumuniversistät, die sich sogar zu einem großen Forschungs- und Laborprojekt auswachsen wird,
müssen die Botaniker, Gärtner und Landschaftsarchitekten resiliente Pflanzen heranziehen, die mit dem veränderten Klima zurechtkommen…..
Wie sich der Niederschlag verändert
Nach Auskunft des Hydrologen Ingolf Arnold wird sich in den nächsten
Jahrzehnten die Niederschlagsmenge in der Lausitz nicht verändern.
…. „Es wird beim Jahresmittel von 560 Millimeter im Jahr bleiben“, erklärt er und fragt: „Was wird anders?“
Durch die steigenden Temperaturen und Hitzeperioden werde deutlich mehr Wasser verdunsten. „Früher ist reichlich ein Drittel des Niederschlags verdunstet.
Heute gehen wir schon in Richtung 50 Prozent.“…
…Der Niederschlag werde zudem episodisch fallen. Landregen werde extrem
selten….
Peggy Kompalla
Quelle: zitiert aus lr-online, 28.05.2022
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/wasser-fuer-den-landschaftspark-wie-der-branitzer-park-dem-klimawandel-trotzen-kann-64633963.html
Anm.:
Es
gibt auch Erfolge bei der Reinigung des Spreewassers von Eisenhydroxid
Branitzer Park ohne Not-Rohr
Umwelt - Die blaue Leitung zum Schutz von Pücklers Erbe wird abgebaut.
Cottbus. Eine pücklerblaue Rettungsleitung schlängelte sich seit dem Jahr 2014 durch den Branitzer Park und wird nun abgebaut.
Sie sollte das Parkdenkmal vor einer Verunreinigung mit braunem Spreewasser schützen.
Über die Rohrleitung wäre der Park in einem solchen Fall mit Frischwasser
versorgt worden.
Doch dieser Notfallplan musste nie in Kraft treten. Mittlerweile wird die
Spree an der Talsperre Spremberg erfolgreich von ihrer Eisenlast befreit.pk
Quelle: Lausitzer Rundschau, 24.06.2022
Wassernot: Angler retten Fische aus Schwarzer
Elster
Senftenberg. Weil die Schwarze Elster wegen des fehlenden Regens und der hohen Temperaturen immer mehr austrocknet,
haben Angler aus Senftenberg und Umgebung die erste Rettungsaktion für
Fische in diesem Jahr gestartet.
Bei Großkoschen holten sie etwa 30 Kilogramm Fisch aus dem Wasser.
Die Tiere wurden zunächst mit einem Elektrofischfanggerät betäubt, mit einem Kescher eingesammelt
und schließlich an der Elsterbrücke zwischen Brieske und Niemtsch wieder ins Wasser gesetzt.
Weitere Notabfischungen sind geplant.
sey/jag
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 18.06.2022
Potsdam. Den Fischen geht es in Brandenburg trotz Hitze und Verdunstung laut Landesfischereiverband dort gut, wo es zusammenhängende Gewässer gibt.
Der Pegelstand in der Havel bei Potsdam liege knapp unter Mittelwasser. … Wo
die Wasserstände ausreichten, sei die Situation nicht problematisch.
…Es gebe aber auch abgetrennte Gewässer wie Seen, die keinen Zufluss haben
und am Grundwasser hängen…
…Am Elsensee bei Grünheide ist das Wasser nach Angaben von Dettmann (Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes) um etwa 1,5 Meter gesunken.
Die Ufervegetation mit Schilfgürtel sei dort mittlerweile völlig entkoppelt vom Wasser. …Grund ist …, dass mit dem Wasser trockene Flächen an Land versorgt wurden….

Vor allem Seen in Brandenburg haben immer weniger Wasser. Das beeinflusst
auch die Fische.
Anm.:
Das Foto ist nur symbolisch
und zeigt kkeineswegs einen
Brandenburger See
…Der Ertrag des Fischers wächst im Uferbereich Auch die Artenvielfalt sei
dort besonders hoch….
…Dass Fische in Brandenburg aufgrund hoher Temperaturen und sinkender Wasserstände massenhaft sterben,
müsse aber nicht befürchtet werden, sagte
Dettmann….
…….Die Laichzeit sei von allen Arten wie Barsch, Plötze, Schlei oder Blei gut überstanden worden.
Die meisten Fischarten hätten inzwischen abgelaicht. …
….Brandenburg verfügt mit Seen und Flüssen über insgesamt 998
Quadratkilometer Wasserfläche…
dpa
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 17.06.2022
Das Wasser in der Mark wird immer knapper -
das zeigt die neue Warnampel des Landes.
Experten suchen dringend nach Helfern mit
Ideen.
…Ampeln gibt es schon längst nicht mehr nur im
Straßenverkehr.
Seit März (2022) hat das Wasser in Brandenburg ebenfalls eine Ampel. Dieses Warnsystem hat das Klimaschutzministerium eingeführt.
Es ist Teil des Landesniedrigwasserkonzepts, das nach den extremen
Trockenperioden zwischen 2018 und 2020 vom Land erarbeitet wurde.
Die Niedrigwasserampel soll der Bevölkerung
kommunizieren, wie akut die Lage ist…
….14 von insgesamt 26 Pegeln der
Ampel stehen in der gesamten Mark aktuell auf Rot - das
heißt, es herrscht eine problematische Niedrigwasser-Situation.
Fünf sind gelb
und sechs immerhin auf grün.
Ein Pegel im Westen Berlins liefert momentan
nicht ausreichend Daten (???)Das Symbol für das austrocknende Brandenburg: Der schwindende Straussee in Strausberg ist ein
Politikum geworden, jedoch nicht der einzige See, der zu verschwinden droht.

22.000 Maßnahmen für Gewässerschutz
damit sie wieder in einen guten Zustand gebracht werden.
Das berichtete die Abteilungsleiterin im Umweltministerium, Anke Herrmann,
im Umweltausschuss des Landtags.
…Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie gibt vor, bis 2027 alle Gewässer und das Grundwasser in einen guten ökologischen Zustand zu bringen.
…Die Umsetzung ist ihr zufolge in diesem Zeitraum
nicht zu schaffen….
...Zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes in Brandenburg sollen ab dem kommenden Jahr bis 2027 jährlich zehn Millionen Euro investiert werden.
Im Gesamtkonzept geht es
auch um Niedrigwasser sowie das Oberflächenwasser samt der Situation beim
Grundwasser.
Aktuell laufen landesweit 93 Vorhaben…Es ist das erste Mal in Brandenburg, dass es ein Gesamtkonzept für die Wasserwirtschaft gibt.
Damit könne definiert werden,
welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig getroffen werden müssten,
Im Gesamtkonzept sind eine Handlungsstrategie und ein Vorsorge-Maßnahmenplan verankert, um auf extremes Niedrigwasser zu reagieren.
Der Blick richtet
Zudem gehe es um den ökologischen Zustand der Gewässer, um Hochwasser- und Moorschutz.
Außerdem sucht eine Arbeitsgruppe für das östliche Berliner Umland gemeinsam mit kommunalen Akteurinnen und Akteuren
nach nachhaltigen Lösungen für die Wasserver- und entsorgung in dieser Region. dpa
Reaktion auf Wassermangel
(Frühjahr/Sommer 2022)
Potsdam. Angesichts anhaltender Trockenheit hat
Brandenburgs Umweltministerium mit der Umsetzung des
Niedrigwasser-Konzeptes für 16 Flussgebiete im Land begonnen.
Nach extremem Niedrigwasser im Sommer 2019 und 2020
seien 50 Maßnahmen zur Vorsorge und zum Management von Wassermangel
festgelegt worden, teilte das Ministerium mit.
Ziel sei es, die Entwässerung von Flächen zu minimieren sowie die Entnahme
von Wasser zu erfassen und anzupassen.
dpa
Quelle: Lausitzer Rundschau, 20.05.2022
Wasserkonzept für Brandenburg erstellt Ampel für Flüsse
Brandenburg gehört zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Das
Land will mit dem Thema Wasser grundlegend neu umgehen und hat dazu ein
umfangreiches Konzept erarbeitet.
Brandenburg will mit zahlreichen Maßnahmen auf die Klimaveränderungen und den damit einhergehenden Wassermangel reagieren.
Dazu hat das Umweltministerium ein Gesamtkonzept erarbeitet, dass am Dienstag (01.03.2022) im Kabinett vorgestellt wurde.
…Grundlage bildet ein nach den Dürrejahren 2021 erstelltes Konzept, in dem eine Handlungsstrategie
und ein Vorsorge-Maßnahmenplan verankert sind, um auf extremes Niedrigwasser
zu reagieren…
...Ein Team von Ingenieuren soll in den 16 Flussgebieten des Landes die Umsetzung der Pläne in den nächsten fünf Jahren fachlich begleiten und steuern.
Eine so genannte Niedrigwasserampel, ein Pegelsystem zur Kontrolle, ging
dazu am Dienstag online….
…Das Konzept umfasst …den Blick auf die natürlichen Wasserressourcen und das Grundwasser,
aber auch Bergbaufolgen und der Wasserhaushalt Lausitz werden einbezogen -
genauso wir der ökologische Zustand der Gewässer, Hochwasserschutz und
Moorschutz….
…Neben dem Niedrigwasserkonzept sucht eine Arbeitsgruppe Wasserperspektiven östliches Berliner Umland
gemeinsam mit kommunalen Akteurinnen und Akteuren an nachhaltigen Lösungen
für die Wasserver- und -entsorgung….
«Wegen durchlässiger Sandböden, die Wasser nicht halten können, sowie hoher Verdunstungsraten reagiert
der brandenburgische Wasserhaushalt sehr schnell auf Niederschlagsdefizite», erklärte Umweltminister Axel Vogel (Grüne)
Anm.:
Herr Vogel erklärt „Wasser in Brandenburg“.
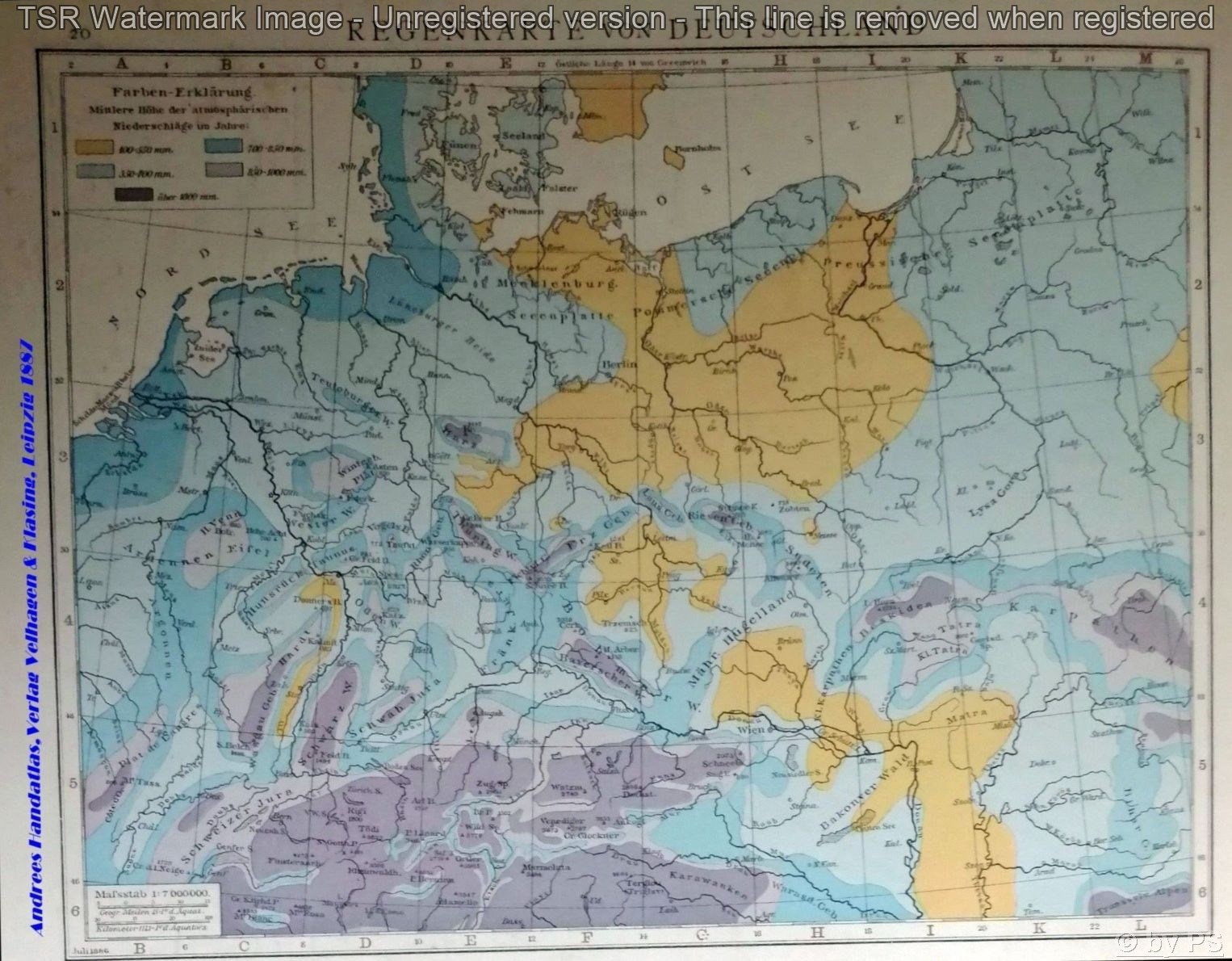 Auf der Abbildung „Regenkarte von Deutschland“
Auf der Abbildung „Regenkarte von Deutschland“
Auf der Karte ist deutlich die Niederschlagshöhe für die Region Brandenburg mit etwa 400 bis 550 mm (gelb eingefärbt) zu erkennen,
damit gehörte die Region Brandenburg zu den trockensten Gebieten Deutschlands.Quelle: Andrees Handatlas, Verlag Velhagen & Klasing, Leipzig 1887
Durch die sich zuspitzende Klimakrise werde sich diese Entwicklung noch weiter fortsetzen.
Zugleich würden Wetterextreme wie Hochwasser- und Starkregenereignisse nach den Prognosen häufiger auftreten. dpa
Anm.:
Man sollte eine Anwendung des Konjunktivs tunlichst unterlassen, solange
keine gesicherten Ergebnisse vorliegen.
Quelle: zitiert aus STERN, 01.03.2022
Wassermangel in Brandenburg - Wie viel Wasser hat die Region zwischen Berlin und der Grenze künftig noch?
Grundwasserspiegel fällt, der Spree droht das Wasser auszugehen. Womit müssen Brandenburger, Landwirte, Industrie rechnen?
Das heißt das für die Versorgung von Berlin? Forscher suchen nach Antworten
– auch in der Region um Grünheide, wo Tesla baut.
Wenn das Wasser schwindet: Ein Bild des Straussees aus dem Dürrejahr 2018. Der
See hat in den vergangen zwölf Jahren acht Prozent seiner Wassermassen
verloren. Als Auslöser wird vor allem der Klimawandel gesehen. Die genauen
Ursachen sind aber noch nicht erforscht. Viele Strausberger sorgen sich um
ihren See. © Foto: Martin Stralau
…Um drei bis vier Zentimeter fällt der Spiegel des Grundwassers in
Brandenburg pro Jahr…. Seit den 1990er-Jahren lässt sich das beobachten.
wie es
um die Wasserressourcen in Brandenburg bestellt ist - und wie sie klug
gemanagt werden können.
"SpreeWasser:N" (N steht für nachhaltig) heißt ein Forschungsprojekt, an dem acht Forschungseinrichtungen
und zwei mittelständische Unternehmen beteiligt sind….
... Drei Jahre lang werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Daten sammeln, auswerten, Empfehlungen ableiten.
Es geht darum, wie sich eine Region an extreme Klimaereignisse wie Dürren oder Starkregen anpassen kann,
wie mit der Ressource Wasser umgegangen wird….
Untere Spree ist Modellregion
Untersucht wird das Einzugsgebiet der Unteren Spree:
Es reicht vom Schwielochsee bis zum Großen Müggelsee und vom östlihen
Berliner Rand bis zur Stadtgrenze von Frankfurt (Oder).
Die Spree ist für die Wasserversorgung von Berlin zentral - die Stadt fördert den überwiegenden Teil ihres Trinkwassers
aus dem
unmittelbaren Uferbereich von Spree und Havel über sogenannte
Uferfiltration. Das heißt, es besteht zu erheblichen Teilen aus
Flusswasser….
…Aber auch die Flüsse führen weniger Wasser. Am Ausgang des Spreewaldes,
bei Leibsch, werden seit 2018 in den Sommermonaten deutlich zu niedrige
Wasserstände gemessen.
Das liegt nicht nur am Klimawandel,
sondern vor allem daran, dass weniger Wasser aus den Tagebauen der Lausitz
in die Spree geleitet wird….
…Kohleausstieg und Klimawandel könnten bewirken, dass die Spree bis 2050 deutlich Wasser verliert.
Die Wissenschaftler des Fachbereichs Hydrogeologie der TU Berlin gehen davon aus,
dass die Spree dann am Pegel
Große Tränke bei Fürstenwalde - wo die Müggelspree Richtung Berlin fließt -
im Mittel bis zu einem Viertel weniger Wasser führt als heute...
…In Brandenburg bilden sich im langjährigen Mittel (1991 bis 2010) nur 82 Millimeter Grundwasser im Jahr neu.
Das ist im Vergleich der Bundesländer der vorletzte Platz vor Sachsen-Anhalt.
Noch erheblich weniger. Grundwasser
entsteht im Einzugsgebiet Grünheide: Dort ist es fast nur die Hälfte - 40
bis 50 Millimeter jährlich. …
Idee sind Entsalzungsanlagen
…Es fehlen aus Sicht der Wissenschaftler im Gebiet der Unteren Spree aber auch Datensätze etwa zur Wassermenge in Oberflächengewässern
oder auch zum Volumen des Grundwassers, seiner chemischen Zusammensetzung, seiner jahreszeitlichen Veränderung und Nutzung….Anm.:
sowie Untersuchungen zur Grundwasserneubildung für das Gebiet Neu Zittau vorliegen.
Man muss das „Fahrrad“ nicht noch einmal erfinden. …
...Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen aber auch Empfehlungen geben, wie sich Grundwasser effizient bewirtschaften lässt.
Um die Neubildung von Grundwasser zu verbessern, könnte man Regenwasser auffangen und dann über Brunnen in den Grundwasserleiter injizieren.
Eine
andere Möglichkeit ist, Wasser aus Kläranlagen so aufzubereiten, dass man
es für die Landwirtschaft nutzen oder zur Grundwasserneubildung versickern
lassen kann….
Auch Entsalzungsanlagen sind möglicherweise eine
Option für Brandenburg. Damit könnte versalzenes Grundwasser aus großer
Tiefe aufbereitet werden…. Ina Matthes
Quelle: zitiert MOZ online, 14. 01.2022
Ausführlich unter:
Wir sind immer stark im Projekte verhindern
Leser-Diskussion
Auf dem Elbe-Überleiter liegen Hoffnungen der bergbaugeschädigten Lausitz, um die Wassernot zu beheben. Die aktuell genannten Baukosten verwundern aber. Zudem haben Bund und Land Zeit vertrödelt.
Ein
Elbe-Überleiter ist aber auch kein Allheilmittel.
Wasser aus der Elbe soll helfen: Auf dem Elbe-Überleiter lie gen große Hoffnungen der Lausitz, um die Wassernot zu beheben und die Bergbaufolgelandschaft sicher gestalten zu können.
Das haben wir im Beitrag "Elbewasser für die Lausitz" am 22. November (2021) beschrieben. Dazu gibt es Wortmeldungen, auch vom Förderverein Wasser-Cluster- Lausitz.
Situation
lange bekannt
Mit Interesse habe ich den Beitrag gelesen. Man könnte meinen, es wäre ganz neu, Wasser aus der Elbe für die Lausitz zu nutzen.
Dem ist aber nicht so, denn im Mai 1995 habe ich im Rahmen der Bundesgartenschau (Buga) an lässlich der Eröffnung des Messe- und Kongresszentrums zu
Wasser in der Lausitz gesprochen und darauf hingewiesen, dass mit dem Auslaufen des Braunkohlebergbaus die Spree und die Schwarze Elster Wasser aus dem Elbeflussgebiet benötigen.
Das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit der hydrologischen Situation in der Lausitz nach dem großflächigen Grundwasserent zu tun.
25 Jahre hatte die Politik Zeit, darauf zu reagieren, aber es ist nichts geschehen.
Vor nunmehr 14 Jahren hat die BTU Cottbus unter Leitung von Prof. Grünewald eine Studie zur Elbewasserüberleitung erarbeitet, aber Handeln: Fehlanzeige.
Mit Erstaunen habe ich auf einer Seite zwei Summen für mögliche Kosten des Projektes gelesen: Einmal drei Millionen Euro und dann drei Milliarden Euro.
Was stimmt denn nun? (drei Milliarden Euro, d. Red.) In der genannten Studie der BTU waren es noch nicht einmal 500 Millionen Euro.

Die Spree wird
durch eisen- und sulfathaltige Verbindungen, die aus der verletzten Erde
durch den Kohlebergbau massiv ausgeschwemmt werden, extrem belastet..
Die Lausitz hofft mit dem Gutachten des Umweltbundesamtes "Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohlenausstiegs in der Lausitz" auf entschei dende Argumente für den Bau eines Überleiters, der künftig Wasser aus der Elbe zur Schwarzen Elster in die Spree führen soll. Foto: Peter Radke/LMBV
Noch mehr
erstaunt hat mich die Aussage des BUND (Bund Umwelt und Naturschutz), dass
die Mittlere Elbe (Wörlitz- Dessauer Gartenreich und das Biosphärenreservat
Flusslandschaft Elbe)
durch die Entnahme von maximal fünf Kubikmeter Wasser pro Sekunde im Raum Bad Schan dau gefährdet wird.
Man muss wissen, die Elbe im Raum Bad Schandau weist einen mittleren Abfluss von 311 Kubikmeter pro Sekunde und in Höhe Dessau von 363 Kubikmeter pro Sekunde auf.
Hier zeigt sich, wie stark wir im Verhindern von sinnvollen Pro jekten durch selbsternannte Ex perten und wie handlungsunfähig unsere Bundes- und Landesregie rungen seit 25 Jahren sind.
Wenn ich an Deutschland denke, fallen mir nur Heinrich Heine und Albert Einstein ein. Helmut Ziehe, Vetschau
Anm.: Herr Ziehe
war als Projektingenieur im IEK
Cottbus tätig
Kosten
versechsfacht
Richtig ist, dass beim Kohleausstieg die Lausitz, aber auch Berlin neue Lösungen für den Wasserhaushalt brauchen.
Dies ist bei den dafür Verantwortlichen in der Bundesregierung und den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Sachsen angekommen.
Man arbeitet intensiv und vor allem sorgfältig daran. Die Aufgabe ist zu groß und zu komplex, als dass man mal an der einen oder anderen Schraube nur zu drehen braucht.
Im LR-Beitrag wird vom "Berg bauexperten" (wer vergibt solche Titel?) Martin Socher aus Dresden die Elbewasserüberleitung mit drei Milliarden Euro als die allheilbringende Lösung dargestellt.
Vor wenigen Jahren sprach Prof. Socher in Veranstaltungen von nur 500 Millionen Euro, der Faktor 6 lässt aufhorchen.
Anm.:
Zur Person: Prof. Dr. rer. nat. Marin Solcher:
Herr Prof. Dr. Martin Socher arbeitet als Referatsleiter Oberflächenwasser, Hochwasserschutz im SMUL (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft)
Herr Prof. Solcher nimmt
eine Honorarprofessur an der Hochschule für Wissenschaft und Technik (HTW)
Dresden mit dem Berufungsgebiet „Umwelt-Verfahrenstechnik in der
Wasserwirtschaft“ wahr.
Evtl. Publikationen auf
dem Gebiet der Wasserbewirtschaftung sind nicht auffindbar.
In Quelle:
https://www.meinprof.de/uni/prof/52601/publikationen
ist zu lesen:
Zitat Anfang
Veröffentlichungen von Prof. Martin Socher/font>
Dieser Dozent hat noch keine Publikationen eingetragen.
Zitat Ende
Die Bezeichnung „Experte“ ist gesetzlich oder anderweitig /font> nicht geschützt.
Mit einem überzeugenden Selbstbewusstsein kann man sich dann schon mal selbst als „Bergbauexperte“ bezeichnen.
....Es geht aber
zunächst um die Machbarkeit, und da freut uns Lausitzer, dass die Tschechen
angeblich schon Einigkeit zum Anzapfen der Elbe gegeben haben.
Das verwundert nicht, denn als Oberlieger ist es denen egal, was unterhalb passiert.
Und da passiert sehr viel, auch die Elbeanrainer-Länder bis hin zur Hamburger Hafenbehörde sind wegen des Klimawandels auf jeden Tropfen Elbe-Wasser angewiesen.
Von daher heißt es erstmal, Hausauf gaben in den Flussgebieten von Neiße, Spree und Schwarzer Elster zu machen und zu prüfen,
was da noch geht. Und da kann, zumindest in dosierter Form, der Ansatz der Grünen, die noch entstehenden Seeflächen zu verklei nern, Teil der Gesamtlösung sein.
Ob dabei ein schnelles Ende der Tagebaue, wie 1990 praktiziert, zielführend ist oder das planmäßige Beenden Chancen bietet, sollte offen ausdiskutiert werden.
Es bleibt spannend, viele Wasser- und Bergbauexperten arbeiten gegenwärtig intensiv an Lösungen.
Gedulden müssen
wir uns trotzdem noch einige Jahre, bis entscheidungs- und damit
finanzierungsfähige Lösungspakete vorliegen.
Als einigermaßen mit dem Wasserfach bewanderter Lausitzer hebe ich jedoch war nend den Finger, weiterhin die El bewasserüberleitung als Allheil mittel zu propagieren, dies schafft nur falsche Erwartungen.
Die Lausitzer sind von jeher ein hartes Leben gewöhnt und Lö sungen wurden immer gefunden. In diesen Lösungen wird die Spree sich jedoch ihr natürliches Kleid wieder anziehen, welches dünner und schmaler sein wird als es heute ist,
sagt Ingolf
Arnold, Cottbus
Quelle: Lausitzer
Rundschau, 27.11.2021
Zur Person: Dipl. Ing.
Ingolf Arnold
Studium
-
Diplom-Studium an der Bergakademie Freiberg am Lehrstuhl Bohrtechnik und Fluidbergbau
-
Fachingenieur für Grundwasser an der Technischen Universität Dresden
Tätigkeiten
-
seit 1994 im aktiven Lausitzer Bergbau verantwortlich für das Fachgebiet Wasserwirtschaft
-
seit 2004 zusätzlich verantwortlich für die Fachgebiete Lagerstättengeologie und Bodenmechanik
-
bis 2020 Leitung der Abteilung Geotechnik der Lausitz Energie Bergbau AG
-
seit 2020 im Ruhestand
Kompetenzen
-
Aufbau großräumiger hydrogeologischer Modelle bereits vor 1990
-
grenzüberschreitendes hydrogeologisches Modell zur Republik Polen
-
Grundwasserschutz im Tagebauumfeld
-
UUnterstützung von Bergbauunternehmen in Fernost und in Südosteuropa insbesondere im Wassermanagement für Tagebaugebiete
Wasserverlust am Pinnower See
Debatte Die Anwohner des Pinnower Sees wehren sich gegen den Vorwurf, mitverantwortlich für den weiter absinkenden Wasserstand zu sein. Das Umweltamt überrascht mit neuen Erkenntnissen.

Seit Mai 2019 leitet die Leag Wasser in den See. Die Messlatte zeigt, dass selbst hier der versprochenene Wasserstand noch immer nicht erreicht ist.
Die Anwohner am Pinnower See sind frustriert. Noch im Mai 2019 hatten sie applaudiert, als der Bergbaubetreiber Leag mit der Einleitung von zusätzlichem Wasser in den See begann. Doch die Anfangseuphorie ist längst vorbei. Denn der Wasserstand sinkt weiter.
Infolge des Wasserverlustes ist das Gewässer mittlerweile dreigeteilt. Den Steg vor seinem Haus hat er bereits zweimal versetzt, jetzt steht er schon wieder auf dem Trockenen…..
….Besonders verärgert sind die Anwohner über Aussagen, dass sie nicht ganz unschuldig am Zustand des See seien. Schließlich entnehmen sie ebenfalls Grundwasser. Das sei hochgerechnet schon eine ganze Menge, wie sich Sebastian Fritze, Präsident des Brandenburger Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe im März 2021 äußerte…..
Anwohner-Verbrauch marginal
….Das will Andreas Stahlberg so nicht stehen lassen. Der Kreistagsabgeordnete und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Schenkendöbern hat nachgerechnet.
Er kommt auf einen Jahresverbrauch von 35 Kubikmeter Wasser pro Grundstück. Bei 390 Grundstücken, die nicht ans Trinkwassernetz angeschlossen sind,
ergibt das einen Jahresgesamtverbrauch von 13.650 Kubikmetern….
Das entspricht der Wassermenge, die die Leag an acht Tagen in den See einleitet….
…Anders ausgedrückt: Auf die Seefläche berechnet sind das 3,1 Millimeter Höhe. Dem Pinnower See fehlen jedoch 1,4 Meter Wasser, was der Jahreseinspeisung von 1728 Kubikmetern entspricht…..
Tagebau als Ursache?
….Eine Mitverantwortung des Bergbaus am Wasserverlust der Seen in der Region hatte das Landesbergamt bereits 2018 eingeräumt und in der Folge den Bergbaubetreiber verpflichtet, Wasser in die betroffenen Seen einzuleiten, bis der Stabilisierungsstand erreicht ist. Damit wurde ursprünglich im Frühjahr 2021 gerechnet. Das Ziel ist verfehlt.
….Von einem Misserfolg will Leag-Sprecher Thoralf Schirmer nicht sprechen. Die zusätzlichen Wassereinleitungen haben nach Ansicht des Unternehmens dem Pinnower See sehr wohl geholfen, ohne sie wäre der Wasserstand vermutlich noch mehr gesunken. Den massiven Wasserverlust seit 2019 kann sich der Bergbaubetreiber nicht erklären. Die Ursachenforschung sei Aufgabe der Behörde, nicht der Leag….
Neuer Bericht im August (2021)
….Tatsächlich haben sich das Landesumwelt- und das Landesbergamt bereits mit dem Thema intensiv beschäftigt. Ein Bericht mit den aktuellen Ergebnissen soll im August 2021 veröffentlicht werden…
….Eigenen Angaben zufolge hatten die Behörden im Jahr 2018 nicht den gleichen Kenntnisstand wie heute. Deshalb konnte der klimatische Einfluss auf den Pinnower See damals auch nicht in Gänze bewertet werden….
…Die …durch die Trockenheit ….in weiten Teilen des Landes Brandenburg abgesenkten Grundwasserstände würden bis heute vollumfänglich auch auf den Pinnower See wirken….
Einleitmengen auf Prüfstand
….Diese Erkenntnis hat Auswirkungen auf das weitere Vorgehen. Grundwasser ist mittlerweile ein kostbares Gut in Brandenburg….
….Aus Sicht der Behörde muss perspektivisch die Anpassung des Zielwasserstands auf den Prüfstand gestellt werden….
…Ohne weitere Wassereinspeisung befürchtet Grünen-Bundestagsabgeordnete Heide Schinowski ein Austrocknen des See. Die Jänschwalderin fordert, dass die Einleitung von Grubenwasser aus dem zwölf Kilometer entfernten Tagebau Jänschwalde geprüft wird. Noch wird das Wasser zur Kühlung des Kraftwerkes genutzt. Doch durch die schrittweise Abschaltung der Blöcke sinkt der Bedarf…. Silke Halpick
Quelle: zitiert aus https://epaper.lr-online.de/lausitzer_rundschau/wcos/2021-07-10/4/wasserverlust-im-pinnower-see-57876819.html
https://www.dwd.de/DE/leistungen/bilanzgutachten/download/verdunstung_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Die Lausitz leidet trotz Regen weiter unter Niedrigwasser
Trockenheit Die Lage in den Seen und den Flüssen im Süden Brandenburgs bleibt angespannt. Es darf weiterhin kein Wasser entnommen werden.
…Trotz einiger Regenfälle in den vergangenen Tagen (Anm.: vom 05.07.-07.07.2021) bleibt die Niedrigwassersituation im Süden Brandenburgs angespannt.
Die unteren Wasserbehörden bitten die Bevölkerung daher, auch weiterhin sparsam mit dem Grund- und Trinkwasser umzugehen.
Gleichzeitig blieben die Allgemeinverfügungen mehrerer Landkreise und der Stadt Cottbus zum Entnahmeverbot von Wasser aus Oberflächengewässern
wie Flüssen, Seen, Bächen oder Gräben am Freitag (09.07.2021) bestehen.
…Helge Albert von der Wasserbehörde in Dahme-Spreewald erklärt, dass für die Verbote weniger die Wasserstände als vielmehr die Durchflüsse relevant seien.
In den meisten Wasserläufen und Seen im Spreesystem werde das Wasser über Wehr und Stauanlagen zurückgestaut; somit sei die Niedrigwassersituation nicht überall sichtbar….
….Die Durchflüsse durch die Wasserläufe und Seen lägen jedoch unter den Schwellenwerten; die Wasserqualität und Lebewesen in den Gewässern seien gefährdet.
Wann die Entnahmeverbote wieder aufgehoben werden, ist bislang unklar….Harriet Stürmer
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 10.07.2021
Anm.:
Die Niederschläge Anfang Junli 2021 haben das Schlimmste verhindert
Wasserstände der Flüsse steigen leicht
Brandenburg Der Regen der vergangenen Tage (Woche 26 vom 30.06.-01.07.2021) führt zu Entspannung auch an der Spree und Schwarzer Elster.
Potsdam. Die Niederschläge der vergangenen Tage haben sowohl im Norden als auch im Süden Brandenburgs für etwas Entspannung der schwierigen Wassersituation in den Gewässern gesorgt - insgesamt war der Juni (2021) aber sehr trocken. Das geht laut brandenburgischem Umweltministerium aus Erhebungen des Landesamtes für Umwelt (LU) hervor. In den letzten beiden Tagen fiel demnach ein flächendeckender, langanhaltender, zeitweise starker Niederschlag
mit über 50 Litern pro Quadratmeter….
….Die höchsten Niederschlagssummen wurden im Nordosten von Brandenburg erreicht. "Spitzenreiter" war den Angaben zufolge die Station Angermünde (Uckermark) mit 169 Litern pro Quadratmeter.
Das entspricht den Angaben des LfU zufolge fast dem dreifachen Normalwert für den Monat Juni, der bei 59 Litern pro Quadratmeter liegt….
…Ein erfreulicher Effekt der Niederschläge: Die Wasserstände der Flüsse stiegen landesweit wieder …
…Hochwasser an den großen Flüssen Elbe und Oder und auch an der Havel wird nicht erwartet. Auch die Spree führt nach Angaben des Landesumweltamtes bis einschließlich des Spreewaldes kein Hochwasser. Nördlich davon - vor den Toren Berlins - zeigt die Müggelsptee erhöhte, jedoch unkritische Wasserstände….
…Die Pulsitz in der Lausitz und die Stepenitz in der Prignitz zeigen eine erhöhte Wasserführung. Für beide Flüsse gebe es eine Hochwasser-Warnung. ….
...Für die Schwarze Elster im Süden, die in den vergangenen Jahren durch die Trockenheit teilweise gar kein Wasser führte, sorgen die starken Niederschläge für eine Entspannung der Wassersituation. dpa/bl
Quelle: zitiert aus LR, 05.07.2021
Das Niedrigwasserkonzept für Brandenburg - Top oder Flop
"Uns läuft das Wasser weg
Was tun, wenn die Pegel der märkischen Gewässer und der oberftächennahen Grundwasserleiter fallen? Das Land Brandenburg legte
für Vorsorge und Management von Niedrigwasser im Februar ein Konzept vor. Die WASSER ZEITUNG fragte in einer besonders betroffenen Region nach, wie hilfreich das Dokument ist: im Landkreis Elbe-Elster.
…In den 70ern wurde der Fluss verbreitert, begradigt, und die Verschmutzung durch anliegende Gerbereien, mangelhafte Kläranlagen und Kohlegrubenabwasser wuchs… Die Kleine Elster verwandelte sich in einen stinkenden Fluss….
…Die Wasserqualität verbesserte sich erst nach der Wende, als die Schadeinträge ausblieben. Zudem bepflanzte der Heimatverein Maasdorf e. V das Südufer mit 4.000 schattenspendenden Bäumen und Sträuchern. Artenvielfalt kehrte zurück…
…Ebenso hilfreich: das Wiederanschließen von 13 Altarmschleifen zu Beginn der 2000er Jahre…
Ein Meter Pegel ist verschwunden
…Die Schwarze Elster - heute schnurgerader Weg, früher durch die Landschaft
mäandernd.
Die Untere Spree ist eine Modellregion - Erkenntnisse sollen auf ähnliche Gebiete übertragbar sein
Aber: Mit dem Aus der Braunkohle-Tagebaue fließen auch die Ableitungen von Sümpfungswässern
über die Schwarze Elster in die Elbe, wofür die Profile ursprünglich kanalartig ausgebaut wurden. Für die Abflüsse im
Mittelwasserbereich sind die Profile viel zu breit, was bei Niedrigwasser schlimme Folgen hat….
….Ganz abgesehen davon senkte der niedrige Wasserspiegel in den letzten Trockenjahren die obere Grundwasserleiter stark ab…Die Folge: Ertragsausfälle in der Landwirtschaft und flächendeckendes Waldsterben….
Wasserfragen "zusammendenken"
Wenn im Niedrigwasserkonzept nun gefordert wird, man müsse Wasser in der Region halten, reiben sich viele Menschen in Südbrandenburg verwundert die
Jetzt handeln, weil die Zeit drängt
Die Landesregierung räumt es im Niedrigwasserkonzept selbst ein: Der enthaltene Arbeitsplan richtet sich vorrangig an die Landesverwaltung.
…Da ist von "prüfen" und "anpassen" die Rede, von erforderlichen Maßnahmen, Dinge seien zu verbessern. Passiv-Sätze statt Aktiv-Pläne. Doch die Zeit, wirksam gegen die Effekte des Klimawandels vorzugehen, läuft den engagierten Ehrenamtlern davon….
… Alles noch zu (noch) zu theoretisch. …Es fehlen konkrete Maßnahmen…
Quelle: zitiert aus Lausitzer Wasserzeitung, Juni 2021
Wasserstopp in Cottbus
Cottbus (MB). Um ein zu starkes Absinken der Gewässerpegel im Stadtgebiet (Anm.: eine merkwürdige Ausdrucksweise) während des Sommers (2021) zu verhindern,
hat die Cottbuser Stadtverwaltung als untere Wasserbehörde per Allgemeinverfügung ein Wasserentnahmeverbot aus allen Oberflächengewässern des Stadtgebietes
in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erlassen. rink
Quelle: Märkischer Bote, 25.06.2021
Gigafactory Grünheide - ein Beweis dafür, dass es in Brandenburg keine Niedrigwassersituation geben darf
Tesla will 500 Millionen Batterien pro Jahr in Grünheide produzieren
Seit (Freitag, 18.06.2021) 0.20 Uhr sind sie öffentlich - die neuen Antragsunterlagen für die Gigafactory in Grünheide und die neue Batteriefabrik.
Tesla will Wasser sparen und
weniger Wald roden, braucht aber mehr Strom und mehr Lkw.

30.05.2021, Brandenburg, Grünheide: Das Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin (Luftaufnahme mit einer Drohne).
Nach Angaben von Tesla soll die Produktion und Auslieferung der ersten Fahrzeuge hier doch erst Ende 2021 beginnen.
Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk
+++ © Foto: Patrick Pleul
Es ist die bisher umfangreichste Präsentation – 12.000 Seiten.
Davon rund die Hälfte mit neuen Daten zum Bau der Autofabrik.
Sie sind online bereits verfügbar.Tesla ändert das Design seiner Autofabrik – erweitert einzelne Bereiche,
fügt neue Produktionsschritte an und reduziert
andere….
Die Batteriefabrik braucht deutlich weniger Platz als herkömmliche Batteriezell-Produktionen. Die Halle für die Batteriezellfabrik ist viel kleiner als die Gigafactory.
Tesla will runde Zellen bauen, ähnlich groß wie eine Batterie für eine
Taschenlampe.
Anders als bei herkömmlichen Verfahren soll keine feuchte Paste auf die
Folien für Anode und Kathode aufgetragen werden, sondern ein Pulver…..
Größere Fabrik in Grünheide – und was ist mit dem Wasserverbrauch?
…Die Produktion dieser Trockenzellen spart Wasser. So soll der Verbrauch im Rahmen dessen bleiben, was bereits für die Gigafactory vertraglich gesichert ist –
bis zu 1,4 Millionen Kubikmeter im Jahr, den Verbrauch einer mittleren Stadt mit 40.000 Einwohnern.
Dazu dürfte auch beitragen, dass der Elektroautobauer an einigen Stellen in der Gigafactory den Verbrauch reduziert hat
zum Beispiel durch sparsamere Kühltürme oder die
Wiederverwendung von Wasser.
Tesla wird eine eigene Abwasserbehandlungsanlage auf dem Gelände betreiben.
Dort sollen Schadstoffe wie Metallionen, Öle oder Beschichtungsharze aus der Lackiererei aus dem Wasser entfernt werden,
bevor das Wasser zur
öffentlichen Kläranlage in Münchehofe fließt….
Mehr Regenwasser soll auf dem Tesla-Gelände versickern
….Das Regenwasser soll jetzt statt in einem zentralen in vier verteilten Becken versickert werden.
Damit reagiert Tesla auf eine Forderung der Kritiker nach einer verbesserten Regenwasserversickerung auf dem Gelände.
Dadurch soll die Neubildung von Grundwasser einem Klimagutachten zufolge höher liegen als sie es zuvor unter dem Kiefernwald war.
Außerdem sollen alle unterirdischen Leitungen jetzt oberhalb des Grundwasserleiters verlegt werden – auch damit soll offenkundig
auf Kritik aus dem öffentlichen Erörterungsverfahren im September in Erkner
reagiert werden….
Die Gigafactory in Grünheide besteht aus zehn Anlagen
…. Deshalb wird dieser Gebäudeteil Presswerk, dessen Seitenwände noch offen sind, deutlich erweitert.
Für die schweren Gussmaschinen braucht Tesla Pfahlfundamente – 1180 Pfähle sollen in den Boden gerammt werden.
Der
vorhandene Teil des Presswerkes ruht bereits auf mehr als 550 Pfählen….
….Diese Pfahlgründungen sind umstritten. Dagegen hatte es erheblichen Widerstand gegeben.
Kritiker befürchten eine Veränderung der Fließrichtung des Grundwassers und das Vordringen von salzhaltigem Wasser aus der Tiefe ins Grundwasser.
Nach den Darstellungen in den Unterlagen sollen die Veränderungen der Grundwasserströme gering sein.
Es wird demnach in einem engeren Umkreis um wenige Millimeter abgesenkt bzw. aufgestaut.
Die
Einzugsgebiete der Brunnen des Wasserwerkes in Erkner würden sich dadurch
nicht verändern….
Beim Karrosseriebau spart Tesla ein
…Insgesamt steigt den Unterlagen zufolge die Fertigungstiefe in der Fabrik. Das kostet mehr Energie.
Den Erdgasverbrauch zur Wärmegewinnung will der Autobauer demnach kaum steigern – um etwa ein Prozent.
Der Stromverbrauch steigt um rund 20 Prozent auf 87 MW. Auch der Lkw-Verkehr soll um knapp 20 Prozent zunehmen –
von rund 1273 Lkw auf etwas mehr als 1515 Lkw am Tag.
Die Lkw sollen vor allem über die neue temporäre Autobahnauffahrt auf das Gelände kommen. Sie ist zur Hälfte fertig gebaut.
An dieser Auffahrt sind
jetzt zusätzliche Wendeflächen geplant. Erwartet wird eine Entlastung der
Landesstraße L38….
…Tesla will auch etwas weniger
Wald
roden, als ursprünglich vorgesehen – statt 194 Hektar rund 161 Hektar….
Quelle: zitiert aus lr-online, 18. 06. 2021
Wassermangel in Brandenburg Wassermangel und Sommertemperaturen bringen Spree ans Limit
Fehlender Regen und die ersten sommerlichen Temperaturen haben zum Rückgang des Wassers in der Spree geführt.
Deshalb hat das Landesumweltamt Brandenburg Schritte eingeleitet um den Wasserstand in der Spree zu stützen.

Sinkende Pegel der Spree sind auch bei Leibsch (Dahme-Spreewald) registriert worden. © Foto: Jens Golombek
….Ausbleibende Niederschläge und die ersten sommerlichen Temperaturen
in diesem Jahr hätten zum Rückgang des Wassers in der Spree geführt.
Eine schnelle Entspannung der meteorologisch-hydrologischen Verhältnisse sei derzeit nicht in Sicht….
…Das LfU hat im Vorgriff auf das Niedrigwasserkonzept für die mittlere Spree in Absprache mit den Landkreisen erste Schritte eingeleitet, um die Wasserführung der Spree zu stützen. So wird laut Umweltamt vor allem die Ableitung in andere Gedwässer reduziert….
…Die Speicher in Sachsen sind zur Zeit noch gut gefüllt, aber an der Talsperre Spremberg wurde die Abgabe zur Stützung des Spreegebietes auf aktuell 9,9 Kubikmeter pro Sekunde erhöht.
…Der Beckenwasserstand sinkt aktuell um drei Zentimeter pro Tag. Auch die sächsischen Speicher hätten begonnen, den Wasserstand des Flusses zu stützen….
Gestiegene Temperaturen und wenig Niederschlag sorgen für Wassermangel in der Spree
…Grund …sind die gestiegenen Temperaturen seit vergangener Woche und fehlende Niederschläge.
Seit Junibeginn (2021) sind nach Angaben des Landesumweltamtes lediglich 0,2 Liter Regen pro Quadratmeter in Cottbus gefallen.
Der durchschnittliche Niederschlagswert in der Stadt liegt im Juni bei 50 Liter pro Quadratmeter….
…Auch im Oberlauf der Spree fiel in dieser Zeit kaum Regen. Für die kommenden 14 Tage sind zudem keine Niederschläge in der gesamten Lausitz vorhergesagt….
…Trotz Abgabenerhöhung der Talsperre Spremberg konnte der Abfluss am Pegel Leibsch UP nicht mehr gehalten werden.
Aufgrund der sommerlichen Temperaturen und der aufblühenden Vegetation, vor allem im Spreewald,
stieg die Verdunstung deutlich an….
…In Leibsch, einem Ortsteil der Gemeinde Unterspreewald (Dahme-Spreewald),
fließt derzeit mit 3,46 Kubikmetern pro Sekunde (Stand 09. 06.2021) weniger als die Hälfte
der zu dieser Jahreszeit sonst üblichen Wassermenge der Spree in Richtung Berlin… red/uf
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 10.06.2021
Ausführlich unter:
Millionen fürs Moor
K!ima-Projekt Land (Brandenburg)
unterstützt Bauern bei der Bewirtschaftung.
Potsdam. Brandenburg will mehr für den Schutz der Moore unternehmen. Expertenteams beraten Landwirtschaftsbetriebe bei der Bewirtschaftung von Mooren,
um möglichst viel Wasser im Boden zu halten, teilte das Ministerium am
Donnerstag (06.05.2021)
mit.
…7,2 Millionen Euro aus dem Zukunftsinvestitionsfonds des Landes stehen für das sogenannte Klima-Moorprojekt zur Verfügung.
Es startete bereits im Vorjahr (2020)
und soll bis 2026 laufen….
…Moore wurden und werden bis heute vielerorts
entwässert, um auf den Flächen Landwirtschaft zu betreiben…
….Die negativen Folgen für Umwelt, Klima und
Wasserhaushalt sind groß, der Schaden für Gewässer und Boden unumkehrbar….
…Das Umweltministerium (Brandenburg) erarbeitet zur Zeit ein Moorschutzprogramm, um Moore besser vor der Austrocknung zu schützen.
Brandenburg
ist eines der moorreichsten Bundesländer Deutschlands....
dpa
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 07.05.2021
Anm. zum folgenden Beitrag:
So kann Wasser (in diesem Fall: Abwasser) landwirtschaftlich genutzt und in der Landschaft zurückgehalten werden.
Diese Sache ist zwar ein "alter Hut", das lernt jeder Wasserbaustudent während seines Studiums,
aber es ist immer wieder erfreulich, dass man sich wieder an alte Praktiken erinnert.
Brandenburg
Sorge wegen Niedrigwasser
Potsdam. Sinkender Grundwasserspiegel und Niedrigwasser: Die Auswirkungen sind an den Brandenburger Gewässern deutlich zu spüren.
Nach Daten des Brandenburger Landesamtes für Umwelt weisen 15 von 79 Seen, die größer als 50 Hektar sind und bei denen Wasserstände gemessen werden,
außergewöhnlich hohe Rückgänge auf, wie rbb24 am Freitag (16.04.2021) berichtete.
Der Wasserstand sank danach in den vergangenen zehn Jahren um mehr als zwei Zentimeter pro Jahr.
Mit einem Niedrigwasserkonzept hat das Umwelt- und Klimaschutzministerium im Februar (2021) einen Maßnahmenplan vorgelegt. dpa/pb
Quelle: Lausitzer Rundschau, 17.04.2021
Klärwerk-Wasser auf Lausitzer Felder? (siehe auch "wasserallgemein.html "auf dieser Homepage)
Landwirtschaft Egon Rattei, Ex-Chef der Forster Agrargenossenschaft blickt auf den jüngsten Wassergipfel und den Strukturwandel

Forst. Die Landwirtschaft lässt Egon Rattei auch im Ruhestand nicht los.
"Gerade jetzt, wo in der Region wichtige Weichen gestellt werden, müssen wir uns ein stärkeres Gehör verschaffen",
erklärt der studierte Agraringenieur aus Naundorf in der Nähe von Forst.
…Seitdem nutzt er jede Gelegenheit, um auf die Probleme der Landwirte aufmerksam zu machen….
…So hat Rattei sehr aufmerksam den jüngsten Wassergipfel in Cottbus verfolgt.
Dort diskutierten Experten zum Beispiel darüber, wie stabil die Flusslandschaft der Spree nach dem Ausstieg aus der Braunkohle ist
und ob auch in Zukunft die Menschen in der Region ausreichend mit Wasser versorgt werden könnten. Die Landwirtschaft sei dabei viel zu kurz gekommen….
…Rattei nennt konkrete Beispiele: "Warum muss zum Beispiel das nach EU-Norm geklärte teure Abwasser aus der Forster Kläranlage in die Neiße abgeleitet werden.
Dabei könnten wir es in der Region halten, damit es hier für die Landwirtschaft verfügbar ist." Das wäre für ihn ein Ansatz für ein Strukturwandelprojekt….
…Laut Umweltbundesamt ist Deutschland grundsätzlich ein wasserreiches Land.
Allerdings würden nur 12,8 Prozent des hier zur Verfügung stehenden Wasserdargebots von 188 Milliarden Kubikmetern genutzt….
….Für die landwirtschaftliche Bewässerung werden davon nur rund 1,3 Prozent und damit 0,3 Milliarden Kubikmeter der Gesamtwasserentnahmen verwendet (Stand: 2016).
Aufgrund klimatischer Veränderungen…könne sich der Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft regional allerdings erhöhen und die Grundwasserneubildung übersteigen….
…Eine Studie zeigt, dass in Deutschland auch in Anbetracht des Klimawandels kein flächendeckender Bedarf für zusätzliche Bewässerung besteht.
Nur in wenigen Fällen würde die Zusatzbewässerung mit aufbereitetem Abwasser wirtschaftliche und ökologische Vorteile haben….
…So sieht es auch Egon Rattei.... "Eine Bewässerung muss zumindest auf Vorzugsflächen erfolgen, das muss ich nicht unbedingt auf 1000 Hektar machen"....
…Ohnehin würden die Bauern in der Region schon auf die zunehmende Trockenheit reagieren… Es wird auf den Anbau angepasster Pflanzen wie Luzerne verwiesen…
…Auf diese Futterpflanze setzt zum Beispiel Bernd Starick, Vorstand der Bauern AG Neißetal. Das hänge mit dem hohen Eiweißgehalt zusammen,
aber vor allem mit der großen Toleranz gegenüber der Trockenheit. So hole sich die Pflanze das benötigte Wasser bis aus drei Meter Tiefe….
…Reagiert haben die Lausitzer Landwirte auch mit dem Agroforst-Projekt. Dabei handelt es sich um bepflanzte Schutzflächen am Rand von Feldern. …
Damit können Erosionen in Größenordnungen verhindert werden, Das sei ein Weg, den die Landwirtschaft weiterverfolgen müsse…
… Es wird eine enge Verzahnung mit der Forschung und Wissenschaft, zum Beispiel an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gefordert….
…. Die von Egon Rattei angesprochene Wasserwiederverwendung zur Bewässerung birgt laut Bundesumweltamt für die menschliche Gesundheit,
die Böden und das Grundwasser einige Risiken. Mit der konventionellen Abwasserbehandlung könnten viele Schadstoffe wie Rückstände von Arzneimitteln nicht vollständig abgebaut werden….
…Um Krankheitserreger und Schadstoffe aus dem Abwasser zu entfernen, sei daher eine zusätzliche Aufbereitung wichtig…. Hier wird ein Ansatz für ein Strukturwandelprojekt gesehen. Sven Hering
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 31.03.2021
Wetter in Sachsen Pro Quadratmeter fehlen 40 Eimer Wasser in Ostsachsen
In Sachsen hat sich ein extremes Wasserdefizit aufgebaut. Wegen dreier Trockenjahre in Folge dürsten Gewässer, Felder und Wälder. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Noch Ende September war der Kortitzmühler See aufgrund der Dürre komplett wasserfrei. Inzwischen hat sich im Restloch des Tagebaus Laubusch wieder eine ansehnliche Wasserlache gebildet. Im Hintergrund ist der Laubuscher Kirchturm zu sehen. © Foto: Torsten Richter-Zippack
…Pro Quadratmeter sind 400 Liter Wasser zu wenig gefallen. Aufsummiert hat sich diese gewaltige Menge in den drei Trockenjahren 2018 bis 2020,
informieren das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) des Freistaates sowie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig….
In Sachsen müsste es wochenlang durchregnen
….Würde noch die entsprechende Verdunstung eingerechnet, erhöhte sich das Defizit sogar auf 800 Liter je Quadratmeter, sagt Dr. Johannes Franke vom LfULG.
Der Grund: Ein anhaltend hohes Niveau von Temperatur und Sonnenstunden verstärkt die Wirkung des Niederschlagsdefizites durch den hohen Durst der Atmosphäre.
Diese übe eine Sogwirkung auf die Landfläche aus, so Franke weiter….
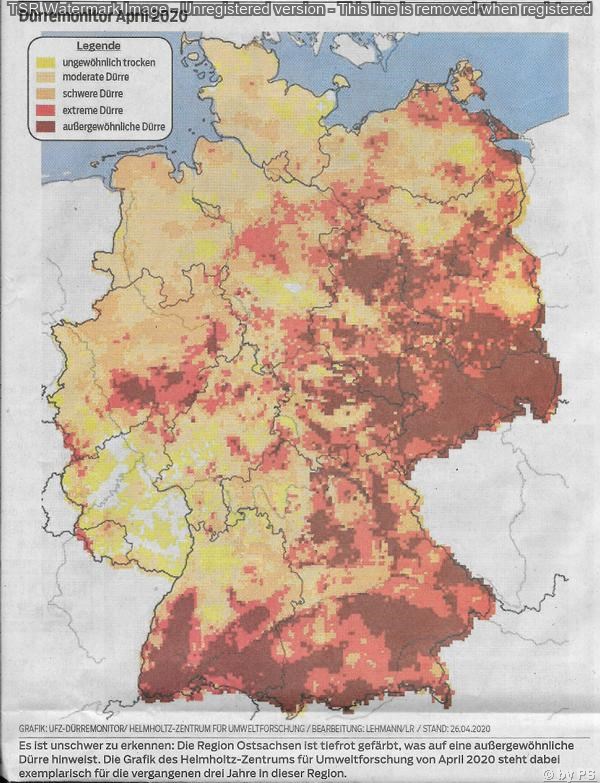
Temperaturen sind seit 2013 durchweg zu hoch
… Sämtliche 30 Jahreszeiten zwischen Sommer 2013 und Herbst 2020 waren wärmer als im langjährigen Mittel.
Sie bilden damit den längsten zusammenhängenden Abschnitt seit dem Jahr 1881 ab, der erhöhte Temperaturen aufweist….
Massive Schäden durch Spätfröste
…Durch den extrem zeitigen Vegetationsbeginn litten die Pflanzen im vergangenen Jahr massiv unter starken Spätfrösten.
So gab es größere Ertragsausfälle bei Äpfeln, Birnen und Kirschen, da die Blüten erfroren waren. Durch die starke Trockenheit kam es auch im Gemüsebau zu massiven Ertragsausfällen.
Diese konnten auch durch erhöhte Bewässerung nicht abgefangen werden…
….Größere Ertragsmengen als 2018 und 2019 gab es in manchen Regionen Sachsens hingegen bei Winterweizen und Gerste, Raps, Kartoffeln und Mais.
Ausgenommen davon war jedoch Nordsachsen, da dort kaum größere Niederschlagsmengen fielen….
…Die Waldschäden durch Wetterextreme als primäre Ursache sind landesweit unübersehbar…
…Die Niederschläge im Januar (2021) waren allerdings nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein….
Versorgung mit Trinkwasser ist immer gewährleistet
…Etwa 40 Prozent der sächsischen Einwohner erhalten ihr Trinkwasser aus aufbereitetem Talsperrenwasser.
Trotz der Dürreperioden in den vergangenen drei Jahren war die Versorgung mit dem lebenswichtigem Nass stets gewährleistet, informiert das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie….
….Allerdings konnten nicht sämtliche Stauseen komplett gefüllt werden. An einigen Talsperren wurde es notwendig, die Abgabe für die Trinkwasseraufbereitung zu drosseln.
Allerdings werden die meisten sächsischen Stauseen in einem Verbundsystem bewirtschaftet. Dabei kann Wasser zwischen Talsperren übergeleitet werden….. Torsten Richter-Zippack
Quelle: zitiert lr-online, 30.01.2021
Ausführlich unter:
Angedachter Elbe-Überleiter würde weitere Probleme nach sich ziehen
lifePR, Chemnitz, 22.10.20
Verschiedene Lausitzer Kommunalpolitiker hatten Mitte Oktober (2020) in einem Brief an die brandenburgische Landesregierung gefordert,
den Bau eines Elbe-Überleiters in einer Machbarkeitsstudie zu prüfen.
…Eine Überleitung von Elbewasser zur Stützung der Lausitzer Wasserverhältnisse ist aus Sicht der Landesverbände des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt keine geeignete Lösung… (Anm.: Was zu erwarten war…)
Anm.:
Die Überleitung von Elbwasser ist eine der vernünftigsten Initiativen, denn das aus der Elbe übergeleitete Wasser bleibt dem Großeinzugsbebiet der Elbe erhalten.
Zum besseren Verständnis: Die Einzugsgebiete der Spree und der Schwarzen Elster gehören zum Einzugsgebiet (besser: Stromgebiet) der Elbe.
… Nach Auffasung des BUND eine technische, teure und nur vermeintlich schnelle
Lösung wie der Elbe-Überleiter würde weitere negative ökologische Folgen nach
sich ziehen. Das Problem wird lediglich verlagert….
…Eine Überleitung von Wasser aus der Elbe verschärft dort nur die schon
herrschende Wasserknappheit und Trockenheit…
Anm.:
Die Behauptungen des BUND sind durch keine aussagekräftige Studie bestätigt worden
…Die geplante Studie des Umweltbundesamtes „Wasserwirtschaftliche Folgen des
Braunkohlenausstiegs in der Lausitz“ ist ein guter Schritt und begrüßenswert….
…Da auch die brandenburgische Regierung auf die Studie verwiesen hat, geht der BUND davon aus, dass bis Abschluss der Studie Ende 2022 keine planungsrechtlichen Tatsachen geschaffen werden –
weder beim Elbe-Überleiter noch bei der Größe der Tagebau-Restseen….

Hintergrund zur Wassersituation in der Lausitz
Die Restseen verdunsten besonders im Sommer, wenn die Wassersituation schon
angespannt ist, täglich Unmengen
(???) an Wasser, welches dann in der Spree fehlt.
Anm.:
Die offenen Wasserflächen verdunsten im mitteldeutschen Raum bis zu
600 mm (zum besseren Verständnis 60 cm) und nicht „Unmengen“
…Für den Zeitraum der Flutung muss das dafür notwendige Wasser den Flüssen entnommen werden……
Anm.:
Falls (noch) nicht bekannt:
Es gibt auch einen Grundwasserzufluss zu allen oberirdischen Gewässern…
…Vor allem in Dürrejahren, die mit dem Klimawandel häufiger werden, gibt es dafür keinen Spielraum.
Die Flutung des Cottbuser Ostsees, der einmal der größte künstliche See Deutschlands werden soll, musste 2019 nach wenigen Tagen aufgrund des fehlenden Spreewassers gestoppt werden
und konnte seitdem nur extrem begrenzt fortgeführt werden….
Quelle: zitiert aus lifepr.de, 22.10.2020
Ausführlich unter:
https://www.lifepr.de/inaktiv/bund-fuer-umwelt-und-naturschutz-deutschland-landesverband-sachsen-ev/BUND-Landesverbaende-fordern-Gesamtstrategie-zum-Wasserdefizit-in-der-Lausitz/boxid/820538
Anm.: Endlich war es 2020 so weit.....
Verbot endet für Entnahme von Wasser
Umwelt Nach Angaben der Kreisverwaltung Spree-Neiße haben ausgiebige Niederschläge die Lage entspannt.
Forst. Der Landkreis Spree-Neiße hebt das zeitlich beschränkte Verbot für private Wasserentnahmen aus der Spree und ihren Zuflüssen wieder auf.
…Die flächendeckenden Niederschläge am 13. und 14. Oktober (2020) hätten zu einer Entspannung der Niedrigwassersituation geführt, wird der 'Widerruf begründet….
…Mit dem Ende der Vegetationsperiode gehe auch der Bewässerungsbedarf zurück….
…Die Wasserentnahme per Pumpvorrichtung für den Eigentümer- und Anliegergebrauch sei ab dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung des Widerrufs (21.10.2020) wieder uneingeschränkt zulässig... red/pos
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 22.10.2020
Bürgermeister-Vision Elbwasser für die Lausitz im Gespräch
Das dritte Dürrejahr in Folge hat einen dramatischen Wassermangel in der Lausitz zur Folge. Flüsse, Seen und Teiche sind teilweise ausgetrocknet. Jetzt könnte Elbwasser für Abhilfe sorgen.

Aus der Elbe bei Mühlberg könnte künftig Wasser für das Lausitzer Seenland entnommen werden. © Foto: Frank Claus
Fast 160 Kilometer umfasst der ESO-Kanal. Die Elbe-Spree-Oder-Wasserstraße sollte bereits vor rund 100 Jahren errichtet werden.
Ihr Verlauf war von Mühlberg über Lauchhammer, Cottbus, Lieberose bis unweit von Frankfurt (Oder) vorgesehen. Neben allerlei wirtschaftlichen Aspekten hatten die visionären Planer ebenso den Hochwasserschutz vor Augen. Bei Lieberose war ein großes Rückhaltebecken vorgesehen.
Gebaut wurde der ESO aus verschiedensten Gründen bis heute nicht. Jetzt könnten aber Teile des Vorhabens realisiert werden. Denn mehrere Bürgermeister, Amtsdirektoren, der Landrat des Oberspreewald-Lausitz-Kreises sowie der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (LSB) haben in einem Brief das Land Brandenburg gebeten, eine Überleitung von Elbwasser ins Lausitzer Seenland auf ihre Machbarkeit zu prüfen.
Wenigstens die Verdunstung soll ausgeglichen werden
Der Großräschener Bürgermeister Thomas Zenker (SPD) ist einer der Initiatoren der Elbwasser-Vision….
… Der Großräschener See hat über einen Meter Wasser wegen der Verdunstung verloren….Daher konnte das Gewässer erneut nicht genutzt werden…
…Mit der Elbwasser-Überleitung könnte die Verdunstungsverluste ausgeglichen werden…. Letztlich gehe es nicht nur um das Lausitzer Seenland, sondern ebenso um die gesamte Spree einschließlich der Wasserversorgung Berlins….
…Wie konkret die Überleitung aussehen könnte, sei offen. Mit einem offenen Kanal rechnet Thomas Zenker indes nicht. Stattdessen setzt das Stadtoberhaupt
auf ein Rohrsystem von der Elbe zur Schwarzen Elster. Leitungen mit Durchmessern zwischen 400 und 500 Millimetern seien denkbar…
Klimawandel Seit 2018 verschärft Dürre den Lausitzer Wassernotstand
Cottbus/Senftenberg
Mehr Wasser für die Region fordern auch die Stadt Senftenberg, der Landkreis Oberspreewald-Lausitz sowie der Zweckverband LSB. …
…Überall im Gebiet mangelt es an Wasser. Aufgrund der seit dem Jahr 2018 anhaltenden Trockenheit ist unter anderem die Schwarze Elster zwischen Kleinkoschen und Buchwalde auf vier Kilometer trocken gefallen,
ebenso im Raum Geierswalde/Tätzschwitz. Am Elsterwehr in Biehlen wurden im laufenden Jahr stets Abflüsse von unter 0,5 Kubikmeter je Sekunde gemessen…

Nur noch ein Rinnsal war die Schwarze Elster über viele Wochen an der Geierswalder Kortitzmühle. © Foto: Torsten Richter-Zippack
Der Kortitzmühler See bei Laubusch hat so gut wie kein Wasser mehr, ebenso viele Teiche….
…Während der Sommermonate haben Wasserexperten und Touristiker gezittert, ob der Senftenberger See
den unteren Grenzwasserstand von 98,3 Metern über Normalnull unterschreitet. Das ist in diesem Jahr nicht geschehen. Daher konnte auf eine Sperrung des Gewässers während der Saison verzichtet werden….
Umweltamt gibt Gutachten in Auftrag
Dem Brandenburger Umweltministerium ist die Extremlage in der Lausitz bewusst.
In Abstimmung mit Berlin und Sachsen sowie den Bergbauunternehmen wird vom Umweltbundesamt das Forschungsgutachten
,Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohlenausstiegs in der Lausitz’ beauftragt. Dieses soll im Jahr 2022 vorliegen“, kündigt Ministeriumssprecher Sebastian Arnold an.
Die Experten erwarten Prognosen zu den Abflüssen in Spree und Schwarzer Elster unter Berücksichtigung des Bergbauausstiegs und des Klimawandels, ebenso entsprechende Handlungsempfehlungen. Inhalt sind potenzielle Wasserüberleitungen, beispielsweise der Elbe.
Bildergalerie Die Seen in der Lausitz
Durchaus Chancen für Elbwasser
Der Großräschener Bürgermeister Thomas Zenker räumt der Elbwasser-Überleitung in die Lausitz durchaus Chancen für die Realisierung ein.
„In den 1990er-Jahren haben auch nur die wenigsten an die Kanäle im Lausitzer Seenland geglaubt. Und heute sind sie für uns schon selbstverständlich.“
Letztendlich sei das Elbwasser erforderlich. Schließlich, so Zenker, brauchen auch die Investoren dauerhaft nutzbare Gewässer.
Denn wer in jeder Trockenheit wegen des Wassers zittern muss, habe schlechte Karten. Torsten Richter-Zippack
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 10.10.2020
Ausführlich unter:
Wassernotstand: So kämpft ein Landwirt aus Gahry gegen Trockenheit
Der trockene Sommer – der jetzt schon dritte in Folge – setzt den Landwirten ordentlich zu. Doch von Resignation ist bei ihnen keine Spur.
Stattdessen tüfteln sie an vielen neuen Ideen. Ein Beispiel aus Gahry.

In den Gräben an den von der Agrargenossenschaft Gahry bewirtschafteten Feldern gibt es derzeit zumindest etwas Wasser. Geschäftsführer Bernd Schäfer führt das auf die jüngsten Regenfälle zurück, die rund 50 Liter Niederschlag gebracht haben. © Foto: Sven Hering
…Das Wasser kam genau zur richtigen Zeit. Als es vor ein paar Tagen – nach einer erneut sehr langen Trockenperiode – mal wieder in der Forster Region geregnet hatte,
spürten die Landwirte die positiven Folgen schon ein paar Tage später. Vertrocknete Pflanzen hatten sich erholt, die Wiesen waren wieder grün….
Agrargenossenschaft Gahry holt Wasser aus 60 Metern Tiefe
Anm.:
Vielleicht kann sich einer der älteren Bauern noch an die Beregnungsanlagen auf den trockenen feldern zu Zeiten der DDR erinnern.
Es hat den Anschein, als ob alles neu erfunden werden muss
…Für Bernd Schäfer, Chef der Agrargenossenschaft Gahry, war das ein Glücksfall. „Wir haben keine Bewässerung für unsere Flächen“, verrät er.
… Das Landwirtschaftsunternehmen in Gahry kann auf Brunnen zurückgreifen…
… Der Chef der Agrargenossenschaft macht sich Gedanken darüber, wie künftig gewährleistet werden kann, dass die Futterflächen ausreichend mit Wasser versorgt werden können. …
Anm.: Das kann doch nicht wahr sein ….
Agrargenossenschaft Gahry denkt über Beregnungsanlage nach
Trockenheit ist für den Wald eine Katastrophe
…Noch deutlicher mache sich die Trockenheit im Wald bemerkbar, den die Genossenschaft ebenfalls bewirtschaftet…
…Der Verteilkampf um das knappe Gut Wasser hat längst begonnen. So verhängte der Landkreis im Sommer per Allgemeinverfügung für die Städte Spremberg und Drebkau,
die Gemeinden Neuhausen/Spree und Kolkwitz sowie die Ämter Peitz und Burg ein zeitlich beschränktes Wasserentnahmeverbot für private Wasserentnahmen aus der Spree und ihren Zuflüssen….
…Der Chef der Agrargenossenschaft Gahry hat diese Entwicklung verfolgt. „Ich bin aber überzeugt, dass wir auch künftig das Wasser aus unseren Brunnen nutzen können“, sagt er.
…Doch das ist für sein landwirtschaftliches Unternehmen mit einem großen Aufwand verbunden, da das Wasser eisenhaltig ist und nur mit viel Technik gefiltert werden kann…
Klimawandel wird auch in der Lausitz deutlich
Die Auswirkungen des Klimawandels seien da, sagt der Chef der Agrargenossenschaft Gahry ..
… und kommt zu der Feststellung…. „Es gibt trockene Jahre und es wird auch wieder nasse Jahre geben, in denen wir nicht wissen, wohin mit dem ganzen Wasser“…
…. Deshalb achte die Genossenschaft darauf, dass die Grabensysteme an den Feldern intakt seien. …
Anm.:
… und es werden auch dem weniger fachkundigem Leser Binsenweisheiten verraten
Sven Hering
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 23.09.2020
Ausführlich unter:
A propos: Heisse Sommer:
Anm.:
Das alles schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10.08.2003
Da war von Klimawandel und seinem Einfluss auf die Witterung, hier: trockenen Sommer noch keine Rede.
Heiße Sommer gab es schon oft
Auch wenn viele Deutsche sich nicht erinnern können, jemals zuvor so ausdauernd geschwitzt zu haben: Heiße Sommer sind hierzulande gar nicht so selten, schrieb Manfred Lindinger in der FAZ.
Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach, die die Temperaturen, Niederschläge und Sonnenscheindauer der vergangenen hundert Jahre erfasst haben, berichten,
dass es besonders "sonnige" Sommer bereits in den Jahren
1905, 1911, 1917, 1921, 1947, 1959, 1975, 1982, 1983 und 1992 gegeben.
Den heißesten Sommer gab es bisher 1947
Der Spitzenreiter ist bisher der Sommer des Jahres 1947, mit einer ungewöhnlichen Hitze und Trockenheit. Die Durchschnittstemperatur, gemittelt über die Monate Juni, Juli und August,
lag 2,2 Grad über dem für Sommermonate typischen mittleren Wert. Damals brachten es die Monate Juni, Juli und August auf die Durchschnittstagestemperaturen von 17,8, 18,9 und 18,9 Grad.
Zudem fielen kaum mehr als 60 Prozent der zu erwartenden Niederschlagsmenge.
Mittlere Temperatur erhöhte sich
Laut IPCC, dem Internationalen Klimabeirat, hat sich die mittlere Temperatur in den vergangenen hundert Jahren um 0,6 bis 0,8 Grad erhöht.
Ein besonders starker Anstieg ist seit den siebziger Jahren festzustellen. Die neunziger Jahre waren das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Messungen.
Um 0,3 Grad zum Beispiel ist die Tagesmitteltemperatur in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren angestiegen.
Nicht überbewerten
Die Meteorologen warnen jedoch davor, die Beschleunigung der Erwärmung als Indiz für eine drohende Klimakatastrophe zu werten.
Einzelne Wetterextreme wie die diesjährige Hitzeperiode oder die Jahrhundertflut 2002, so ist man sich einig, sind keine Beweise.
Die Summe über mehrere Sommer zeigt den anthropogenen Einfluß, den es unbestritten gibt. Doch wie stark der ist, auch darüber streiten die Gelehrten.
So wird von einigen Forschern für die kommenden hundert Jahren eine Erwärmung der Erdatmosphäre von 1,5 bis 6 Grad prognostiziert.
Die Folge
wären noch deutlicher wärmere Sommer, als wir sie derzeit erleben.
Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10.08.2003
Ausführlich unter:
Anm.:
Eine weitere Aufzählung von extremen Sommern…
„…Oft wird Meteorologen die Frage gestellt, ob Jahre mit besonders heißen oder kalten Sommern einem bestimmten Rhythmus folgen.
Leider (oder glücklicherweise?) ist jedoch das Klima und auch die Wettervorhersage nur sehr bedingt an so etwas wie "regelmäßiges Auftreten" gebunden.
Warme Sommer wie die in den Jahren 1905, 1911, 1917, 1947, 1959, 1975, 1982, 1983 und 1992 werden immer wieder
von kalten abgelöst.
Hierzu gehören die Jahre 1909, 1913, 1916, 1918, 1919, 1923, 1956, 1962, 1965, 1978, 1985 und 1987.
Eine Auffälligkeit in den Reihenfolgen ist nicht zu finden.
Übrigens liegen die besonders heftigen Abweichungen von einem "durchschnittlichen" Sommer in Europa meist schon etwas länger zurück:
Schon im Jahr 79 nach Christus herrschte in Italien extreme Hitze, die lange Trockenheit brachte. Im Jahre 886 war der Sommer dagegen so verregnet, aß der Rhein alle Länder verwüstete,
die von der Quelle bis zur Mündung an seinen Ufern lagen.
Die Anwohner anderer
europäischer Flüsse mussten mit ähnlichen Problemen kämpfen.
Das gegenteilige Extrem - einmal durch das Flußbett des Rheins zu waten und
dabei höchstens feuchte Knöchel zu bekommen - liegt inzwischen 612 Jahre
zurück….“
Quelle: zitiert aus
https://www.donnerwetter.de/ecke/specials/990623.htm
Trockenheit Der Kampf um das Lausitzer Wasser ist entbrannt ie Lausitz ist in Wassernot und wird dafür verklagt. Der Kampf um das Wasser ist entbrannt. Mit voller Härte zwischen Frankfurt (Oder) und Cottbus.
 Blick auf
das Einlaufbauwerk des Cottbuser Ostsees. Das Wasser soll zu etwa 80 Prozent aus
der Spree kommen, 20 Prozent werden aus dem Grundwasser bezogen. © Foto: Foto:
Michael Helbig
Blick auf
das Einlaufbauwerk des Cottbuser Ostsees. Das Wasser soll zu etwa 80 Prozent aus
der Spree kommen, 20 Prozent werden aus dem Grundwasser bezogen. © Foto: Foto:
Michael Helbig
…Lange Hitzeperioden ohne nennenswerte Niederschläge lassen den Wasserstand in der Spree extrem sinken.
…Die Stadt Frankfurt (Oder) und deren Wasserbetriebe ziehen Cottbus vor Gericht – wegen des Streits um das knappe Wasser….
Die zulässige Sulfatkonzentration in der Spree (mit 284 Milligramm pro Liter aktuell erneut eine höhere Sulfatlast gemessen worden als der Richtwert zulässt)
Anm.:
Nach meiner Kenntnis gibt es für fließende Gewässer keinen Sulfat-Grenzwert.
…Im Reinwasser des Wasserwerkes Briesen, das Frankfurt (Oder) versorgt, wird der Trinkwassergrenzwert von 250 Milligramm pro Liter zwar bisher eingehalten…
…Der Lausitzer Bergbautreibende Leag und die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) sollen aber dafür zahlen…
Die Sulfatlast in der Lausitzer Spree steigt bedenklich
…Zur Sicherung der Trinkwasserqualität in Frankfurt (Oder) haben das Brandenburger Umwelt- und das Wirtschaftsministerium im vergangenen Jahr einen Bewirtschaftungserlass für Sulfat verfügt.
Darin ist amtlich festgehalten, dass am Pegel Neubrück, maßgeblich für den Standort des Wasserwerkes Briesen, ein Immissionsrichtwert (IRW) für Sulfat von 280 Milligramm pro Liter einzuhalten ist….
…Ab der 38. Überschreitung im laufenden Jahr ist das Bergamt damit verpflichtet, mit den zuständigen Wasserbehörden und dem Gesundheitsamt wirksam gegenzusteuern….
Anm.:
Gesundheitsschädliche Auswirkungen bei einem Sulfatgehalt von mehr als 250 mg/l sind bis jetzt nirgends nachgewiesen. Im Gegenteil einige Heilwässer haben einen weitaus höheren Sulfatgehalt
Zu befürchten ist:
Andere Spreewasser-Nutzungen müssen zurücktreten. Damit wird wahrscheinlich Mühlen (mit Wassernutzungsrechten) das Wasser weiter abgegraben. Landwirte mit Wassernutzungsrechten für das Bewässern von Feldern zittern.
Und die Bergbaufolgeseen bekommen kein oder deutlich weniger frisches Wasser.
Bergbau füttert die Spree mit Wasser und wird dafür verklagt
…Dabei sorgt der aktive Bergbau in der Lausitz noch dafür, dass die Spree immer genug Wasser führt und die Spreewald-Fließe nicht austrocknen. Mit Sümpfungswässern aus den Tagebauen.
Denn die Talsperren Bautzen und Spremberg können aus den Winterniederschlägen längst nicht mehr genug Wasser speichern und übers Jahr abgeben, um den Spree-Pegel dauerhaft ausreichend zu stützen….
…Deshalb ist das Grubenwasser, das abgepumpt werden muss, um das Lausitzer Kohleflöz trockenzulegen und abbauen zu können, wertvoll. Es hat aber einen großen Makel:
Aus dem tief verwundeten Erdreich werden natürliche Eisen- und Schwefelkiese gelöst, die mit dem Luftsauerstoff zu stark eisen- und sulfathaltigen Verbindungen reagieren….
Das Wasser-Eilverfahren liegt derzeit auf Eis
…Der Wasser-Fall (sprich: Cottbuser Ostsee) liegt derzeit auf Eis, weil der Cottbuser Ostsee wegen der anhaltenden Trockenheit aktuell ohnehin nicht geflutet werden darf…
…In diesem Jahr hat die im Jahr 2015 stillgelegte und sanierte Kohlegrube nunmehr seit Ende März (2020) keinen einzigen Tropfen Spreewasser mehr zugeführt bekommen.
Das bestätigt die Flutungszentrale Lausitz, die Experten der LMBV in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) steuern….
Lausitzer Bergbau-Firmen verweigern die Kostenübernahme
…Derzeit wird das Trinkwasser in und um Frankfurt (Oder) zu 75 Prozent aus versickertem Spreewasser gewonnen. Nur durch technologisch aufwendige Verfahren gelingt es,
die angeschwemmten Bergbaureststoffe aus dem Wasser zu entfernen und unter den Richtwerten zu halten….
…Abhilfe soll die Sanierung des Wasserwerks in Müllrose (Oder-Spree) schaffen, um dort Grundwasser zu fördern. Etwa zehn Millionen Euro würde die Sanierung kosten. Die Frankfurter wollen erreichen, dass der Tagebaubetreiber Leag und der Bergbausanierer LMBV für einen Großteil der Kosten aufkommen müssen….
Die Lausitzer Energie Aktiengesellschaft (Leag) verweist auf detaillierte Gutachten, die belegten, dass sowohl die Flutung des Cottbuser Ostsees als auch die spätere Ausleitung von Seewasser
nicht zu einer Erhöhung des Sulfatgehaltes der Spree führen…
…Die Leag hat – noch bevor die Wasserwerke Klage eingereicht haben – zugesagt, sich an der Sanierung des Wasserwerkes Müllrose zu beteiligen…
Flutung des Cottbuser Ostsees noch im Zeitplan
…Wegen des Wassermangels darf zur Zeit kein Spreewasser in den Cottbuser Ostsee eingelassen werden. Jedoch dürfen bis zu 28 800 Kubikmeter Filterbrunnenwasser (also gehobenes Grubenwasser) pro Tag in den See eingeleitet werden, „um das hydraulische Gefälle zwischen Grundwasser und Seewasser auszugleichen…
…Der Füllstand betrage derzeit 42 Prozent. Der Wert beziehe sich auf die zu erreichende Wasserhöhe im Ostsee. „Die Flutung liegt weiterhin im Plan“, betont die Leag…
…Aktuell entspreche die Flutung dem mittleren bis trockenen Szenario. Ein Abschluss der Flutung sei weiterhin Mitte der 2020er-Jahre möglich...
…Der Ostsee soll einmal eine Wasserfläche von knapp 19 Quadratkilometern haben. Somit wird er größer als Schwieloch- und Scharmützelsee – und gut zweieinhalb Mal so groß wie der Große Müggelsee. …
Harriet Stürmer und Kathleen Weser
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 18.09.2020
Ausführlich unter:
Anm.:
Während ich diese Rubrik aktualisiere, hat sich die Lage im Wasserhaushalt der Lausitz durch die Niederschläge vom 30.08.2020
sicherlich etwas stabilisiert.
Wasser sparen für die Spree
Trockenheit Behörden kämpfen gegen zu niedrige Flusspegel. ,
Cottbus. Die Spree und ihre sächsischen Zuflüsse geraten immer weite::- unter Druck. Weil der Regen fehlt, ist der Wasserspiegel so weit gesunken, dass einzelne Flussabschnitte trockenfallen können.
Im Spreeald mussten viele Ableiter geschlossen werden.
…Die Talsperre Bautzen ist aktuell nur zur Hälfte gefüllt und damit so leer wie nie. Über die Zuflüsse ist Schätzungen zufolge ist lediglich ein Fünftel vom Normalwert für den Monat August in den Wasserspeicher geflossen.
Knappheit herrscht auch in den Speichern Quitzdorf und Bärwalde….
…Die Schwarze Elster hat bereits trockene Flecken. Ab Pegel Neuwiese - zwischen Hoyerswerda und Senftenberg - fließt der Fluss nicht mehr…
…Botschaft der betroffenen Länder Brandenburg und Sachsen sowie der Berliner Umweltsenat nun zusammenrücken: Wasser sparen!...
…Bei weiterer Trockenheit könnten ab Ende September (2020) die Abflüsse im Spreegebiet zum Erliegen kommen, haben Experten berechnet.
In Berlin ist bereits Mangel spürbar. Die Spree bringt immer weniger Wasser in die Hauptstadt…. (Anm.: Für TESLA ...???.)
…Berlins Umwelt-Staatssekretär Stefan Tidow: Für die Trinkwasserversorgung ist die Spree die wichtigste Versorgungsader. Die Versorgung ist noch nicht gefährdet.
Dennoch zeige die aktuelle Situation deutlich die Herausforderung….
…Der Zufluss aus Spree und Dahme in .Berlin ist aktuell mit vier Kubikmeter pro Sekunde sehr niedrig….
…Berlin arbeitet an einem Masterplan. Auch Brandenburg arbeitet zurzeit an einem Niedrigwasser- Konzept. Der Entwurf soll noch in diesem Jahr (2020) vorliegen, kündigte Umweltstaatssekretärin Silvia Bender an…. ckz
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 22.08.2020
Anm.:
Der geneigte Leser möchte sich bitte seine eigene Meinung zur Wasserversorgung Berlins
bilden und den nachfolgenden Bericht lesen:
372.000 Liter pro Stunde
Wofür braucht Teslas Gigafactory in Grünheide so viel Wasser?
…Unweit des „lieblichsten Tals der Mark“, wie Theodor Fontane das Löcknitztal nannte, sollen bald die Bagger rollen. Das knapp 500 Hektar große Naturschutzgebiet grenzt an jene Fläche,
auf der Tesla seine Elektroautofabrik errichten will. Die Gegend ist wasserreich, das Tal, dem das Flüsschen Löcknitz den Namen gibt, wird eingefasst von mehreren Seen im Norden und der Müggel-Spree im Süden…
…Rund zwei Drittel des Tesla-Areals liegen in einem Wasserschutzgebiet. In der Schutzzone 3B muss der US-Autobauer besondere Auflagen beachten. Dabei steht Tesla unter besonderer Beobachtung,
denn die Autofabrik wird Wasser brauchen – viel Wasser….
…Mit 372.000 Liter in der Stunde gibt Tesla in seinen Antragsunterlagen den Verbrauch an. Eine gewaltige Zahl, die Naturschützer und Anwohner fürchten lässt,
die Autofabrik könnte nicht nur Flora und Fauna das Wasser abgraben, sondern auch die Trinkwasserreserven der Region angreifen….
Tesla braucht 18,2 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr
…Nach Angaben des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) entsprechen 372 Kubikmeter Wasser pro Stunde dem Pro-Kopf-Jahresbedarf von 71.500 Menschen.
Hochgerechnet auf das Jahr 2021, wenn die Tesla-Fabrik die Produktion aufnehmen soll, müssten laut WSE pro Jahr 18,2 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert werden. Erlaubt sind aktuell 10,9 Millionen….
….Wofür aber braucht Tesla überhaupt so viel Wasser?
In seinem 246-seitigen Bericht über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen (UVP-Bericht) der Autoproduktion gibt das Unternehmen an,
Wasser werde für verschiedene Prozesse benötigt: in der Gießerei, der Lackiererei, der Batteriefertigung, der Endmontage, für die Kühltürme sowie für die Sanitäranlagen und für Reinigungszwecke….
Quelle: zitiert aus
rbb, Studio Cottbus berichtet:
11.08.20 | 17:02 Uhr

Bild: dpa
Größter Verbrauch am Freitag (07.08.2020) Wasserverbrauch in der Lausitz doppelt so hoch wie sonst
Es wird gewässert, kühl geduscht und viel getrunken: In Südbrandenburg ist in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich viel Wasserverbrauch verbraucht worden.
Einen Notstand wie in anderen deutschen Kommunen fürchtet der Versorger hier aber nicht.
Der Trinkwasserverbrauch in Cottbus und Umgebung ist in den vergangenen Hitze- und Dürretagen spürbar gestiegen.
Am Freitag habe es den bisher größten Wasserverbrauch des Jahres gegeben, sagte eine Sprecherin der Lausitzer Wasser GmbH (LWG) am Dienstag rbb|24.
Am möglichen Limit sei der Versorger aber noch nicht.
Wasserversorgung gesichert
Genau 31.322 Kubikmeter Wasser sind am Freitag verbraucht worden. Das sei etwas mehr als doppelt so viel wie an durchschnittlichen Tagen, an denen rund 15.000 Kubikmeter genutzt werden.
Ähnlich wie am Freitag habe der Verbrauch am Wochenende ausgesehen.
Trotz Hitze und Trockenheit sei die Versorgung mit Trinkwasser nicht gefährdet, heißt es von der LWG. "Unsere Wasservorkommen sind gesichert", sagt der Technische Leiter Jonas Krause
mit Blick auf den in Hessen ausgerufenen Trinkwassernotstand [hr1.de] und den Zusammenbruch der Wasserversorgung in der niedersächsischen Gemeinde Lauenau [ndr.de].
"Wir beziehen unser Wasser aus Grundwasser, das aus ziemlich tiefen Schichten gewonnen wird", erklärt Krause. "Da stellen wir im Moment keine Veränderungen aufgrund der Witterungsverhältnisse fest."
Schwankender Wasserdruck möglich
Probleme könnte es laut Unternehmenssprecherin höchstens vorrübergehend mit dem Wasserdruck geben, wenn sehr viele Lausitzer gleichzeitig den Hahn aufdrehen -
um zum Beispiel ihre Gärten zu bewässern oder nach der Arbeit zu duschen.
Die Lausitzer Wassergesellschaft versorgt rund 70.000 Haushalte mit Trinkwasser.
Zum Versorgungsgebiet gehören neben Cottbus und der näheren Umgebung und auch Teile des Dahme-Spreewald-Kreises und das Amt Altdöbern im Oberspreewald-Lausitz-Kreis.
Quelle: https://www.rbb24.de/studiocottbus/panorama/2020/08/lausitz-cottbus-hoechster-wasserverbrauch-wasserversorgung-trockenheit-hitze.html
Wirtschaft Jahrelange Dürre
Das Wasser wird knapp – ein ganz neues Problem für den Standort Deutschland
In Deutschland wird billiges und sauberes Wasser knapp. Das hat nicht nur Auswirkungen für Privathaushalte, sondern bedroht auch die Wirtschaft.
Wasser wird zur umkämpften Ressource.
Dass die deutschen Bauern über trockene Sommer jammern, hat fast schon Tradition. Doch jetzt wird billiges und sauberes Wasser grundsätzlich in vielen Regionen knapp.
Der Mangel verhindert große neue Wohn- und Industriegebiete – die das Land dringend braucht.
…Die Werbebotschaft der Harzwasserwerke im Internet von ihrem Trinkwasser muss womöglich revidiert werden:
Der größte Versorger Niedersachsens kann sein Wasser inzwischen nicht mehr allen Interessenten zur Verfügung stellen….
...Rohstoffknappheit ist ein viel diskutiertes Problem in der Wirtschaft. Meist geht es dabei um Erdöl oder exotische Metalle für die Elektrotechnik.
Aber Wasser? Deutschland ist doch kein Dürreland. Schon gar nicht im Norden. Billiges, sauberes Wasser war stets überall und unbegrenzt verfügbar. Jedenfalls bisher…
Dürre in Deutschland
Historische Trockenzeit. Ist das der Klimawandel?
…Es mehren sich die Zeichen, dass Wasserknappheit sogar das Wirtschaftswachstum begrenzen könnte. Ein Trend, den die Öffentlichkeit bislang kaum zur Kenntnis nimmt…
…Im dritten Hitzesommer in Folge drängt höchstens mal ein lokaler Versorgungsengpass wie im niedersächsischen Lauenau in die Schlagzeilen, vielleicht noch die Sorgen von Landwirten.
Die Industrie, oft durch eigene Brunnen gut versorgt, meldet bislang schließlich keine akuten Probleme…
…Spürbar wird die Knappheit zuerst bei neuen Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekten. Immer öfter scheitert die Ansiedlung am Wassermangel.
Allein die Harzwasserwerke mussten schon Anfragen über eine Million Kubikmeter zurückweisen…
…Die Mangelwirtschaft überrascht: Schließlich ist der Wasserverbrauch pro Kopf gesunken.
Gingen 1990 in Deutschland noch 147 Liter pro Person und Tag durch die Leitungen, waren es vergangenes Jahr 125 Liter.
Insbesondere die Industrie geht mit dem für sie kostbaren Nass effizienter um. So sank der Wasserbedarf für die Produktion einer Tonne Stahl von 35 Kubikmetern im Jahre 1980 auf derzeit acht Kubikmeter….
…Der Rückgang des Wassergebrauchs hatte auch Anpassungen der Infrastruktur zur Folge“, sagt Martin Weyand vom Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft.
Nötig sei eine integrierte Herangehensweise, die neben der Infrastruktur auch städtebauliche Maßnahmen berücksichtigt….
…Der Boden kann den Starkregen in Herbst und Winter häufig nicht mehr aufnehmen: „Hier brauchen wir ein aktives Regenwassermanagement.“ Die Bodenversiegelung durch Bautätigkeit tut ein Übriges…
…Zu viel Wasser rauscht über die Flüsse ab ins Meer, ohne einzusickern und zur Neubildung des Grundwassers beitragen zu können….
Anm.:
Die Versiegelung der Böden scheint eines der Hauptprobleme für den “Wassermangel“ in Deutschland zu sein
Das von der Regierung beschlossene „Investitionsbeschleunigungsgesetz“ für Deutschland sieht zwar Erleichterungen beim Bau von Verkehrsprojekten und Windparks vor….
das Thema Wasser-Infrastruktur wurde dort wieder einmal komplett vergessen…
…Wasser wird immer mehr zum limitierenden Faktor für die Wirtschaft. Nicht weil wir nicht genug hätten, sondern weil wir es nicht mehr gut verteilen können….
Warum Hitzewellen und Dürrephasen bei uns häufiger werden
…Während die Wasserpreise für Privatverbraucher oft relativ niedrig gehalten werden, kostet die Wasserknappheit die Industrie viel Geld…
…Die milliardenschwere Ansiedlung des Autobauers Tesla im Berliner Urstromtal bei Grünheide gelang nur,
weil der Konzern die Bedenken des Wasserverbandes Strausberg-Erkner mit aufwendigen Spar- und Recyclingkonzepten aus der Welt schaffte…
…. Bislang hieß es aus der Klimawissenschaft, dass trockeneren Sommern höhere Niederschläge im Winter gegenüberstünden. Doch diesen Trend können die Harzwasserwerke nicht bestätigen.
Nach einer Analyse der Niederschlagsmengen zwischen 1941 und 2018 im Westharz steht für den Versorger fest: „Der Harz wird immer trockener.“…
Wie die Landwirtschaft mit dem Klimawandel kämpft
…Das Niederschlagsdefizit habe man bislang zwar durch das Talsperren-System ausgleichen können…
…Statt bei 67 Prozent wie im langjährigen Mittel liegen die Füllstände nur bei 49 Prozent…
…Die Konflikte um Trinkwasser „werden regional mit Sicherheit zunehmen“, sagt Gunar Gutzeit, Experte für Infrastrukturplanung an der FH Potsdam. Wasserversorger und Kommunen müssten gegensteuern…
…In der Politik sind die Reaktionen auf die Mahnungen verhalten. Zwar arbeiten Landesregierungen an Wasserkonzepten. Auch tagt ein „Nationaler Wasserdialog…. Carsten Dierig, Anja Ettel, Daniel Wetzel
Quelle: zitiert aus WELT-online.de, 27-08.2020
Ausführlich unter:
Wenig Wasser in der Lausitz
Forst. Immer mehr Orte melden dramatische Wassernot.
…Im Spreewalddorf Straupitz ist der Schlossteich ohne Wasser, im Hafen bedeckt es kaum den Grund - zu wenig für Kahnfahrten.
…In Forst ist das Fließ an der Noßdorfer Mühle ohne Wasser. Die sonst feuchten Neiße-Wiesen bei Jerischke-Pusack sind verdorrt. bl
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 25.08.2020
Die Lausitz vertrocknet / Senftenberger See und Flüssen geht das Wasser aus
Kein Regen in Sicht und hohe Temperaturen in den nächsten Tagen: Die Situation von Spree und Schwarzer Elster wird sich verschärfen.
Auch der Senftenberger See verliert weiter an Wasser. Wie lange kann er noch genutzt werden?

Wie hier bei der LMBV-Zentrale in Senftenberg führt die Schwarze Elster an der Landesgrenze über mehrere Kilometer kein Wasser mehr. © Foto: Jan Augustin
…Der Regen am vergangenen Wochenende (01./02.08.2020) hat die Lage in den Lausitzer Flüssen nicht verbessert.
Zu diesem Ergebnis ist die länderübergreifende Arbeitsgruppe „Extremsituation“ gekommen. Spree und Schwarze Elster führen nun schon seit dem Sommer 2018 extremes Niedrigwasser. …
…Aktuell beträgt der Abfluss am Pegel Biehlen nur noch 0,4 Kubikmeter pro Sekunde (Stand 6. August). Der mittlere Abfluss für diesen Pegel liegt im Juli normalerweise bei rund 1,91 Kubikmetern pro Sekunde…
Senftenberger See verliert weiter Wasser
…Die Bewirtschaftung des Senftenberger Sees sei mittlerweile nahezu eingestellt worden.
Der aktuelle Wasserstand liegt hier bei 98,55 Metern über Normalnull (NHN). Fällt der See unter 98,30 Meter, müsste das Gewässer wegen Rutschungsgefahr wieder gesperrt werden.
Unter den bisherigen meteorologischen Bedingungen fiel der Wasserstand um circa drei Zentimeter pro Woche. …
Talsperre Bautzen noch zu 60 Prozent gefüllt
…Auch im Oberlauf der Spree und den sächsischen Zuflüssen hat sich die Niedrigwasser-Situation durch ausbleibende Niederschläge weiter zugespitzt.
Die Talsperre Bautzen ist aktuell noch zu 60 Prozent gefüllt, gibt aber weiter Wasser an die Spree ab. Die Talsperre Quitzdorf kann mangels Zufluss kein Wasser bereitstellen….
…Im Speicherbecken Bärwalde stehen nur noch 13 Prozent des Speichervolumens zur Verfügung. Das nutzbare Volumen kann voraussichtlich noch bis September (2020) in geringem Maße zur Stützung der Abflüsse in der Spree verwendet werden..
Talsperre Spremberg verliert täglich vier Zentimeter
…Die Talsperre Spremberg erhielt in den vergangenen Wochen nach Ministeriumsangaben einen sehr niedrigen Zufluss von unter sechs Kubikmeter pro Sekunde.
Zur Stützung des unteren Spreegebietes müssen jedoch weiter über sieben Kubikmeter pro Sekunde abgegeben werden.
Der Wasserstand fällt daher täglich um vier Zentimeter (???) und beträgt aktuell 90,43 Meter NHN (Stand 3. August 2020)…
Zufluss zum Spreewald und nach Berlin signifikant eingeschränkt
…Damit schränkt sich der Gesamtzufluss zum Spreewald und nach Berlin signifikant ein…Die in den nächsten Tagen prognostizierten hohen Temperaturen werden zu einer erhöhten Verdunstung führen….
…Auch flächendeckender Niederschlag wäre nicht ausreichend, um das aufgelaufene Niederschlagsdefizit von fast 400 Millimeter (circa 75 Prozent des Jahresniederschlages)
im gesamten Einzugsgebiet kurzfristig auszugleichen…Jan Augustin
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 06.08.2020
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/senftenberg/duerre-in-der-lausitz-extremes-niedrigwasser-an-spree-und-schwarzer-elster-50271641.html
Dürre Cottbuser Gräben wird das Wasser abgedreht
Das Wasser für die Spree wird immer knapper. Die Situation ist so dramatisch, dass nun den Nebengewässern der Hahn abgedreht wird.
Damit fallen einige Gräben in Cottbus trocken. Nicht überall gibt es Verständnis dafür.

Der Willmersdorfer Hauptgraben ist nur noch ein Rinnsal. Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen ist bedroht.
Der Willmersdorfer Hauptgraben trocknet immer mehr aus. Der Zufluss aus der Spree über den Hammergraben wurde stark reduziert. © Foto: Michael Kleitz
…Die Spree schlängelt sich gemächlich durch die Stadt Cottbus….
…Wegen niedergehender heftiger Schauer über der Stadt. Kein Vergleich mit den Dürresommern der vergangenen beiden Jahre….
Abseits der Spree trocknet der Willmersdorfer Hauptgraben aus
…Doch nun kommt es heftig - der Willmersdorfer Hauptgraben wird nur gefunden, weil man weiß, wo er entlangführt. Nur ein Rinnsal,
wo noch ein wenig Wasser plätschert…
… Bedenken eines Willmersdorfers: „Da werden Millionen für eine Fischtreppe an der Spree ausgegeben und an anderer Stelle wird ein Fischsterben in Kauf genommen, um andere Regionen mit Wasser zu versorgen.“
Der Spreewald hängt vom Wasser der Spree ab
…Andere Regionen. Das ist der Spreewald. Das Gewässernetz ist auf die Spree angewiesen, die wie eine Hauptschlagader durch die Region fließt und die Fließe mit ausreichend Wasser versorgt…
Der Spreewald ohne Spree wäre keine Touristenattraktion mehr.
…Der Fluss lässt sich nicht auf einen Ort beschränken. Er ist ein lebendiges System, das sich durch viele Landkreise und zwei Bundesländer schlängelt. Und überall gibt es Abhängigkeiten...
…Deshalb wird die Wasserbewirtschaftung der Spree vom Land Brandenburg in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen reguliert…
…Die Arbeit liegt in der Hand des Landesamtes für Umwelt. Das setzt nun besagten Notfallplan um – oder im Fachjargon Konzept zur Wasserbewirtschaftung im mittleren Spreegebiet unter extremen Niedrigwasserverhältnissen….
Der Pegel der Spree liegt unter dem Schwellenwert
…Dabei ist der Pegel Leibsch im Unterspreewald ausschlaggebend. Wenn der unter den Wert von 1,5 Kubikmeter pro Sekunde fällt, tritt die dritte Phase des Notfallplans in Kraft….
…Das bedeutet: Die Wasserausleitung aus der Spree und deren Nebengewässern wird weiter reduziert. Teils bis auf null herabgefahren.
Darunter zählt auch der Willmersdorfer Hauptgraben, der aus dem Hammergraben gespeist wird…
…Die meist lokal begrenzten Niederschläge hätten nur zu einer kurzfristigen Entspannung geführt, da sie nicht zurückgehalten werden konnten (???)…
Anm:.
Warum ist es nicht möglich, die Grabensysteme der Stadt ordentlich zu bewirtschaften,
d.h. Zurückhaltung von Wasser aus den Teileinzugsgebieten der Grabensysteme in
niederschlagsreichen Perioden, damit in Niedrigwasserperioden ein landschaftlich
notwendiger Mindestdurchfluss gewährleistet werden kann.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage:
Wie können z.B. gereinigte Abwässer der Kläranlage Cottbus zur Stabilisierung des
Wasserdargebots in den Grabensystemen genutzt werden.
Weniger Wasser aus der Talsperre Spremberg
…Zudem muss die für die Wasserführung der Spree maßgebliche Abgabe aus der Talsperre Spremberg reduziert werden,
da die Zuflüsse zur Talsperre unter den Werten des Vorjahreszeitraumes liegen….
Die Reserven in den sächsischen Speichern liegen demnach deutlich unter den Werten des Vorjahres. Grund seien die geringen Niederschläge im Winterhalbjahr….
…Die Wasserzufuhr wird runtergefahren Peggy Kompalla
Anm.:
Es geht nicht nur um die Wasserversorgung des Spreewaldes, (in den Trockenjahren 2019, 2018 hat sich das Wassermanagement: Landesamt für Umwelt, Freistaat Sachsen
und Leag, koordiniert von der Flutungszentrale Lausitz bestens bei allen Unterliegern bewährt), sondern auch um die Sicherung der Wasserversorgung von Berlin.
Zusätzlich ist noch die (außerplanmäßige) Wasserversorgung der (politisch gewollten) GIGA-Fabrik Tesla zu sichern (s. dazu vorherigen Beitrag) .
Für folgende Gewässer im Stadtgebiet von Cottbus wurde auf Anweisung des Landesamtes für Umwelt die Wasserabgabe teilweise bis auf Null reduziert.
Ausleitungen aus der Spree:
Grabensystem Schmellwitz, Ableitung Willmersdorfer Hauptgraben, Ableitung Sielower Landgraben, Ableitung Dorfgraben Döbbrick.
Ausleitungen aus dem Hammergraben:
Ableitung Willmersdorfer Hauptgraben, Ableitung Schwarzer Graben.
Ausleitungen aus dem Priorgraben:
Ableitung Hechtgraben, Ableitung Ströbitzer Landgraben.
Quelle: zitiert
aus lr-online, 23.07.2020
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/duerre-cottbuser-graeben-wird-das-wasser-abgedreht-49184600.html
Neuer Ärger um Tesla-Werk
Wasserverbrauch Der zuständige Verband schlägt Alarm.
Grünheide. Die Pläne für den ersten Teil der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Brandenburg stehen nach Ansicht der Landesregierung nicht auf der Kippe -
trotz neuer Warnungen vor Unsicherheiten zur Wasserversorgung. Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hält die Versorgung für nicht gesichert und schlägt Alarm.
…Wirtschaftsminister. Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich verwundert.
"Alle bisher zum Thema Wasser geführten Gespräche haben zum Ergebnis gehabt, dass die anstehenden Probleme lösbar sind und das Tesla-Projekt nicht gefährden."…
….Auch das Umweltministerium sieht keine Gefahr: Umweltminister Axel Vogel (Grüne) erklärte, auch der Wasserverband habe eine positive Prognose für die erste Ausbaustufe gegeben….
Anm.:
Die beiden Potsdamer Spitzenpolitiker sind (auch) ausgewiesene Wasserexperten und zeigen sich verwundert. Von wem wurden sie eigentlich beraten?
„Tesla“ ist politisch gewollt, da spielt auch eine Gefährdung einer gesicherten Trinkwasserversorgung der Bevölkerung keine entscheidende Rolle.
…WSE-Verbandsvorsteher Andre Bähler warnt, weitere Ausbaustufen für die Erschließung der Tesla-Fabrik könnten nicht ohne gravierende Änderungen und Erweiterungen ermöglicht werden….
..Tesla hatte den prognostizierten Wasserverbrauch für den ersten Teil der Fabrik von 3,3 Millionen auf 1,4 Millionen Kubikmeter im Jahr reduziert….
…Der WSE fürchtet, dass bei einem weiteren Ausbau nicht genug Wasserreserven für die Region vorhanden sind und rechnet mit rund 1,5 Millionen Kubikmetern im Jahr für Tesla
und einem Verbrauch ohne Tesla von 11,5 Millionen Kubikmeter….
…Erlaubt seien 15 Millionen Kubikmeter, es gebe nur zwei Millionen Reserve…
…Ende 2022 stünden für kommunale Entwicklungen keine erlaubten Wassermengen bereit, zusätzlich seien drei Millionen Kubikmeter nötig….dpa/bf
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 20.07.2020
Weitere Quellen:
https://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/20200718_1930/tesla-wasserstreit.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article228167477/Wasserverband-warnt-vor-Problemen-durch-Tesla.html
„Laut dem öffentlichen Bericht zur Umweltverträglichkeit benötigt die Tesla-Fabrik 372 Kubikmeter Wasser pro Stunde.
Das entspricht 372.000 Litern. Jeder Brandenburger Einwohner verbrauchte 2016 im Durchschnitt etwa 111 Liter Wasser pro Tag.
Im vergangenen Jahr hatte der Verband angesichts der Trockenheit zum sparsamen Umgang mit dem Nass aufgerufen. Während Niederschläge fehlten, war der Trinkwasserbedarf gestiegen.
An Abwasser fallen demnach 252 Kubikmeter in der Stunde an. Für dessen Reinigung sollen die Klärwerke des WSE sowie eine fabrikeigene Anlage genutzt werden.
Allerdings braucht Tesla dafür eine spezielle Genehmigung, weil die Fabrik teilweise in einer Wasserschutzzone liegt.
Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) muss die Untere Wasserbehörde über die Einleitung von Abwasser ins Klärwerk von Münchehofe entscheiden.
Dazu kommt die Prüfung einer Ausnahmegenehmigung wegen der Schutzzone. „
Anm.:
Beim Lesen des nachfolgenden Artikels hat man das Gefühl, dass das Rad neu erfunden wurde.
Mit wasserwirtschaftlichen Binsenweisheiten beschäftigen sich Institutionen, wie die Deutsche Bundestiftung (DBU) und der BUND.
Beide Institutionen werden auch noch durch den Bund finanziert.
PANORAMA
Wasser wird hierzulande knapp
Trockenheit
Regionale Konzepte sollen laut Bundesstiftung Umwelt dem Mangel entgegenwirken.
Osnabrück. ...Angesichts zunehmender Trockenheit in Deutschland muss aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) beim Wassermanagement auf dem Land grundlegend umgedacht werden.
Während die Strategie seit Jahrzehnten darin bestand, Wasser möglichst schnell aus der Fläche herauszubringen, müsse es nun darum gehen, Wasser in der Landschaft zu halten …
Anm.:
Diese Einschätzung ist m.E. falsch. Es gilt vielmehr abhängig von der jeweiligen wasserwirtschaftlichen Situation Be- bzw. Entwässerungsmaßnahmen durchzuführen – intelligentes Wassermanagement
….und Fließgewässern mehr Raum zu geben, sagte der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde.
Wichtig seien regionale Konzepte, bei denen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz zusammenarbeiten müssten.
…Die Folgeschäden der Trockenheit für die Landwirtschaft seien riesig - allein für das Jahr 2018 betragen sie der Stiftung zufolge 8,7 Milliarden Euro in der Europäischen Union…
...Die DBU -Stiftung hat bereits mit einigen Förderprojekten auf die zunehmende Wasserknappheit reagiert...
Die Energiewende werde absehbar aber einen positiven Effekt auf den Wasserhaushalt haben, weil mit der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien die Zahl der Kohle- und Kernkraftwerke abnehmen werde.
Diese hätten einen großen Kühlwasserbedarf, sagte Hempel.
Anm.:
Der Wasserbedarf von modernen Kraftwerken wird teilweise stark überschätzt.
Anm.: noch eine „Neuentdeckung“: Hoher Bedarf im Sommer
…Bei Nutzungskonflikten um das Grundwasser müsse die Sicherung des Trinkwassers Vorrang: haben, sagte ein Sprecher des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU)….
…Der Wasserbedarf im Mai (2020) sei so hoch gewesen wie lange nicht mehr. Weil dieses Jahr viele Menschen den Urlaub zu Hause verbringen werden, sei im Sommer keine Entlastung zu erwarten….
…Für den Bund Umwelt und Naturschutz (BUND) stellte deren Gewässerexpertin Lilian Neuer fest, dass der Wassermangel fatale Folgen für Mensch und Umwelt habe….
…Ganze Populationen von Fischen, Muscheln oder Amphibien stürben in trockenen Bächen und Seen aus …dpa
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 16.07.2020
Anm.:
Nach zwei Trockenjahren 2018, 2019), endlich "Ausgeschlafen"?
Ich wollte meinen Augen nicht trauen als ich die folgende Mitteilung las.
Eine derartige Niedrigwasserkonzeption liegt für das Land Brandenburg schon mindestens seit den 80ér Jahren vor.
Es kann nur (dringend) empfohlen werden, in den Archiven der ehemaligen Wasserwirtschaftsdirektion Oder-Havel Potsdam bzw. der Nachfolgeinrichtung,
Landesumweltamt Brandenburg gründlich zu recherchieren.
....
Wassermangel Ministerium erarbeitet Konzept
Potsdam. Auch wenn es in diesem Jahr bereits des Öfteren geregnet hat, für den trockenen Boden in Brandenburg reicht das nicht aus..
Um dem Problem zu begegnen, soll noch in diesem Jahr ein sogenanntes Niedrigwasserkonzept fertiggestellt werden, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte.
In dem Konzept gehe es darum, wie mit dem wenigen Wasser im Land, mit dem Oberwasser (Anm.: Was das immer auch sein soll) , aber auch mit dem Grundwasser, umzugehen ist,
wie eine Sprecherin sagte. dpa
Quelle: Lausitzer Rundschau, 15.07.2020, Seite 12
WASSER ZEITUNG, Seite 6, Juni 2020
WASSER-GESCHICHTEN
Zu den märkischen Flachwasserseen ohne eigenen Zufluss gehört der Seddiner See. Seine mittlere Tiefe liegt bei 2,30 m, die maximale Tiefe bei 7,90 m, das Wasservolumen beträgt rund 7 Mio. m3.
Bild unter:
https://www.fotocommunity.de/photo/grosser-seddiner-see-matzel58/39797633
Jörg Lewandowskis Forschung und die seiner Arbeitsgruppe widmen sich dem Thema Grundwasser-Oberflächenwasser-Interaktionen.
Sie untersuchen nicht nur die Hydrologie, also den Wasseraustausch, sondern auch die Biogeochemie.
Ist die Mark in See-Not?
In den dramatischen Hitze- und Dürre-Wochen der vergangenen beiden Jahre erlebten es viele Brandenburger/innen direkt vor ihren Haustüren:
Geliebte Badeseen verloren teils dramatisch an Pegel, einige Flüsschen versiegten komplett. Experten warnten sogar, dass Gewässer der Region völlig verschwinden.
Allerdings könne man dagegen angehen, etwa mit natürlichen Wasserspeichern in der Landschaft und dem Zurückhalten des Regenwassers.
Wie sich die Lage aktuell darstellt, fragte die WASSER ZEITUNG den Ökohydrologen Jörg Lewandowski vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).
WZ: Herr Lewandowski, gerade im Berliner Raum sind die Wasser-Ressourcen aufgrund des Bevölkerungszuwachses arg strapaziert.
Was wissen wir eigentlich über die Quantität unserer unterirdischen „Vorräte“?
Da es in Berlin so viele Wasserflächen gibt, vergisst man oft:
Es ist eine der niederschlagsärmsten Regionen in Deutschland.
Der überwiegende Teil des als Trinkwasser geförderten Grundwassers in Berlin ist streng genommen kein Grundwasser sondern Uferfiltrat.
Die Brunnengalerien zum Beispiel entlang des Müggelsees, des Wannsees und des Tegeler Sees fördern hauptsächlich Seewasser, das einige Wochen vom See bis zum Entnahmebrunnen
durch das Sediment fließt und dabei gereinigt wird. So lange ausreichend Oberflächenwasser vorhanden ist, sind hier keine Quantitätsprobleme zu erwarten. ....
....Sind die 3 vergangenen Dürre-Jahre Ihrer Einschätzung nach heute schon in den Grundwasserkörpern spürbar?
Auf jeden Fall! Die sogenannte Grundwasserneubildung ist ein komplexer Vorgang. Ein Teil des Niederschlags fließt über Fließgewässer oberirdisch ab,
ein Teil verdunstet direkt, ein weiterer Teil wird von Pflanzen aufgenommen und verdunstet danach ebenfalls. Nur der Rest versickert im Boden und speist so den Grundwasserleiter.
In der Region Berlin/Brandenburg ist dieser Teil zwar in den letzten Jahrzehnten im Mittel zurückgegangen, aufgrund der bodenhydrologischen und der geologischen Verhältnisse jedoch lokal sehr unterschiedlich.
Wir sehen an unseren Untersuchungsstandorten derzeit ausgesprochen niedrige Grundwasserstände, anderenorts haben sich die Grundwasserstände über den letzten Winter wieder erholt.
Ich möchte aber betonen, dass in der Vergangenheit ähnlich niedrige Grundwasserstände aufgetreten sind. Möglicherweise haben wir aber an vielen Standorten derzeit das untere Ende der bisher beobachteten natürlichen Schwankungsbreite erreicht.
Was, wenn sich Dürre-Perioden verstetigen? Drohen unsere Grundwasserkörper zu versiegen?
Ja, wenn sich die extremen Wetterverhältnisse verstetigen, könnte Wassermangel in Zukunft ein wichtiges Thema werden –
auch wenn ich mir ein „Versiegen“ unserer Grundwasserkörper derzeit nicht vorstellen kann.
Es spielt eine große Rolle, wann die Niederschläge fallen. Im Winter findet kaum Verdunstung oder Aufnahme durch Pflanzen statt,
sodass ein erheblicher Teil des Niederschlags den Grundwasserleiter erreichen kann. Wichtig ist auch, wie viel Niederschlag oberirdisch über Flüsse, Kanäle und Gräben abfließt
und damit den Grundwasserleitern nicht mehr zur Verfügung steht.
Die frühere Praxis der Entwässerung großer Flächen ist zu überdenken und in städtischen Ballungsräumen sind Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserversickerung und Flächenentsiegelung sicherlich gut, um einem Rückgang von Grundwasserständen vorzubeugen.
Wirkt sich ein fallender Grundwasser-Pegel auf die Pegel der Oberflächengewässer aus?
Ja! In der Vergangenheit wurden Grundwasser und Oberflächenwasser oft als getrennte Kompartimente betrachtet. Hydrogeologen erforschten das Grundwasser, Limnologen die Oberflächengewässer.
Seit mehreren Jahrzehnten fokussieren international zahlreiche Arbeitsgruppen auf Grundwasser-Oberflächenwasser-Interaktionen.
Wenn der Grundwasserstand höher als der des Oberflächengewässers ist, dann fließt Grundwasser in den Fluss oder See. Ist der Grundwasserstand dagegen niedriger,
so verliert das Oberflächengewässer Wasser an den Grundwasserleiter. Wie stark dieser Austausch ist, hängt von der sogenannten hydraulischen Leitfähigkeit des Untergrunds ab.
In Deutschland gibt es viele Seen, die von Grundwasser durchflossen sind, also bei denen in einigen Bereichen Grundwasser zuströmt, in anderen Bereichen Seewasser in den Grundwasserleiter abfließt.
Damit ist ein See letztlich nichts anderes als ein „Fenster“ im Grundwasserleiter.
Gerade Oberflächengewässer ohne natürlichen Zulauf leiden am Niederschlagsmangel! Wird sich die Landkarte verändern? Sprich, werden einige Seen aus der Mark verschwinden?
Die meisten Seen ohne Zufluss sind grundwassergespeist. Hier wirken sich Schwankungen der Grundwasserstände natürlicherweise besonders stark auf den Wasserstand im See aus
und können auch zum Austrocknen und Verschwinden solcher Seen führen. Solche Veränderungen der Grundwasserstände können lokal durch Management-Maßnahmen
wie veränderte Stauhaltungen in nahegelegenen Gewässern oder Grundwasserentnahmen verursacht werden.
In den meisten Fällen spielt aber der Klimawandel wahrscheinlich die entscheidende Rolle. Verringerte Niederschläge und erhöhte Verdunstung führen zwangsläufig zu sinkenden Grundwasserständen
durch eine verringerte Grundwasserneubildung.
Daher begrüße ich als Wissenschaftler alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Begrenzung des klimawandelbedingten Temperaturanstiegs.
Allerdings ist auch klar, dass selbst bei Erreichen des 1,5°C- Ziels wahrscheinlich viele Flachseen verschwinden werden, weil die klimatischen Veränderungen auch dann sehr groß sein werden.
Der Große Stechlinsee ist ein natürlicher See im Norden Brandenburgs. Mit einer Fläche von 412 Hektar war er lange für seine Wasserqualität bekannt und ist mit 70 Metern der tiefste See des Bundeslandes.
Bild unter:
https://unterwegsblog.de/rund-um-den-stechlin/stechlin-027/
Quelle: zitiert aus WASSER ZEITUNG, Juni 2020
Ausführlich unter:
https://lausitzer-wasser.de/de/unternehmen/oeffentlichkeitsarbeit/lausitzer-wasser-zeitung.html
Zu wenig Regen Wassersituation in der Schwarzen Elster bleibt angespannt
An der Landesgrenze zu Sachsen führt die Schwarze Elster trotz Niederschlägen in den vergangenen Tagen immer noch kein Wasser.
Die Situation bleibt sehr angespannt, teilt das Umweltministerium mit.

Erst ab dem Wehr Buchwalde in Richtung Senftenberg führt die Schwarze Elster dank der Rainitza wieder Wasser. © Foto: Manfred Feller
Die insgesamt 179 Kilometer lange Schwarze Elster passiert das Land Brandenburg auf einer Strecke von knapp 88 Kilometern von der brandenburgisch-sächsischen Landesgrenze bei Senftenberg bis zur Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt bei Herzberg. Direkt an der sächsischen Landesgrenze bei Senftenberg ist sie seit Wochen trocken gefallen.
Erst ab dem Wehr Buchwalde in Richtung Senftenberg führt die Schwarze Elster dank der Rainitza wieder Wasser.
Unterwegs in Richtung Bad Liebenwerda und Herzberg bringen Pulsnitz und Große Röder geringe Zuflüsse.
Kein Wasser aus Speicherbecken Niemtsch
…An der Schwarzen Elster verschärft sich die Lage aufgrund der sehr geringen Abflüsse und Niederschläge weiter…
…Am Pegel Neuwiese (Sachsen, zwischen Hoyerswerda und Senftenberg) werden nur noch ca. 0,065 Kubikmeter pro Sekunde gemessen (Stand 6. Juli).
An der Landesgrenze zu Brandenburg führt die Schwarze Elster kein Wasser mehr….
…Die Stützung des Abflusses der Schwarzen Elster am Pegel Biehlen erfolgt zu einem großen Teil aus der Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza …
Der Wasserstand des Speicherbecken Niemtsch liegt bei 98,69 Meter Normalhöhennull (NHN; Stand 6. Juli) und fällt nach Ministeriumsangaben
um etwa einen Zentimeter im Zeitraum von zwei bis drei Tagen. Frank Claus
Quelle: zitiert aus lr-online, 08.07.2020
Ausführlich unter:
Anm. zum nachfolgenden Artikel:
… leider schon vergessen und jetzt 2020 wieder modern
Die Elbe mit der Spree zu verbinden, ist eine alte Vision
Die Idee eines Wasserweges von der Elbe bei Mühlberg ins ehemalige Braunkohlenrevier um Senftenberg wird seit einigen Monaten heiß diskutiert.
Damit soll die zusätzliche Flutung der Gewässer des Lausitzer Seenlandes mit Elbewasser bezweckt werden. Neu ist diese Idee indes nicht.
Vor 94 Jahren erschien eine „Denkschrift über die Ausführung eines Elbe-Spree-Kanals“.

Die Karte zeigt den geplanten Streckenverlauf (geschwungene dunkle Linie) des Elbe-Spree-Kanals auf dem Teilabschnitt zwischen Elsterwerda und Senftenberg. Foto: T. Richter/trt1 © Foto: T. Richter/trt1
…Die kühnen Pläne einer neuen Wasserstraße sollte von der Elbe bei Mühlberg bis zur Spree im Schwielochsee quer durch die Niederlausitz führen…
…Hier soll der Elbe-Elster-Spree-Kanal helfend eingreifen“, heißt es in der „Denkschrift über die Ausführung eines Elbe-Spree-Kanals“ aus dem Jahr 1916…
Auftrag der Handelskammer
…Das 78-seitige Werk wurde im Auftrag der Handelskammer für die westliche Niederlausitz durch das Berliner Büro Havestadt & Contag erstellt.
Die Handelskammer mit Sitz in Cottbus galt bereits damals als Traditionsbehörde. Ihre Gründung fiel ins Jahr 1852…
…Mit den Planungen für einen Schifffahrtskanal durch die Niederlausitz war bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begonnen worden.
Abzweig bei Mühlberg…
..Der Kanal sollte bei Mühlberg von der Elbe abzweigen. Über Elsterwerda, Mückenberg (heute Lauchhammer-West),
Ruhland, Senftenberg, Petershain (heute Neupetershain) und Cottbus war die Verbindung bis nach Goyatz zum dortigen Schwielochsee geplant. Die Gesamtstrecke ist mit 131,5 Kilometern angegeben.
Insgesamt elf Häfen waren vorgesehen, davon sollten in Senftenberg sogar zwei entstehen…
55 Millionen Euro
…Die gesamten Baukosten für den Elbe-Spree-Kanal werden in der Denkschrift mit ungefähr 55 Millionen Mark angegeben. Pro Kanalkilometer wäre demnach eine Summe von 418300 Mark angefallen.
Warum die Schifffahrtsverbindung letztendlich nicht gebaut wurde, ist unklar…
…Als mögliche Ursachen sind der für das Deutsche Kaiserreich verlorene Erste Weltkrieg und die sich daran anschließende Inflationszeit zu vermuten…
… Vielleicht werden die fertigen Planungen für die Wasserstraße eines Tages wieder aus der Schublade geholt und zumindest partiell in die Realität umgesetzt. trt10
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 13.11.2010
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/senftenberg/die-elbe-mit-der-spree-zu-verbinden_-ist-eine-alte-vision-35130620.html
Region: Wasser in Spree und Elster wird knapp
In den sächsischen Speicherbecken gibt es kaum noch Reserven / Wasserentnahmen sind untersagt

Der Spreewaldalltag, wie hier im Bild, ist noch nicht wieder ganz hergestellt, und leider musste jetzt auch die Burger Handwerkernacht abgesagt werden.
Kein Kahn gerät aufs Trockene Foto: CGA-Archiv
Regionn (Hnr.) Aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes kommen sorgenvolle Nachrichten:
…Die anhaltende Trockenperiode macht diese Arbeitsgruppe zum Dauergremium….
… Im dritten Jahr in Folge sind Speicher unzureichend gefüllt und im Monat Mai registrierte die Station Cottbus klägliche 32 Millimeter Niederschlag –
das sind
55 Prozent der mittleren üblichen Menge, teilt Frauke Zelt, Pressesprecherin,
mit. Der Regen letztes Wochenende entspannte die Situation kaum….
…Wasserstände und Abflüsse an den Messpegeln der Spree fallen dramatisch. Am Pegel Leibsch UP wurden Montag 1,58 Kubikmeter pro Sekunde registriert;
normal wären hier im Juni von 8,54 m3/sec…
... Nach und nach werden alle Ausleitungen in Grabensysteme geschlossen. Landkreise und Städte haben bereits Einschränkungen des Anliegergebrauchs von Oberflächenwasser verordnet oder werden dies jetzt tun….
…Im sächsichen Einzugsgebiet der Spree ist die Lage prekär. Das Wasser des Speicherbeckens Bärwalde reicht maximal bis Ende Juni (2020)....
… Aus dem
Speicherbecken Lohsa I und der Talsperre Bautzen stehen nur geringe Wassermengen
zu Verfügung; letztere ist nur zu 70 Prozent gefüllt, und die Talsperre
Quitzdorf steht wegen Wassermangels gar nicht zur Verfügung….
…Auch an der Schwarzen Elster bleibt die Lage sehr kritisch. Die Schwarze Elster führt sehr wenig Wasser. Am Pegel Neuwiese zwischen Hoyerswerda und Senftenberg werden noch 0,25 m3/sec gemessen,
an der Landesgrenze zu Brandenburg fällt der Fluss trocken….
… Der Wasserstand im Speicher Niemtsch sinkt alle zwei Tage einen Zentimeter und liegt derzeit bei 98,80 Meter NHN…
…Die Stützung der Schwarzen Elster erfolgt aus der Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza, womit insbesondere den pH-Wert unterhalb von Plessa stabilisiert wird.
Der
Abfluss am Pegel Biehlen liegt bei 0,83 m3/sec – etwa einem Drittel des
Normalen…
…Am Cottbuser Ostsee steht der Füllstand derzeit unverändert zwischen 40 und 45 m NHN (Zielstand 62). Die Situation entspricht dem Prognoseszenario „trocken“, nach dem der Wasserstand erst ab Mai 2022 deutlich steigt…. Hnr.
Quelle: zitiert aus märkischer-bote.de, 12.06.2020
Ausführlich unter:
https://maerkischer-bote.de/region/region-wasser-in-spree-und-elster-wird-knapp-202069
Trockenheit in Cottbus: Berühmter Branitzer Park braucht mehr Wasser
Die Spree versorgt den Branitzer Park in Cottbus und dessen wertvolle Bäume. Doch der Wasserstand des Flusses ist niedrig.
Das gefährdet den Park. Fachleute erkunden nun, wie künftig mehr Wasser für Fürst Pücklers Erbe bereitgestellt werden kann.
…Der Branitzer Park besitzt eine blaue Rettungsleitung. Die war im Jahr 2017 dafür ausgelegt worden, um das Gartendenkmal vor braunem Wasser zu schützen.
Denn das Grabensystem des Parks wird von der Spree gespeist…..
Stadt Cottbus: Sorgen wegen Niedrigwasser in der Spree
….Der Umweltdezernent blickt erneut mit Sorgen auf die Spree. Diesmal allerdings nicht wegen der Eisenfracht.
Dieses Problem werde an der Talsperre Spremberg durch Anstrengungen der Länder Brandenburg und Sachsen und des Bergbausanierers LMBV derzeit gut reguliert.
Es ist der anhaltend geringe Wasserstand des Flusses….
…Neben den ausbleibenden Regenfällen, werde das Problem durch den Rückgang der Sümpfungswässer aus den Tagebauen weiter verschärft…
… In diesem Zug werde auch die Wasserzufuhr in den Grabensystemen gedrosselt. „Für den Branitzer Park hat das Wasser bislang gerade so gereicht“, sagt Thomas Bergner…..
Branitzer Park: Mehr als 200 Bäume schwer geschädigt
…Wie dramatisch die Lage im Park ist, belegen Zahlen, die von Ende 2019 stammen. Demnach sind im Park mehr als 200 Bäume schwer geschädigt oder absterbend und 20 bereits verloren…..
…Deshalb beschäftigen sich bereits Fachleute mit einer Alternative für die bisherige Wasserversorgung...
….Der Energiekonzerns Leag hat eine Machbarkeitsstudie für eine Grundwasserentnahme in der Tiefe in Auftrag gegeben. Das bestätigt Unternehmenssprecher Thoralf Schirmer….
…Mit Details hält sich der Leag-Sprecher zurück: „Bevor die derzeit laufende Machbarkeitsstudie
zum Tiefbrunnenbau in Branitz nicht abgeschlossen und ausgewertet ist, können wir uns dazu auch nicht äußern“, sagt er. Dezernent Bergner sagt, dass Ende Juni (2020) erste Ergebnisse dazu vorliegen sollen….
Branitzer Park besitzt oberirdische Not-Wasserleitung
…Bis zu neuen oder zusätzlichen Wasserversorgung müsse die blaue Leitung erhalten bleiben. Damit haben sich sogar die Denkmalpfleger des Parks arrangiert…
…Das blaue Rohr schlängelt sich vom Tierpark am Spreeauenpark vorbei über die Vorparkwiese bis zum Branitzer Park. Der Einlauf befindet sich in der Nähe der Holzbrücke,
die vom Bahnhof Zoo der Cottbuser Parkeisenbahn in den Park hineinführt…
…Die Notfall-Versorgung füllt das Grabensystem für Branitzer Park, Spreeauenpark und Tierpark….

© Foto: Peggy Kompalla
Blaue Wasserleitung versorgt den Branitzer Park
…Die Verlegung der blauen Wasserleitung für den Branitzer Park in Cottbus 2017 hat nach Angaben von Umweltderzernent Thomas Bergner 150.000 Euro gekostet.
Die Rechnung beglich demnach die LMBV…
…Die Wartung der Anlage habe die LWG Lausitzer Wasser GmbH übernommen…
…Die blaue Wasserleitung könnte nach Einbau neuer Regel- und Steuerungstechnik kontinuierlich Frischwasser liefern…. Peggy Kompalla
Quelle: zitiert aus lr-online, 13.06.2020
Ausführlich unter:
Trockenheit Cottbus reglementiert Wasserentnahme
Die Stadt Cottbus erlässt aufgrund der anhaltenden Trockenheit erneut ein Verbot zur Wasserentnahme aus der Spree. Allerdings bleiben Ausnahmen erlaubt.
 Aufgrund
der anhaltenden Trockenheit ist die Wasser-Entnahme aus der Spree, wie hier in
Cottbus, untersagt. Es gibt aber Ausnahmen. © Foto: Michael Helbig
Aufgrund
der anhaltenden Trockenheit ist die Wasser-Entnahme aus der Spree, wie hier in
Cottbus, untersagt. Es gibt aber Ausnahmen. © Foto: Michael Helbig
Die Stadt Cottbus wird erneut die Entnahme von Wasser aus der Spree und anderen Gewässern untersagen. Das kündigt Ordnungsdezernent Thomas Bergner (CDU) an.
Eine entsprechende Allgemeinverfügung über ein Verbot zur Entnahme von Oberflächenwasser werde am 20. Juni im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht und trete damit am 21. Juni in Kraft.
Dabei gehe die Stadt allerdings nicht so rigoros vor, wie etwa der Landkreis Elbe-Elster, der eine solche Allgemeinverfügung bereits erlassen hat.
Pumpen dürfen morgens und abends laufen
…. Der Ordnungsdezernent erklärt, wie dramatisch die Lage in der Spree ist.
„Wir haben seit zwei Jahren eine starke Trockenheit. In der Folge ist der Grundwasserpegel um einen halben Meter gesunken“, sagt er und fügt an:
„Das entspricht der Regenmenge eines ganzen Jahres.“ Insofern brächten die Regentropfen der vergangenen Tage kaum Linderung….
Nur sechs Kubikmeter in der Sekunde (in der Spree in Cottbus) ...
Anm.:
.. durch Einbeziehung von eingeleiteten Grubenwässer…
…„Der Durchfluss lag in der Vergangenheit im Durchschnitt bei gut zehn Kubikmetern in der Sekunde“, sagt Thomas Bergner.
„Jetzt können wir froh sein, wenn wir bei acht Kubikmetern landen, es sind aber meist eher sechs Kubikmeter in der Sekunde.“…
…Am 10. Juni betrug der Durchfluss 6,49 Kubikmeter pro Sekunde…
…Auch der Landkreis Spree-Neiße erlässt mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 12. Juni ein vorläufiges Wasserentnahmeverbot aus der Spree und ihren Zuflüssen von 8 bis 20 Uhr und 22 bis 5 Uhr. ..
Der Landkreis Elbe-Elster hat bereits die Wasserentnahme verboten. Auch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz wird mit Cottbus nun nachziehen…… Peggy Kompalla
le: zitiert
aus lr-online, 11. Juni 2020
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/trockenheit-cottbus-reglementiert-wasserentnahme-46928945.html
Trockenheit bringt steigende Sulfatwerte in Gewässern
Die anhaltende Trockenheit in Brandenburg hat nicht nur eine Wasserknappheit zur Folge - auch die Sulfatwerte in den Gewässern könnten ansteigen.
Darauf haben Umweltschützer hingewiesen. Sie sehen eine Gefahr für das Trinkwasser. Schon jetzt würden die Richtwerte überschritten, sagte Rene Schuster von der Grünen Liga der Deutschen Presse-Agentur.
Anm.: Eine Frage in diesem Zusammenhang an Herrn Schuster: Was schlägt der BUND denn vor außer Hysterie zu verbreiten.
…In diesem Jahr (2020) seien die im Sulfaterlass (???) festgeschriebenen 280 Milligramm pro Liter an mehr als 37 Tagen überschritten worden.
Der Trinkwassergrenzwert für Sulfat liegt nach Angaben des Landesamtes für Umwelt per Verordnung bei 250 Milligramm pro Liter im Reinwasser….
© dpa
Der Fluss Schwarze Elster.
…Grüne Liga, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Brandenburg und die Grünen fordern deshalb einen Nothilfeplan für das Land….
…Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) sind die Speicher und die Talsperre im Einzugsgebiet der Spree durch ausbleibende Niederschläge nicht vollständig gefüllt.
…Trotz der angespannten Wassersituation werde der Grenzwert von 250 Milligramm pro Liter aber eingehalten….
…Die Umweltschützer sehen für eine nochmalige Gefährdungsabschätzung keine Notwendigkeit…
..Die Leag verwies auf die Risikoabschätzung zur Sulfat-Betroffenheit der Wasserwerke, dass das Land in Auftrag gegeben hat.
…Es wird eingeräumt, dass die Bewirtschaftung der Abflüsse der Spree durch die unvollständig gefüllten Speicher in diesem Jahr angespannt sei.
…Der Durchfluss der Spree in Spremberg bestehe wie auch 2019 aktuell zu mehr als 50 Prozent aus Einleitungen von Sümpfungswasser der Leag. Da dieses Wasser naturgemäß höhere Sulfatgehalte besitze, welche sich großtechnisch nicht entfernen lassen, stelle die Steuerung der Abgaben der in den Speichern vorhandenen Mengen eine Herausforderung dar….
… Der BUND geht jetzt (07.06.2020) schon davon aus, dass die Sulfatwerte im Laufe des Sommers (2020) noch stark ansteigen und dauerhaft über dem Richtwert liegen werden….
Ausführlich unter:
Eine Anmerkung im Zusammenhang "Sulfatgehalt" und zur Kenntniserweiterung:
Sulfat : Grenzwert: 250 mg/l
„Sulfate sind natürliche Schwefelverbindungen, die z. B. als Calciumsulfat (Gips) in der Erdkruste weit verbreitet sind….
…Bei der Überschreitung des Grenzwertes im Trinkwasser muss durch das Gesundheitsamt geprüft werden, ob eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit zu besorgen ist.
In Abhängigkeit davon werden die notwendigen Anordnungen getroffen….
…Befristete Abweichungen vom Grenzwert können zugelassen werden.
Für die Zubereitung von Speisen und Getränken für Säuglinge und Kleinkinder ist
ein Trinkwasser zu verwenden, das nicht mehr als 500 mg/l Sulfat
oer ersatzweise abgepacktes Wasser mit der Kennzeichnung "geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung".
Quelle: https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/hygiene/trinkwasserqualitaet/untersuchungsergebnisse/sulfat/
Trotz Regen noch zu wenig Wasserr
Trockenheit Seit April (2020) muss mit Wasser aus der Talsperre Spremberg die Spree gestützt werden. In Sachsen fehlen Reserven.
Spremberg. Das Niederschlagsdefizit in Südbrandenburg liegt aktuell bei 375 Millimetern. Das entspricht einem halben Jahresniederschlag für die Station Cottbus.
Deshalb musste bereits im April (2020) mit der Stützung des Abflusses der Spree durch die Talsperre Spremberg begonnen werden.
…Das Absenkziel der Talsperre Spremberg für Ende Mai (2020) ist dadurch bereits zur Monatsmitte erreicht….
Durch die Trockenheit war im unteren Spreegebiet die vorgesehene Bewirtschaftung weiterhin nicht umsetzbar.
…Der Abfluss in der Spree am Unterpegel Leibsch beträgt 2,94 Kubikmeter pro Sekunde und liegt deutlich unter dem mittleren Abfluss für den Monat Mai von 9,37 Kubikmetern (pro Sekundee)…
Anm.:
…Die Talsperre Spremberg hat demnach einen aktuellen Beckenwasserstand von 91,79 Meter NHN (Normalhöhennull).
…Im oberen Einzugsgebiet der Spree in Sachsen blieben die Niederschläge weiterhin gering, wodurch Talsperren und Bergbauspeicher weiter nur eingeschränkt zur Verfügung stehen…. red/js
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 15.05.2020
Anhaltende Trockenheit - Die Lausitz verdorrt
Seit sechs Wochen kaum ein Regentropfen, dazu wolkenloser Himmel und permanenter Ostwind – es wird immer trockener zwischen Guben und Hoyerswerda.
Auch der Wasserspiegel des Cottbuser Ostsees sinkt. Das hat aber offenbar andere Gründe.

…Umweltexperten und Politiker sind alarmiert…t…
…. Eine länderübergreifende Arbeitsgruppe zur Situation an Spree und Schwarzer Elster hat zum Wochenbeginn (27.04.20202) getagt und die Lage sondiert…
Ihr Fazit: Im April sind lediglich fünf Prozent
…Laut brandenburgischen Umweltministerium haben die brandenburgischen Speicher, Talsperre Spremberg und Speicherbecken Niemtsch,
das Speicherziel nahezu erreicht haben, während in den sächsischen Talsperren Bautzen und Quitzdorf eine vollständige Wiederauffüllung nicht möglich war….
…Voraussichtlich werden nur sieben Millionen Kubikmeter Wasser zur Stabilisierung der Spree aus den sächsischen Speichern zur Verfügung stehen.n.
Sonst üblich sind 20 Millionen Kubikmeter….
Lage der Lausitzer Flüsse im Einzelnen
…Spree: Der Abfluss in der Spree am Unterpegel Leibsch beträgt aktuell 3,54 Kubikmeter pro Sekunde und liegt damit drastisch unter dem mittleren Abfluss für den Monat April von 22,3 Kubikmetern pro Sekunde.
Ab Anfang Mai wird die Abgabe der Talsperre Spremberg von aktuell 7 Kubikmeter pro Sekunde auf neun bis maximal 10 Kubikmeter pro Sekunde zur Stützung der Spree angehoben….
…Schwarze Elster: Hier bleibt die Lage unverändert schwierig. Der Wasserstand im Speicher Niemtsch (Senftenberger See) konnte nur durch konsequente Einspeicherung auf aktuell 98,93 Metern gehalten werden.
Zur Sicherung der Wasserqualität soll der Abfluss am Pegel Biehlen unterhalb von Senftenberg mindestens zwischen 0,7 bis 1,0 Kubikmeter pro Sekunde gehalten werden – normal sind im April rund 2,9 Kubikmetern pro Sekunde….
Talsperren Quitzdorf und Bautzen
…Die Talsperre Bautzen ist mit 31,45 Millionen Kubikmetern Wasser aktuell zu 83,5 Prozent gefüllt,
die Talsperre Quitzdorf am Schwarzen Schöps hat nur 40,5 Prozent Füllmenge (6,67 Millionen Kubikmeter anstelle von 16,48 Millionen Kubikmeter)…
…Das Wasser aus den Talsperren wurde schon in den Dürrejahren 2018/19 ausgiebig genutzt, um den Abfluss in der Spree bis zum Spreewald zu stützen…
… Durch die fehlenden Niederschläge konnten Defizite in den Talsperren nicht voll aufgefüllt werden, so dass 2020 noch weniger Wasser für die Spree zur Verfügung stehen wird…
Trockenheit als Problem für die Wirtschaft
…Bedeutende industrielle Standorte hingen von einer gesicherten Wasserversorgung ab, so etwa die Kraftwerke und die Standorte der chemischen Industrie, der Spreewald und die Wasserversorgung von Frankfurt Oder und Berlin…n…
…Der in der Lausitz momentan vor allem mit den trockenen Winden…n…
..Obwohl auf den Baustellen mehrmals täglich Tankwagen unterwegs sind, um die Fahrspuren der Fahrtrassen zu Uferbaustellen feucht zu halten, kommt es temporär und lokal zu Staubfahnen…
Bautzen, Hoyerswerda
…Nach Auskunft des Landesumweltamtes Sachsen macht sich die jahrelange Trockenheit auch im Bereich des Grundwassers bemerkbar: Derzeit unterschreiten etwa 90 Prozent der ausgewerteten 137 Messstellen im Freistaat den monatstypischen Grundwasserstand um durchschnittlich 57 Zentimeter. In den nächsten Tagen und Wochen rechnet das Amt mit weiter fallenden Grundwasserständen….
Wasserpegel im Cottbuser Ostsee sinkt
…Nachdem der Cottbuser Ostsee vor Wochen 414040 Prozent gesunken….
…Für René Schuster von der Umweltorganisation Grüne Liga (Anm.: Woher bezieht eigentlich René Schuster seine Kompetenzen zu fast allen Themen) ein dramatisches Signal,
immerhin seien in der Zwischenzeit Grundwasser aus der Umgebung und etwa 100.000 Kubikmeter Spreewasser in den See geflossen. …
…Seine (Anm.: …aber auch nur seine) Befürchtung: Folgen weitere Trockenjahre, entzieht der See seiner Umgebung deutlich mehr Grundwasser als bisher angenommen. (???)
…Nur etwa zehn Prozent des Wasserverlustes gingen auf das Konto der Verdunstung….
Prognose für das trockenste Szenario errechnet wurde…

Andrea Hilscher
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 28.04.2020
Ausführlich unter::::
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/anhaltende-trockenheit-die-lausitz-verdorrt-45804013.html
Anm.:
Zu diesem Thema passt der nachfolgende Artikel aus der Sicht eines Wasserwirtschaftlers wunderbar.
Immer wieder stellt sich die Frage: Gibt es keine Wasserwirtschaftler mehr ?.
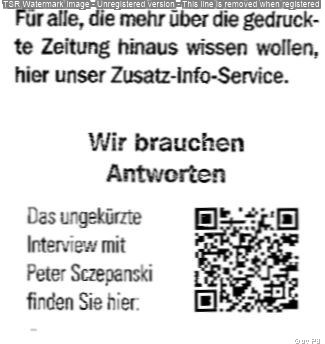
Anm.:
Anstatt schon die Antragsformulare für Dürrehilfen bereit zu legen,
sollte man sich auf die Traditionen bei der Bekämpfung von Trockenheit in der Landwirtschaft zurück besinnen.
Dazu der folgende Leserbrief:
Fregat half gut bei Dürre
Zu "Landwirte schlagen Alarm" und "Droht eine neue Dürre", LR vom 23. April (2020)..
Sie schreiben auf Seite 1 und Seite 3 (reicht nicht ein Artikel auf einer Seite?) über die Problematik der Trockenheit, die unseren Landwirten und Waldbesitzern schwer zu schaffen macht.
Trockenperioden hat es immer wieder gegeben und wird es sicherlich auch weiterhin geben. Mit Klagen ist aber nichts geändert.t.
Können sich die Landwirte an "Fregat" erinnern? Das waren Beregnungsanlagen, die überall auf den Feldern zum Einsatz kamen.
Die dazugehörigen Brunnenanlagen, wahrscheinlich wegen Nichtbenutzung unbrauchbar geworden, sind heute noch auf vielen Feldern zu sehen.
Eine Pumpenanlage, die Wasser von der Talsperre Spremberg auf die umliegenden Felder beförderte, existiert nur noch, wenn überhaupt,
als einsames Häuschen ohne Funktion am Nordstrand der Talsperre. Eine einsame Beregnungsanlage steht heute noch zwischen Peitz und Guben.
Es ist so wie mit vielen anderen Dingen, die nicht unbedingt schlecht waren: Das stammte aus der DDR, also abschaffen. Komme, was da wolle. Wilfried Jandke, Cottbus
Anmerkung der Redaktion (hier: Lausitzer Rundschau):
Fregat ist eine sowjetische Kreisberegnungsmaschine mit bis zu knapp 700 Meter Konstruktionslänge.
Angetrieben durch Hydromotoren bewegte sich der Regner um einen Befestigungspunkt und konnte viele Hektar anfeuchten. Eine Drehung dauerte bis zu sechs Tage,
(Anm. d. Red. Quelle: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung).
Quelle: Lausitzer Rundschau, 28.04.2020
Anm.:.:
Schon 2009 nach einem trockenen April hat ein Landwirt sich Gedanken gemacht,
wie mit sandigen Böden in Trockenperioden umzugehen ist.
Falls in Vergessenheit geraten, hier noch einmal der Artikel zu diesem Thema:
Landwirte im Trockenstress
Neue Ideen, Methoden und Pflanzen sind gefragt
REGION. Es war der wärmste und trockenste April (2009) seit Aufzeichnung der Wetterdaten. An trockene Sommer und nasse Winter müssen wir uns gewöhnen, sagen die Experten.
Lausitzer Landwirte stellen sich darauf ein.
Der Ruf nach Subventionen ist das eine, das andere sind neue Strategien, damit die Landwirte auch in den kommenden Jahrzehnten in der Lausitz ihr Auskommen haben.
Einer, der sich intensiv mit neuen Anbaumöglichkeiten befasst, ist Egon Rattei, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes und außerdem Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Forst.
2.200 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bieten neben der herkömmlichen Bewirtschaftung Platz für wissenschaftliche Versuche.
Experten der BTU Cottbus, der Universität Göttingen und des Zentrums für Agrarlandschaft- und Landnutzungsforschung Müncheberg testen den Pflanzenanbau auf sandigen Bödenen, die das Wasser kaum halten können.
Die Lausitz hat davon reichlich - rund 34 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Der "> Der Mais ist die Pflanze, an der sich das Dilemma bestens darstellen lässt. Als Futterpflanze oder Rohstoff für Bioenergie überaus beliebt, benötigt er viel Wasser.
Das heißt, für die vielbesungene Märkische Heide ist der Mais eigentlich nicht geeignet und wird doch vielerorts angebaut.
Für die sandigen Böden prädestiniert wären Roggen, Lupine oder auch Luzerne. Roggen jedoch bringt wenig Geld, Lupine wenig Ertrag.
Bleibt die Luzerne, die ein gutes Viehfutter ergibt und zudem noch klimagünstig ist, denn sie nimmt sich Stickstoff aus der Luft und trägt zum Abbau des klimaschädlichen Lachgases bei.
Davon lässt sich so mancher Landwirt überzeugen.
"Schwieriger ist es, wenn es um den Anbau untypischer Pflanzen geht", stellt Egon Rattei fest.
Auf Flächen bei Welzow laufen zur Zeit Versuche mit Energiehölzern wie Robinie und Pappel. "Mal sehen, was dabei herauskommt", ist er selbst gespannt. .
Eine weitere Richtung, die man seiner Meinung nach nicht verteufeln sollte, ist die Biotechnologie.
"International gibt es züchterische Erfolge bei Mais, Reis, Soja und Ölpflanzen, gerade in Bezug auf die Trockenverträglichkeit. Auch die deutschen Züchter sind dicht dran. Politisch ist das momentan aber sehr schwierig."
Daher setzt er mittelfristig erst einmal auf die dritte Säule, nämlich das regionale Wassermanagement.
Über's Jahr betrachtet habe die Niederschlagsmenge kaum abgenommen - von trockenen Jahren wie 2003 oder 2006 abgesehen.
Auffällig ist jedoch, dass die Sommerniederschläge abnehmen und die Winterniederschläge zunehmen. .
Deshalb müssen Lösungen gefunden werden, das Wasser im Winter zu speichern, um dann Trockenperioden wie jetzt im April 2009 (4,8 Liter/Quadratmeter zu 60,1 Liter im März 2009) überbrücken zu können.
In Zusammenarbeit mit dem Forster Boden- und Wasserverband sind schon einige Wasserläufe mit Stauwerken und Stützschwellen versehen worden, die das Wasser zurückhalten. Die Erfahrungen sind gut.
Wasserhaushalt
Eine Doktorandengruppe des Klimaforschungsinstitutes Potsdam begleitet diese Maßnahmen.
Vor allem aber ist der Umbau der Wasserläufe mit hohen Kosten verbunden. Hier fordert Egon Rattei die Hilfe der Landesregierung ein.
Seine Auffassung: Langfristig gesehen ist es besser, die regionalen Wasserkreisläufe zu stärken, die Biotechnologie zu fördern und trockenresistente Pflanzen anzubauen,
als in jeder Trockenperiode in Potsdam um finanzielle Überbrückungshilfen bitten zu müssen.
rka/möb
Quelle: Wochenkurier, 13. Mai 200909
Anm.:
Am 16.07.2019 griff die „Lausitzer Rundschau“ diese Thematik wieder auf.
Wahrscheinlich ist in dem Zeitraum von 2009 bis 2019 zu dieser Thematik recht wenig passiert.t.
Oder dieser Problematik ist bisher kaum Gehör geschenkt worden?
Zitat aus dem Artikel:
Zitat Anfang
„Alte Gräben für neue Ideen
„So etwas gibt es für die großen Seen und Flüsse. Für die landwirtschaftliche Nutzung aber gibt es dieses Wassermanagement bisher nicht.“
Viele Lausitzer könnten sich doch noch gut erinnern an die imposanten Beregnungsanlagen auf vielen Feldern. Allein um Naundorf wurden einst rund 1000 Hektar der Felder beregnet.
Die Anlagen verschwanden fast vollständig, als die Bauern mit der Wende in Ostdeutschland den Zugriff aufs Wasser nahezu komplett verloren und Bewässerung für sie damit unbezahlbar wurde. .
Unterirdische Leistungssysteme, die Grundwasser aus dem Filtersand am Neißeufer oder gar Wasser aus dem Klärwerk Forst einst zu den Ackerflächen leiteten, liegen seit fast drei Jahrzehnten trocken.
Auch durchzieht ein ausgeklügeltes Netz von Meliorationsgräben bis heute die Felder rund um die Neißestadt Forst.
„Ihre Bewirtschaftung ist bis heute einfach nicht geklärt“, erklärt Rattei.
Dabei könne in den Gräben in Regenmonaten problemlos wertvolles Wasser angestaut werden, das bei Trockenheit so dringend gebraucht werde.
Als Chef der Agrargenossenschaft Forst hatte der Naundorfer gemeinsam mit der Umweltorganisation BUND Uferbereiche einiger Gräben mit Schwarzerlen bepflanzt.
Die heute schon stattlichen Bäume spenden nicht nur Schatten und verringern so die Verdunstung. Gleichzeitig bremsen sie Windböen und verhindern die Erosion der leichten Ackerkrume.“.“
Zitat Ende
Ausführlich unter:r:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hier geht es chronologisch weiter:
In der Lausitzer Rundschau war am 04.06.2003 zur Niedrigwassersituation
in Brandenburg Folgendes zu lesen:
Dramatischer Wassermangel in Brandenburg
Land droht Gefahr der
Versteppung
POTSDAM. Trotz seines
Reichtums an Flüssen und Seen droht Brandenburg eine dramatische
Wasserknappheit. Die Stabilisierung des Landeswasserhaushalts sei eine der
größten Herausforderungen für die Region, sagte Umweltminister Wolfgang
Birthler (SPD) gestern in Potsdam.
Die Niederschläge lägen um etwa ein Fünftel unter dem bundesweiten Durchschnitt. Außerdem fielen sie
zunehmend ergiebiger im Winter als im Sommer. Langfristig könnte die Region versteppen.
Vor drei Jahren hatte Birthler eine Arbeitsgruppe eingesetzt und sie damit beauftragt, das Wasserangebot in Brandenburg zu analysieren. Detaillierte
Ergebnisse würden in Kürze vorgestellt.
Ursache für den
Wassermangelsei auch, dass das wertvolle Nass zu schnell abfließe. Deshalb komme es nun
darauf an, durch eine bessere Gewässerbewirtschaftung, das Wasser "länger
in der Landschaft zu halten". (Eig. Ber./thm/ta)
Brandenburg fehlt das Wasser
Niederschläge 20 Prozent unter deutschem Schnitt
Brandenburg, eigentlich das gewässerreichste Bundesland, droht in den nächsten Jahrzehnten eine Versteppung. Auf diesen Trend hat gestern Umweltminister Wolfgang Birthler (SPD) hingewiesen, der von einer "der größten Herausforderungen in Brandenburg" sprach. Die Experten seines Ressorts sehen wegen der zunehmend knappen Wasserressourcen bereits eine " wasserhaushaltliche Sondersituation " Brandenburgs in Deutschland.
VON THORSTEN
METZNER
Denn das Szenario
des märkischen Klimawandels spielt nicht in ferner Zukunft, sondern ist bereits
Realität. Der Grund: Seit Jahrzehnten nehmen die für die für die
Grundwasser-Neubildung entscheidenden Sommerniederschläge in der „märkischen
Streusandbüchse“ ab – so wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Die
Niederschläge in Brandenburg liegen laut Birthler bereits jetzt 20 Prozent
unter dem deutschen Durchschnitt.
Schon jetzt seien
die alljährlichen Niederschläge so gering wie in der sibirischen Waldsteppe,
in Spanien oder Mexiko, erläuterte Matthias Freude, Präsident des
Landesumweltamtes. So regnet es in der amerikanischen Prärie öfter als in der
Lausitzstadt Cottbus. Gleichzeitig sind die Temperaturen in Brandenburg in den
letzten vierzig Jahren um mehr als 1,5 Grad gestiegen, in Angermünde sogar um
3,5 Prozent (?).
Die Folge: Eine
negative Wasserbilanz in mehr als der Hälfte des Landes. Das heißt, es
verdunstet mehr Wasser als Grundwasser neu gebildet wird. Die Grundwasserstände
gehen landesweit bereits seit 1960 zurück. Aber auch die jahrzehntelangen
Meliorationsprogramme - 80 Prozent der 33 000 Fließgewässer sind solche
künstlichen Gräben - sowie in der Lausitz der Braunkohletagebau wirken sich
nach Einschätzung von Experten bis heute ungünstig aus, da sie das
Wasserdefizit
verstärken.
In der
Braunkohleregion besteht gegenwärtig ein Grundwasserdefizit von fünf bis
sieben Milliarden Kubikmetern, wobei das jährlich neugebildete Grundwasser bei
3,7 Milliarden Kubikmetern liegt.
Hintergrund
Steppe ist nicht Wüste
Um dem Trend der
Versteppung durch Wassermangel entgegenzuwirken, haben Experten bereits Szenarien entwickelt. So soll
versucht werden, die bislang abfließenden hohen Winterniederschläge
zurückzuhalten, die Grundwasserneubildung zu fördern.
Stauanlagen
sollen umgebaut, nicht mehr benötigte Entwässerungsgräben geschlossen werden,
um den Abfluss von Brandenburger Wasser zu bremsen.
Im Klimawandel
sieht Minister Birthler kein Horrorszenario: Steppe sei nicht Wüste.
0406031lr.rtf
Dazu eine Anmerkung
des Verfassers dieser Seite:
Eine effektive Grundwasserneubildung findet nur durch hohe Winterniederschläge statt; am günstigsten wirkt sich auf diesen Prozess eine relativ hohe Schneedecke, die langsam abtaut, aus.
Bei einer normalen jährlichen Verteilung der Niederschläge ist aus dem Gang der Grundwasserstände zu erkennen, dass fast ausnahmslos die höchsten Grundwasserstände
in den Monaten März / April und die niedrigsten in
den Monaten September / Oktober als Folge der Vegetation zu verzeichnen sind.
Insofern muss der
oben aufgestellten Behauptung: dass die Sommerniederschläge
für die Grundwasser-Neubildung entscheidendend sind
widersprochen werden.
Eine Maßnahme, um einen gewissen Ausgleich in der Wasserführung der Spree zu schaffen und zu erwartende negative Auswirkungen der Niedrigwasserperiode zu dämpfen:
Bericht
der Lausitzer Rundschau vom 12.06.2003:
Wasser aus Sachsen gegen die Ebbe in der Spree
Kostbares
Nass kommt aus zwei Talsperren
POTSDAM. Die
anhaltende Hitze und zu geringe Niederschläge haben den Wasserstand der Spree
dramatisch absinken lassen. Das in der Talsperre Spremberg gestaute Wasser
reiche nicht mehr aus, erklärte Jens-Uwe Schade vom Brandenburger
Umweltministerium gestern in Potsdam. Seit Anfang Mai seien 5,7 Millionen
Kubikmeter Wasser von der Talsperre in die Spree geleitet worden. Die Folge:
Der Wasserstand im Staubecken sinkt täglich um sechs Zentimeter . Deshalb
fordert Brandenburg "deutlich früher als im Vorjahr" Wasser aus
Sachsen an. Potsdam hatte vor drei Jahren mit dem Freistaat einen Vertrag über
den Bezug von jährlich bis zu 20 Millionen i Kubikmeter Wasser geschlossen. Bei
Bedarf können 16 Millionen Kubikmeter aus der Talsperre Bautzen und vier
Millionen Kubikmeter aus der Talsperre Quitzdorf bezogen werden. (Eig.
Ber./sm)
120603lr.rtf
Bericht
im WOCHENKURIER vom 23.07.2003:
Spree
und Neiße: Wasser muss her !
Fehlende
Niederschläge machen Brandenburgs Flüsse schwer zu schaffen
REGION. Nach der Jahrhundertflut im vergangenen Jahr kämpfen die Flüsse im Land Brandenburg nun mit einer beispiellosen Trockenperiode, die deren Wasserpegel von Tag zu Tag sinken lässt. Besonders stark davon betroffen sind Spree und Neiße. Guben meldete in der vergangenen Woche nur etwa 20 Zentimeter mehr als der historische Pegeltiefststand von 85 Zentimeter. Die Neiße bei Forst hatte einen Durchfluss von 6,7 Kubikmeter pro Sekunde - nur 0,3 mehr als der niedrigste je gemessene Wert. Doch welche Auswirkungen hat dieses extreme Niedrigwasser für unsere Flüsse ? Dazu befragte der WochenKurier Dr. Jens-Uwe Schade, Pressesprecher des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes.
Ob diese Methode hilft, die Wasserstände in den Flüssen anzuheben
?
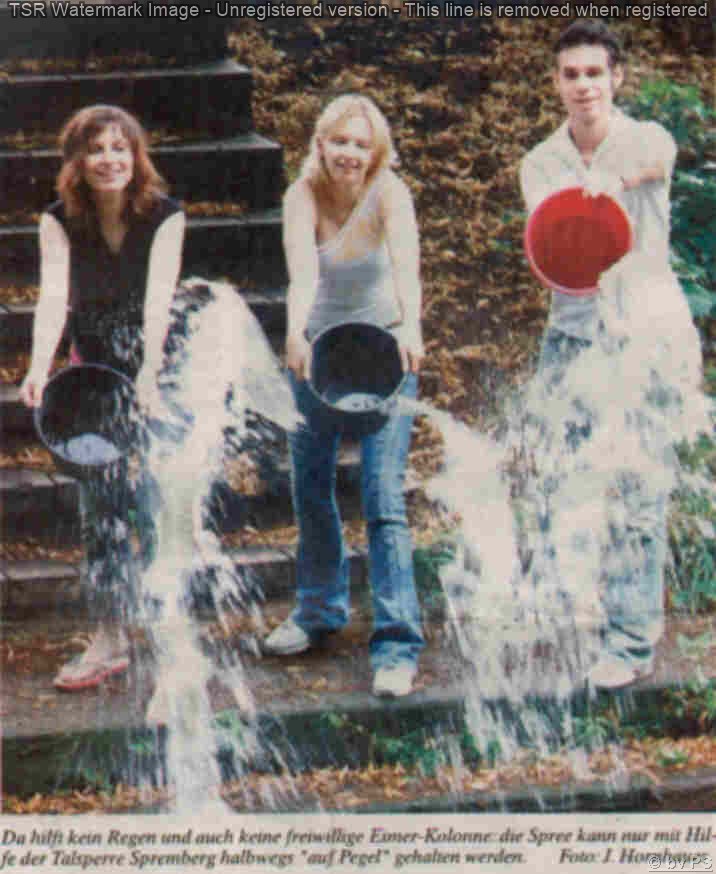
"Der Fluss stinkt!"
Brandenburg: "Das Hauptproblem ist, dass durch die geringen Pegelstände der Flüsse die Fließgeschwindigkeit herabgesetzt wird. Das führt zu einer schlechteren Wasserqualität und kann zur Vergiftung der Flüsse führen." Diese Vergiftung wird durch die vermehrte Produktion von Blaualgen hervorgerufen. Sie verursachen bei warmem Wetter wie in den vergangenen Tagen einen unangenehmen Geruch, der besonders an der Spree bei Spremberg einigen Anwohnern schon aufgefallen ist. „Im Rückblick betrachtet“, so Schade "haben wir die schlimmste Trockenheit der letzten Jahre. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.“
Das sieht auch
der Präsident des Landesumweltamtes Brandenburg, Prof. Mathias Freude so:
"Die Niederschläge der vergangenen Woche waren nichts weiter als der
berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Allein durch Regen werden Spree und
Neiße den Normalpegel nicht erreichen. Da braucht es schon mehr.“
Maßnahmen gibt es
viele. So zapft man für die Spree die Talsperre Spremberg an, die man im Winter
randvoll laufen ließ. "Ein Risiko, was sich jetzt ausgezahlt hat",
fügt Freude hinzu. Auch Wasser aus Sachsen hilft dabei, den Wasserpegel der
Brandenburger Flüsse halbwegs normal zu halten. "Trotz der ganzen
Einleitungen aus der Talsperre in Spremberg, der effektiveren Nutzung von
Wehren und Wasser aus Sachsen, ist die Lage angespannt", meint der
LandesumweltChef.
Fred Schimmank
ist Inhaber eines Fährhafens in Burg/Spreewald und lebt von der Spree. Er
schätzt die momentane Niedrigwasserlage nicht so dramatisch ein. "Dadurch,
dass der Wasserstand reguliert wird, hat das Niedrigwasser zum Glück im Moment
noch keine Auswirkungen auf unseren Kahnbetrieb."
Der Spreewald spielt auch bei der Frage, wie man solchen Niedrigwasserphasen in Zukunft besser entgegenwirken kann, eine wichtige Rolle. Dazu Schade: "Aus den Erfahrungen müssen wir lernen. Insbesondere Niedermoore und der Spreewald können mit ihrer Wasserspeicherkapazität dazu beitragen, dass sich der Wasserpegel auch bei Trockenperioden im Rahmen hält." Diese Maßnahmen können jedoch nur über einen längeren Zeitraum Wirkung zeigen.
Und so kann es
auch im nächsten Jahr wieder lauten: In Neiße und Spree - Wasser ade!
230703woku.rtf
Bericht der Lausitzer Rundschau vom 17.07.2003:
Flüssen der Region fehlt Wasser
Pegelstände von Spree, Neiße und Eibe nähern sich
historischen Tiefstständen
COTTBUS / POTSDAM / DRESDEN . Die Pegelstände der Flüsse in der Region nähern sich aufgrund der anhaltenden Trockenheit historischen Tiefstständen. Die Spree liegt derzeit noch zehn bis 20 Zentimeter von den tiefsten Werten seit Jahrzehnten entfernt. Bei Bad Muskau beträgt die Wassertiefe der Neiße noch 56 Zentimeter,
nur 30 Zentimeter über dem Tiefstwert. Während auf der
Oder bei einem Pegel von rund einem Meter (durchschnittlicher Juli-Wert 2,10
m) die Schifffahrt weitgehend eingestellt ist, verkehren auf der Elbe in
Dresden bei rund 80 Zentimetern keine Transportschiffe mehr. Die Weiße Flotte
kann Touristen nur noch eingeschränkt befördern.
"Nur länger anhaltender starker Regen kann die
fallende
Tendenz noch aufhalten", erklärt der Präsident des Brandenburger
Landesumweltamtes,
Matthias Freude, gegenüber der RUNDSCHAU. Da die Niedrigwasserstände der Flüsse
üblicherweise aber erst im August/September erreicht würden, müsse mit einer
dramatischen Situation gerechnet werden.
Der Wasserstand
der Spree könne noch bis Mitte August durch den Zukauf aus Sachsen und die
Talsperre Spremberg gut geregelt werden. " Wir brauchen aber auch die
Mithilfe der Spreewälder", mahnt Freude. "Ungebremst Flusswasser
zum Bewässern zu entnehmen, schadet bei der gegenwärtigen Verdunstung immens."
(Eig. Ber./ta)
170703.rtf
Einen
Überblick über die Situation bringt die Lausitzer Rundschau in ihrer Ausgabe
vom 26.07.2003
Peitzer Teichwirte
bereiten Notabfischen vor
Wasser aus
Sachsen hilft / Aus dem Spreewald fließt wenig Wasser ab / Mangel in der
Spree reicht bis in die Hauptstadt
Über 380 Kilometer schlängelt sich die Spree vom
Lausitzer Bergland nach Berlin. Überall zeigen die Pegel Niedrigwasser an. Der
Wassermangel ist in Teilen der Lausitz und vor allem in der Hauptstadt
spürbar. Tote Fische in den Kanälen oder wild wuchernde Algenteppiche rund um
die Museumsinsel das wäre keine schmeichelhafte Werbung für das neue Berlin.
Doch völlig aus der Luft gegriffen ist dieses Szenario nicht. Die Spree, warnen
Ökologen, leidet in diesem heißen Sommer unter einem Rekord-Wassermangel.
VON
WOLFGANG SWAT UND ULRIKE VON LESZCZYNSKI
Nur von
Stauwehren einigermaßen in Form gehalten, quält sich das Flüsschen im Schneckentempo
am Regierungsviertel vorbei bis zur Havel-Mündung. Auf längere Sicht könnte
Berlin mit seinem Fluss große Probleme bekommen - und Brandenburg erst recht.
Seit Wochen hängt der Fluss am Tropf der sächsischen
Talsperren, um den Wasserstand zu halten. Das Lausitzer Braunkohlerevier zapft
die Spree seit Monaten nicht mehr an, um seine Tagebaurestlöcher in
Freizeit-Seen zu verwandeln. Im Gegenteil. Fast 2000 Pumpen heben zur
Sicherung der Kohleförderung täglich rund 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser.
Damit werden die Kraftwerke Jänschwalde, Boxberg und Schwarze Pumpe, aber auch
die Spree versorgt. Der Spreewald lebt zu zwei Dritteln vom Grubenwasser. Noch
gibt es deshalb nach Auskunft des Tourismusverbandes Spreewald in Raddusch
keine Einschränkungen bei Kahnfahrten.
Kreuzgefährliche Situation
Die Wassernot ist dennoch spürbar, so bei den Peitzer Edelfischern.
"Die Wasserknappheit begann schon im Winter mit wenig Schnee und Kälte.
Jetzt im Sommer verschärft sich die Situation noch", schätzt Wilfried Donath, Geschäftsführer der Peitzer Edelfisch GmbH, ein. Seit Jahresbeginn sind in der Lausitz und in der Region Hoyerswerda und Weißwasser sowie in Teilen des EIbeElster-Landes erst ein Fünftel der sonst üblichen Niederschläge gefallen. In den insgesamt rund 1000 Hektar großen Peitzer Teichen fehlen 15 bis 20 Zentimeter an den normalen Teichhöhen. In anderen Teichen wie in Sergen, Eulo, Fürstlich Drehna sind nur ein Drittel der sonstigen Wassermenge drin. Der Kathlower Großteich mit seinen
35 Hektar Wasserfläche musste aus Not schon abgefischt werden.
Wilfried Donath bezeichnet die gegenwärtige Situation für die Binnenfischer,
die mit dem Spreewasser produzieren, als "kreuzgefährlich." Im
August könnte es bei anhaltend heißem Wetter zu weiterem Sauerstoffmangel in
den Teichen kommen. "Wir bereiten uns auf Notabfischungen vor. Allerdings
ist es schwierig, bei dem Wassermangel Teiche zu finden, wo wir die Fische
einsetzen können", beschreibt Donath die Lage. Außerdem ist die Zeit des
NotFischzuges
auf wenige Stunden am Morgen begrenzt. Später wird es zu heiß. Karpfen,
Forellen und andere Fische würden in den Netzen und Behältern qualvoll
ersticken.
" Wir tun in Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaft und Vattenfall alles,
um ein Notabfischen zu verhindern." Fischereichef Donath rechnet auf jeden
Fall mit Ertragseinbußen, weil die Fische bei sinkender Wassermene, steigender
Temperatur und abnehmendem Sauerstoffgehalt auch weniger fressen.
Die diesjährige
Situation zeigt, wie wichtig es ist, Wasser möglichst lange im Binnenland zu
halten, meint Donath. "Im Einzugsbereich der Spree in Sachsen und
Brandenburg gibt es Teiche von insgesamt 5000 Hektar Größe. Diese gut zu
füllen, ist von enormer Bedeutung", sagt der Fischerei-Chef.
Dabei ist die Lage an den Flüssen durchaus sehr
unterschiedlich. "Spree ist nicht gleich Spree“, beschreibt Dietmar
Steyer, Sachgebietsleiter Gewässergüte im brandenburgischen Landesumweltamt in
Cottbus, bildlich die verschiedenen Abschnitte. Die Wasserqualität wird ständig
überwacht. Im Flussgebiet in der Lausitz sind noch keine gravierend negativen
Auswirkungen erkennbar. "Noch ist ausreichend Sauerstoff im Wasser,"
erklärt der Cottbuser Laborchef des Landesumweltamtes, Hans-Joachim Mäder.
Wasser im Binnenland halten
Die Talsperre
Spremberg lässt nach Auskunft des Landesumweltamtes in Cottbus in diesen Tagen
mehr als neun Kubikmeter Wasser je Sekunde in den Fluss strömen. Die
Mindestabgabe
beträgt sieben Kubikmeter je Sekunde. Der Wasserspiegel des Sees liegt
gegenwärtig 80 Zentimeter unter der normalen Stauhöhe. Dass es nicht mehr ist,
ist der Wasserzufuhr aus der Talsperre Bautzen zu verdanken. Seit der
Vereinbarung zwischen Brandenburg und Sachsen, von dort 20 Millionen
Kubikmeter Wasser abzuleiten, sind seit Anfang Juni elf Millionen Kubikmeter
geflossen.
"Wir hatten
im Winter die Talsperre so gut es ging gefüllt. Das Wasser aus Sachsen wird
direkt weiter in die Spree geleitet", erklärt Dietmar Steyer .
Vor allem der Spreewald profitiert von diesem zusätzlichen Wasser. "Hier liegt aber auch der Knackpunkt," so Steyer. Von den über neun Kubikmetern, die je Sekunde in die Spreewaldarme strömen, fließen nur noch gut zwei Kubikmeter je Sekunde am Pegel in Leibsch aus dem Spreewald ab. Normal verlassen an dieser Stelle jede Sekunde mindestens
4,5
Kubikmeter Wasser die Lagunenlandschaft. Verdunstung
und Bewässerung nennt Steyer als Ursache für die enormen Verluste. Er
appelliert an die Spreewälder, "sehr verantwortungsbewusst mit dem Wasser
umzugehen".
In Berlin ist die Geschwindigkeit der Spree inzwischen nämlich fast bei Null angelangt - als normal gelten rund zehn Zentimeter pro Sekunde. "Selbst ein starker Gewitterregen bringt keine Abhilfe", sagt Eva Milbrodt vom Berliner Wasser- und Schifffahrtsamt.
In Brandenburg sieht Matthias
Freude, Präsident des
Potsdamer Landesumweltamts, bereits Fische und Muscheln bedroht.
Bei der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz verwahrt sich Wasseexperte Dietrich Jahn allerdings gegen Öko-Panikmache.
"Die Spree müffelt nicht und es werden auch keine toten Fische durch das Regierungsviertel treiben", betont er.
Ausgeprägte
Niedrigwasser-Perioden habe es
bereits vor 100 Jahren gegeben, nur die massenhafte Einleitung des abgepumpten
Tagebau-Wassers aus der Lausitz habe diese Tatsache bis in die 90er-Jahre
überdeckt."
Für den
Umweltforscher Norbert Walz vom Berliner Leibniz-Institut für
Gewässerökologie ist die dahindümpelnde Spree nicht nur das Ergebnis der
Hitzewelle. Menschliche Eingriffe in das Ökosystem, sagt er, machten dem Fluss
weit mehr zu schaffen. So litt das natürliche Wassersystem von der Regentschaft
des Alten Fritz angefangen bis hin zu DDR-Zeiten, damit Acker- und Grünflächen
entstehen konnten. Feuchtgebiete verschwanden, künstliche Gräben durchziehen
die Landschaft.
Die Natur rächt sich
Nun rächt sich
die Natur: Der Boden speichert weit weniger Wasser als früher, natürliche
Reserven für den Sommer gibt es kaum. Die Studie könnte vielen eine Warnung
sein: Sie stellt klar, dass Wassermangel für Wirtschaft und Landschaft ebenso
gravierende Folgen haben kann wie Hochwasser. Schon jetzt beziffert der Chef
des brandenburgischen Landesbauernverbandes, Udo Folgart, den Ernteschaden durch
Wassermangel auf 225 Millionen Euro. Nach Schätzungen des Landesbauernverbandes
in Sachsen stehen aufgrund von Dürreschäden ein Sechstel der etwa 6000
bäuerlichen Betriebe im Freistaat vor dem Aus.
Um das Öko-System Spree wieder ins Gleichgewicht zu bringen, fordern Ökologen ein Umdenken. Flüsse müssten renaturiert und Wasser gespeichert werden.
Die Zeit drängt: Das Potsdamer Klimaforschungsinstitut sagt voraus, dass die Sommer in Berlin und Brandenburg bis 2055 noch heißer und trockener werden.
260703lr.rtf
Die Situation im
Wasserhaushalt hat sich noch nicht verändert: Lausitzer Rundschau vom 23.08.2003
Talsperrenreserve in der Lausitz geht zur Neige
Wasserpegel im Stausee Spremberg um zwei Meter gefallen
Die Sommerhitze und die lang
andauernde
Trockenheit haben zu einem extremen Wassermangel in der Region geführt. Falls
es nicht regnet, wird die Talsperre Spremberg in wenigen Wochen kein Wasser
mehr in die Spree abgeben können. Brandenburg verhandelt deshalb mit Sachsen
über weitere Wasserlieferungen. 20 Millionen Kubikmeter flossen in diesem Jahr
bereits aus Staubecken des Freistaates nach Brandenburg.
VON SIMONE WENDLER
Seit Wochen fällt
der Wasserspiegel im Spremberger Stausee. Insgesamt sind es bisher zwei Meter und
es geht weiter , täglich um vier bis fünf Zentimeter. Das Wasser wird
gebraucht, damit der Spreewald nicht austrocknet. In etwa vier Wochen wird die
Wasserreserve des Spremberger Stausees jedoch erschöpft sein, sagt Matthias
Freude, Präsident des Brandenburger Landesumweltamtes (LUA): "Dabei
haben wir schon günstig gerechnet."
Eine Entspannung
der Situation könnten nur sehr ausgiebige und sehr lang dauernde Regenfälle
bringen. Da aber niemand weiß, ob und wann die kommen, verhandelt Brandenburg
erneut mit Sachsen, um zusätzliche asserlieferungen aus Talsperren des Freistaates
zu vereinbaren. Fünf Millionen Kubikmeter sollen abgegeben werden, doch noch
ist nichts perfekt. "Es gibt aber erste positive Signale aus Sachsen",
zeigt sich Matthias Freude optimistisch.
Vor zwei Jahren
hatte sich Sachsen bereit erklärt, zur Unterstützung der Spree in Brandenburg
20 Millionen Kubikmeter Wasser aus den Talsperren der Oberlausitz abzugeben. In
diesem Sommer wurde von diesem Angebot erstmals Gebrauch gemacht. Zurzeit
fließen pro Sekunde noch dreieinhalb Kubikmeter Wasser aus den Talsperren
Bautzen und Quitzdorf in Richtung Brandenburg. Die vereinbarte Gesamtmenge von
20 Millionen Kubikmetern wird in diesen Tagen erreicht
Doch in der Spree
sieht es schon jetzt schlimm aus. Aus dem Spremberger Stausee fließen zwar noch
siebeneinhalb bis acht Kubikmeter Wasser pro Sekunde in Richtung Spreewald,
doch hinter dem Biosphärenreservat kommt davon nur noch wenig an. Über den
Fließen ist die Verdunstung groß. Am Messpegel Leibsch bei Neu Lübbenau fließen
durchschnittlich nur noch knapp zwei Kubikmeter pro Sekunde vorbei. Aus
ökologischer Sicht wären für eine gute Wasserversorgung des Spreewaldes sieben
bis acht Kubikmeter pro Sekunde wünschenswert.
Zeitweise wurden
jedoch an dieser Stelle in den vergangenen zwei Wochen nicht mal mehr die zwei
Kubikmeter geschafft. "An einigen Tagen wurde schon weniger als ein
Kubikmeter gemessen", bestätigt der Chef des LUA, Matthias Freude.
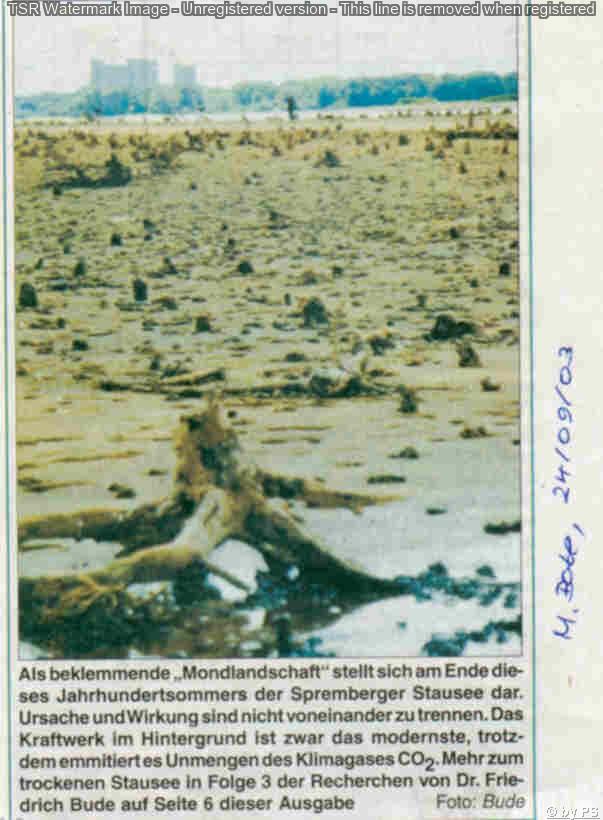
Spree
steht in Berlin still
In Berlin warnt
die Deutsche Umwelthilfe inzwischen vor einem Kollaps der Spree. In
Berlin-Mitte bewege sich der Fluss nur noch durch die Zufuhr von trübem
Abwasser, in Köpenick fließe er bereits rückwärts in Richtung Müggelsee, sagt
Martin Pusch vom Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei
in Berlin. Die Trinkwasserversorgung der Stadt ist jedoch trotz eines
historischen Tiefstandes der Spree nach Angaben der Senatsverwaltung nicht
gefährdet.
Dabei sah es im
Frühjahr mit der Spree noch sehr gut aus. Die Talsperren waren sehr gut
gefüllt, auch der Stausee in Spremberg. "Unsere Fachleute hatten da
hineingepackt, was nur ging" , sagt Freude, "den Leuten ist es zu
verdanken, dass jetzt überhaupt noch Wasser in der Spree fließt."
Keine
Tagebauflutung mehr möglich
Bei der Abwägung,
wovor man größere Angst habe, vor Hochwasser oder Dürre, habe man sich für die
Dürre entschieden und damit Recht behalten.
Denn die große
Hitze brachte die Spree bald schon in Bedrängnis. Schon Anfang Juni musste zusätzliches
Wasser aus den Talsperren in die Spree geleitet werden, um einen
Mindestdurchfluss
zu sichern.
Für die Flutung der Tagebaurestlöcher in der Lausitz wird schon seit Mitte April kein Liter Spreewasser mehr abgeleitet. Die Flutung der Gruben habe deshalb nichts mit dem derzeitigen Wassermangel zu tun, versichert Uwe Steinhuber, Sprecher der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Von Januar bis März seien in diesem Jahr auch nur 51 Millionen Kubikmeter Wasser in die Bergbaufolgelandschaft gepumpt worden, halb so viel wie im Jahr 2002.
Wissenschaftler warnen seit einiger Zeit vor einer langsamen Klimaänderung in
der Lausitz mit höheren Durchschnittstemperaturen und weniger Niederschlag.
Trotzdem könne man für die derzeitige kritische Situation der Spree nach
Überzeugung von Freude niemanden verantwortlich machen: "Wir wussten,
dass es eine Dürreentwicklung gibt, aber dass es so schnell und heftig wird,
konnte niemand ahnen."
230803lr.rtf
Was sagen die Experten zur
Situation: Lausitzer Rundschau vom 06.09.2003
„Was wir brauchen, sind drei Tage Landregen“
Niedrigwasser
der Spremberger Talsperre lockt Schaulustige / Noch keine dramatische Situation
BAGENZ.
Der schwimmende
Steg am Bagenzer Strand liegt auf Sand. Im See selbst haben sich Inseln
gebildet, auf denen Hundefreunde ihre Vierbeiner ausführen und
Mountainbike-Liebhaber tollkühne Kunststückchen ausprobieren. Sonntags machen
Familien auf dem inzwischen trockenen Seegrund Spaziergänge mit Kind und Kegel.
Boote liegen auf dem Trockenen, Sammler finden massenweise Muschein, aber auch
Krebs- und Fischkadaver. Was für die Ausflügler eine interessante neue
Erfahrung ist, bedeutet für das Naturbiotop auf die Dauer eine Belastung.
VON CHRISTIANE
BERTRAM
Grund allen Übels
- das Niedrigwasser der Spree nach der außergewöhnlichen Hitzeperiode in den
letzten Wochen. Man kann quasi zuschauen, wie das Wasser täglich um bis zu fünf
Zentimeter sinkt. Im "Prinzip waren die Niederschläge aber schon seit
Januar viel zu gering, als dass ein kontinuierlicher Wasserzu- und -ablauf der
Spree gegeben gewesen wäre", erklärt Eckhard Schaefer, Referent im
Landesumweltamt in Cottbus. "Auch die paar Tropfen momentan sind im Prinzip
bedeutungslos, was den Wasserhaushalt des Stausees betrifft. Wir bräuchten
jetzt einen dreitägigen ununterbrochenen Landregen, nur der könnte helfen. Aber
aus wasserwirtschaftlicher Sicht steht fest - die Lage ist noch nicht so
dramatisch, wie es vielleicht für viele Besucher und Anwohner aussieht."
Denn die
Talsperre erfüllt nun einmal die Funktion eines Speicherbeckens, und als
solches müsse eine Talsperre in Extremsommern wie dem diesjährigen auch an ihre
Grenzen kommen dürfen. Momentan steht das Wasser 2,20 Meter unter dem
Normalwert, eine Absenkung auf drei Meter wären ohne Weiteres verkraftbar,
rechnet Eckhard Schaefer vor. Und sogar dann sei ein nochmaliges Fallen um
einen halben Meter möglich.
Der Spremberger
Stausee hat ein Speichervermögen von 17 Millionen Kubikmetern Wasser. In
diesen Tagen sind es nur noch 3,5 Millionen Kubikmeter. Die Mindestabgabe von
sieben Kubikmetern Talsperrenwasser pro Sekunde in die Spree Richtung Cottbus
ist zurzeit auf 6,3 Kubikmeter je Sekunde reduziert worden. Das hat bereits
heftige Auswirkungen auf den Flussverlauf
Richtung Berlin. Und im Spreewald müssen erste Kahnfährbetriebe eine
Zwangspause einlegen und bestimmte Routen aus dem Programm nehmen.
Bleibt die Frage, ob das teuer eingekaufte Wasser aus Sachsen immerhin 20 Millionen Kubikmeter - nicht irgendwo Abhilfe schaffen könnte. "Dieses Wasser ist in diesem Jahr längst schon die Spree hinuntergeflossen", sagt Eckhard Schaefer. "Momentan hat Brandenburg bereits um weitere fünf Millionen Kubikmeter Wasser gebeten
beispielsweise aus der Talsperre Bautzen und aus sonstigen Reservoiren in Sachsen."
Doch je mehr
Zuleitungsquellen angezapft werden, desto ungünstiger könnte sich das auf die
Wassergüte auswirken. Wenn sich Sommer wie diese in Zukunft häufen, wird der
Anblick von Spaziergängern auf dem Talsperrengrund wohl keine Seltenheit mehr
sein.
060903lr.rtf
Wieviel Kubikmeter pro Sekunde in dieser Periode den Querschnitt der Spree durchfließen, kann nur durch exakte
Messergebnisse dokumentiert werden.

Auch der Herbst brachte mit seinen vergleichsweise geringen Niederschlagsmengen keine Entspannung der Situation
(s. LR, 11.12.2003)
Lausitzer Wasserspeicher füllen
sich nur langsam
Nach
extrem trockenem Sommer auch zu wenig Herbst-Niederschläge
Der Wasserhaushalt der Region bleibt vorerst
angespannt. Die Speicherbecken füllen sich nach einem extrem trockenen Sommer
nur langsam, weil die Niederschläge im Herbst ebenfalls zu niedrig ausfielen. Auch
der Grundwasservorrat ist noch immer zu gering. Ob und wieviel
Oberflächenwasser nächstes Jahr wieder für die Restlochflutung
bereitgestellt werden kann, ist deshalb noch fraglich.
VON SIMONE WENDLER
Wasserfachleute in
der Lausitz hofften in den extrem heißen und trockenen Wochen des vergangenen
Sommers, dass es wenigstens im Herbst lange und ausdauernd regnen würde, damit
sich der Wasserhaushalt der Region wieder normalisiert und sich die
Speicherbecken
zügig füllen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Auch Oktober und November
brachten nicht die erwarteten und dringend notwendigen Niederschläge.
Am Messpunkt der Außenstelle Cottbus des Landesumweltamtes Brandenburg (LUA) gingen im Oktober nur
91 Prozent soviel
Niederschläge zu Boden wie im langjährigen Durchschnitt.
Im November blieb die Regenmenge mit nur 75 Prozent vom Durchschnittswert noch
weiter zurück. Schon heute kann Wolfgang Genehr, Referatsleiter
Wasserwirtschaft der LUA-Aussenstelle, mit Sicherheit sagen, dass insgesamt in
der Region nur 68 Prozent der durchschnittlich beobachteten Niederschlagsmenge
erreicht werden.
Verglichen mit
den Sommermonaten seien der Oktober und November "nicht schlecht"
gewesen, so Genehr , doch um das vorhandene Wasserdefizit in der Region
aufzufüllen, sei es viel zu wenig. "Das Jahr geht viel zu trocken zu
Ende", so seine Bilanz.
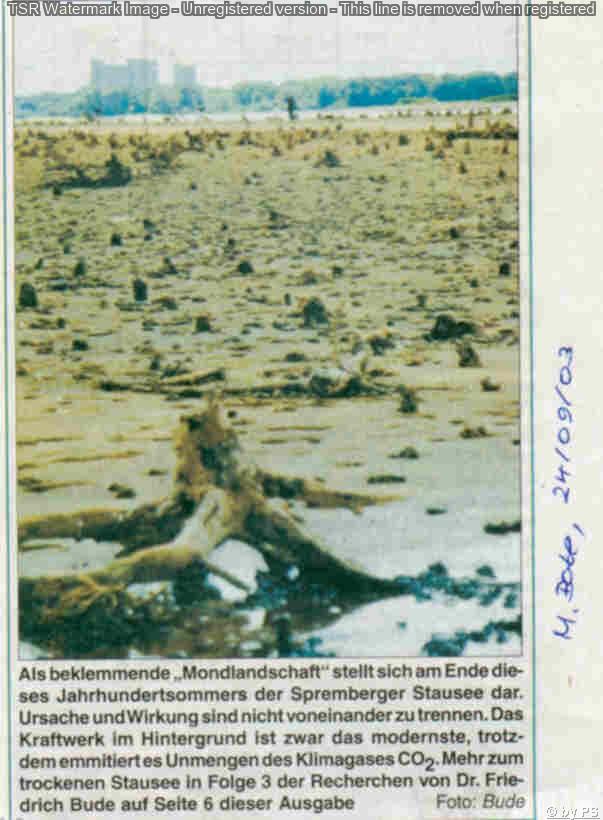
Hoffen
auf nassen Winter
Das hat Folgen.
Die Vorratsspeicher in der Region für das lebensnotwendige Nass füllen sich zur
Zeit nur sehr langsam wieder. Der Spremberger Stausee hat nach Auskunft von
Wasserfachmann
Genehr erst wieder ein Drittel seines Speichervolumens erreicht, der
Senftenberger See sogar nur ein Viertel der Vorratshaltung. Zwei Kubikmeter pro
Sekunde werden zur Zeit von dem aus Sachsen in die Region fließenden Wasser in
den Speichern zurückgehalten. "Wenn der Winter nicht nass wird, dann wird
es eng", befürchtet Genehr, der doch noch hofft, im Frühjahr mit
randvollen Speicherbecken dem nächsten Sommer entgegen zu gehen.
Bis in den
September hinein, länger als jemals zuvor, kam die Niederlausitz ohnehin nur
durch zusätzliche Wasserlieferungen .aus sächsischen Speicherbecken über die
Runden. Dort bleibt die Wassersituation jedoch ebenfalls vorerst angespannt.
Die Flüsse und Bäche im Freistaat führen nach Auskunft des sächsischen
Umweltministeriums erheblich weniger Wasser als normaler Weise um diese
Jahreszeit. Die Grundwasserstände seien wie in Südbrandenburg erheblich
gesunken. Auch in der Oberlausitz regnete es im November viel weniger als
erwartet. In Görlitz gingen im Vormonat nur zehn statt der üblichen 51
Millimeter Regen nieder, in Zinnwald waren es nur zwölf statt 82 Millimeter.
Die Speicherbecken im Freistaat sind bisher ebenfalls nur zu zwei Dritteln
gefüllt.
Fraglich ist angesichts dieser Situation, wieviel Oberflächenwasser im nächsten Jahr für die Flutung der Tagebaurestlöcher in der Lausitz zur Verfügung stehen wird. In diesem Jahr musste die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) durch die extreme Trockenheit bereits auf 120 Millionen Kubikmeter Flutungswasser verzichten, mit dem geplant worden war. "Wir sind zuversichtlich, dass wir im Frühjahr wieder fluten können", gibt sich Klaus Zschiedrich, Bereichsleiter Ingenieurwesen bei der LMBV, optimistisch. Inzwischen seien auch neue Überleitungssysteme im Bereich Schwarze Elster fertiggestellt, sodass auch kleinste Hochwasserspitzen, die nur wenige Tage dauern, für die Restlochflutung vollständig genutzt werden könnten. Eine dieser Überleiter ist der neue Kanal bei Geierswalde in der Nähe von Senftenberg, der am Dienstag eingeweiht wurde. Er gestattet künftig Wasser vom Geierswalder in den Partwitzer See zu leiten. Ab Januar sei es nun auch möglich, bei entsprechendem Angebot Neißewasser in die stillgelegte Grube Berzdorf in der Oberlausitz zu schicken. Bisher gab es dafür ein technisches Hindernis. Für die Einleitung ist eine bestimmte Füllhöhe des Grubenwassers notwendig, die erst jetzt erreicht wurde. Eine Verschlechterung der Wasserqualität in den Tagebaurestlöchern durch die weitgehend ausgebliebene Flutung mit Oberflächenwasser im zu Ende gehenden Jahr sei nicht zu befürchten.
Spreewald
leidet
Matthias Freude,
Präsident des Brandenburger Landesumweltamtes, blickt derzeit in Sachen
Wasserhaushalt der Lausitz noch sorgenvoll in die Zukunft. Schon das Jahr 2000
sei sehr niederschlagsarm gewesen. Nur weil man die regionalen Wasserspeicher
im Frühjahr 2003 etwas über das eigentlich zulässige Maß gefüllt habe, sei es
möglich gewesen, sich überhaupt durch den vergangenen Sommer
"durchzumogeln". Landschaften wie Moorgebiete litten erheblich unter
dem seit Jahren sinkenden Grundwasser. Auch die Natur im Spreewald wurde
durch die Wasserknappheit der vergangenen Jahre strapaziert.
Alles, was in den
kommenden Wochen an Wasser in der Region ankommt und aus den Flüssen abgezweigt
werden kann, muss erst mal in die Speicherbecken. Daran lässt der Präsident des
Brandenburger Landesumweltamtes keinen Zweifel. Erst wenn die Becken reichlich
gefüllt seien, könne der Hahn für die Grubenfüllung wieder geöffnet werden.
"Man muss sich darauf einstellen, dass sich die ganze Flutungsplanung noch
zeitlich nach hinten verschieben kann", warnt Freude.
111203lr.rtf
Welche Auswirkungen eine Dürreperiode noch haben kann, zeigt der
nachfolgende Überblick:
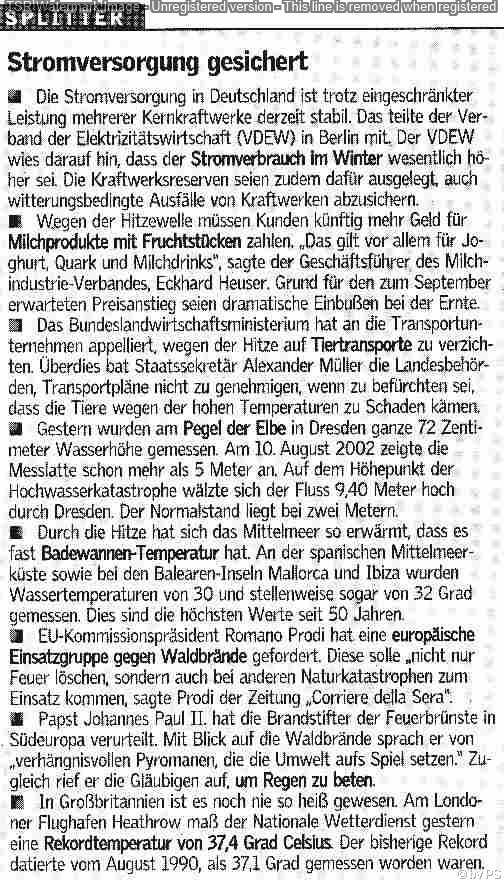
Quelle: Lausitzer Rundschau, 11.08.2003
Der folgende Auszug ist dem Beitrag unter der Überschrift „Bauern der Region hoffen auf mehr Regen“, erschienen in der
„Lausitzer Rundschau" vom 09.02.2004, entnommen:
„... Ein
Wetterumschwung mit strengen Frösten ohne Schnee ist gegenwärtig die größte Sorge
der Bauern. "Kahlfröste würden den Wintersaaten schaden", begründet
Gerhard Kockert aus Wittichenau.
Schnee, durchaus auch mit etwas Kälte, und Regen wünschen sich die Landwirte.
"Das
Wasserdefizit ist noch längst nicht ausgeglichen, so Kockert. Trotz überreicher
Niederschläge im Januar sei das Regen-Defizit noch hoch, stellt
Agrarmeteorologin Brigitte Klante vom Deutschen Wetterdienst fest.
200 Liter pro Quadratmeter fehlen örtlich, um die noch tief im Bodensteckende Trockenheit auszugleichen, schätzt sie ein. Februar und März müssten, gemessen am langjährigen Mittel, zu nasse Monate werden, um die Wasservorräte aufzufüllen. (Anmerk. d. Verfassers: Stand Februar 2004)
"Diejenigen,
die nur Sonnenschein wollen, würden verhungern", gibt die
Agrarwetter-Expertin Regenmuffeln mit auf den Weg. ...“
090204lr.rtf
Aus dem oben Geschriebenen ist
ersichtlich, dass sich das Thema „Niedrigwasser“ noch lange nicht erledigt hat.
Damit sich die Niedrigwassersituation weiter entspannt, hoffen wir auf „maßvolle“ Winterniederschläge !
In den Jahren 2004 und 2005 gab es einen fast ausgegelichenen Wasserhaushalt. Das Grundwasserdefizit hatte
sich auf aufgrund der für unsere Breiten großen Schneemengen im Winter 2005 / 2006 stabilisiert.
Aber im Juni 2006 erreichte Deutschland eine Hitzewelle, deren Auswirkungen gegenwärtig in
der Wasser- und Landwirtschaft zu spüren sind. (Stand: 22.07.2006)
Headline der Lausitzer Rundschau vom 20.07.2006
Heute 38 Grad - heiß, heißer, Lausitz
Spree fehlt Wasser / Mehrere Brände
COTTBUS. Brütende Hitze in der Lausitz: Heute steht der vorläufig heißeste Tag des Jahres bevor. Die Temperaturen sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Potsdam bis auf 38 Grad steigen. Waldbrände und Wassermangel in der Spree gefährden die Region.
'Bereits gestern erreichten die Temperaturen vielerorts neue Jahres-Höchststände. Angesichts von Hitze und Trockenheit befürchten Landwirte erhebliche Ernteausfälle. Mit Einbußen bis zu 60 Prozent ist zu rechnen.
Die Spree führt nach Angaben des Brandenburger Landesumweltamtes unterhalb des Spreewaldes so wenig Wasser, dass sie kaum noch fließt und seltene Flussmuscheln bedroht sind.
Bei Luckau (DahmeSpreewald), Drebkau (Spree-Neiße) und Hennersdorf (Elbe-Elster) brannten Getreidefelder und Wald. Bei Pinnow (Spree-Neiße) ging ein munitionsbelastetes Waldstück in Flammen auf. (Eig. Ber./roe/sim)
Heute in der Lausitz bis zu 38 Grad schreibt die Lausitzer Rundschau vom 20.07.2006
Gewitter kaum in Sicht / Ozonwerte steigen / 13 Hitzetote in Europa
BERLIN, Rekordtemperaturen, Ozon-Höchstwerte, Waldbrände und Hitzetote: In vielen europäischen Ländern wird die Hitzewelle zur Plage, Die Deutschen schwitzen bei extremer Sommerhitze - und es soll in den nächsten Tagen noch heißer und schwüler werden.
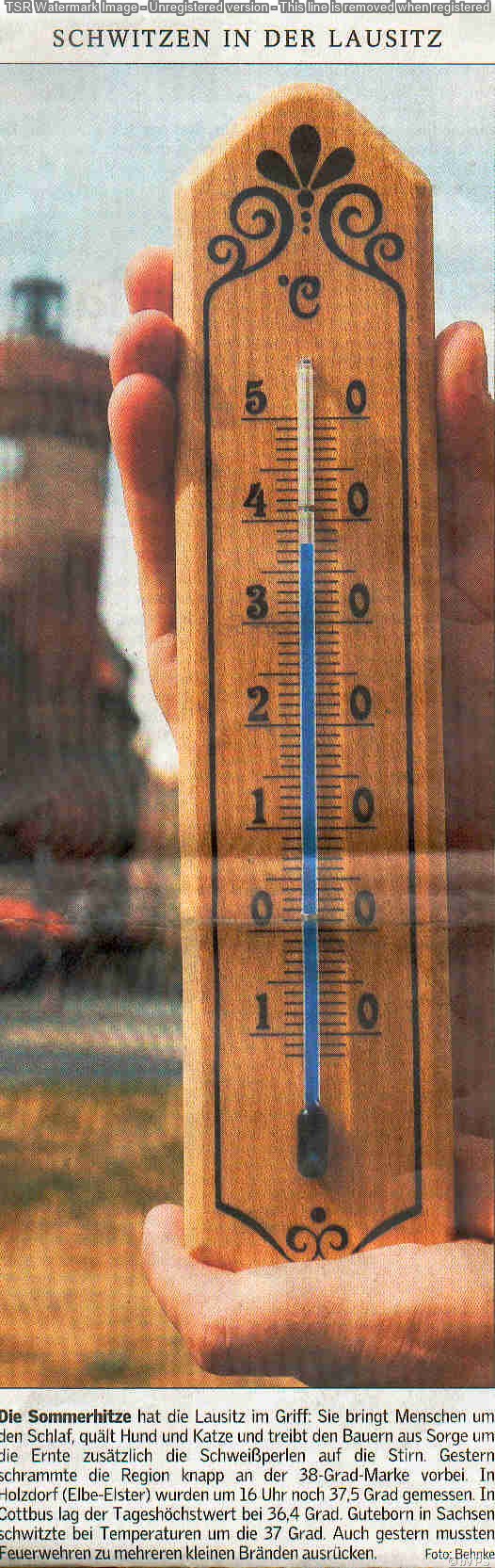 "Deutschland
hat Fieber", sagte der Wetterexperte Jörg Kachelmann gestern (19.07.2006).
"Deutschland
hat Fieber", sagte der Wetterexperte Jörg Kachelmann gestern (19.07.2006).
"Der Sommer 2006 liefert sich im Augenblick ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Rekordsommer 2003. "Die Hochs "Bruno" über Südosteuropa und "Claus" über Skandinavien vereinigen sich zu einer ausgedehnten Hochdruckzone. Diese schwächt sich allmählich etwas ab, bringt Berlin und Brandenburg aber weiterhin viel Sonnenschein. Die Hitzewelle setzt sich heute fort, es wird sogar noch etwas heißer. Mit 35 bis 38 Grad erreichen die Temperaturen verbreitet neue Höchstwerte für 2006, am heißesten wird es vom Fläming bis zur Lausitz.
Die höchste je in Brandenburg gemessene Temperatur liegt bei 39,8 Grad dieser Wert wurde am 9. August 1992 in Lübben (DahmeSpreewald) erreicht.
Lausitzer
Rundschau, 20.07.2006
Lausitz stöhnt unter Sahara-Temperaturen
Hitze bringt Spree in Not
Kaum Wasser im Unterspreewald / Pflanzen und Tiere bedroht
Das Brandenburger Landesumweltamt (LUA) schlägt Alarm. In der Spree fließt so wenig Wasser, wie seit dem Rekordsommer 2003 nicht mehr. Im Unterspreewald bewegt sich der Fluss kaum noch. Der Wasserstand dort ist sogar noch niedriger als vor drei Jahren. Ursache sind nicht nur die große Hitze und der Niederschalgsmangel. Spendable
Gartenbewässerung unterhalb der Talsperre Spremberg tut ihr Übriges.
VON SIMONE WENDLER
Leibsch bei Neu Lübbenau im Unteren Spreewald ist für die Wasserexperten des Brandenburger LUA ein wichtiger Ort. Hier befindet sich ein Messpunkt, an dem mindestens zwei Kubikmeter kühles Nass pro Sekunde vorbeifließen müssen, damit es der Spree auf dem Weg nach Berlin noch gut geht. Doch von zwei Kubikmetern pro Sekunde können die Fachleute im Moment nur träumen. Gemessen wird weniger als die Hälfte. Nur 0,7 Kubikmeter plätschern in Leibschnoch vorbei.
Die Auswirkungen auf sensible Pflanzen und Fische sind gravierend. Unterhalb des Spreewaldes leben bei Kossenblatt zwischen Neuendorfer und Schwielochsee 20 Millionen kleine und zwölf Millionen große Flussmuscheln in der Spree, die das Wasser reinigen. "Die sind durch den aktuellen Wassermangel bedroht, weil dort fast nichts mehr fließt", sagt LUA-Präsident Matthias Freude. Weiter in Richtung Berlin musste acht Kilometer Flusslauf für den Bootsverkehr gesperrt werden. "Da ist eine Schleuse dabei, die sonst pro Tag hundert Boote passieren", erklärt Freude.
Nur mit der Hitze sind die Probleme nicht zu erklären. An der Talspere Spremberg werden rund zehn Kubikmeter pro Sekunde losgeschickt, von denen noch sieben am Eingang des Spreewaldes ankommen. Die verschwinden jedoch fast vollständig in der Lagunenlandschaft. Über den Fließen verdunsten jedoch auch bei großer Hitze nur drei bis vier Kubikmeter Wasser pro Sekunde. "Großzügige Gartenbewässerung", so die Vermutung des LUA-Chefs, könnte das folgenreiche Verschwinden der restlichen Wassermengen erklären.
Tourismus auf Fließen gefährdet
"Wenn es so weitergeht, dann bekommt der Tourismus im Spreewald ein Problem", warnt Freude. "Wir können deshalb nur dringend an die Leute appellieren, das Gartenwässern auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken." Zwar dürften Anlieger im Spreewald durchaus Wasser aus den Fließen für ihre Gärten nutzen, aber nur, wenn genug da ist. Das sei definitiv nicht der Fall. Wer sonst Wasser aus der Spree abzapfen will, braucht dazu eine Genehmigung der unteren Wasserbehörden. Die machen jetzt verstärkt Kontrollen, um illegalen Pumpen auf die Spur zu kommen.
Im Spremberger Stausee, der für die Spreeregulierung entscheidend ist, können 17 Millionen Kubikmeter Wasservorrat eingelagert werden. Ein Drittel davon ist bereits verbraucht, um den Spreewald ausreichend feucht zu halten. Seit einer Woche werden aus der sächsischen Talsperre Bautzen 4,7 statt knapp drei Kubikmetern Wasser pro Sekunde abgelassen, um Brandenburg zu helfen. " Wenn es so extrem trocken bleibt, brauchen wir noch mehr Hilfe aus Sachsen", sagt Ernst Hanuschka von der Regionalabteilung Süd des LUA in Cottbus.
Seit 2001 hat Brandenburg mit dem Freistaat ein Abkommen, wonach bis zu 20 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr aus den Oberlausitzer Speichern nach Brandenburg abgegeben werden können, um die Spree zu stabilisieren. Doch in der Talsperre Bautzen fällt inzwischen auch der Wasserspiegel. Vor einer Woche lag der Füllstand bei 85 Prozent, jetzt sind es nur noch 78. Beigleich bleibender Abgabemenge Richtung Brandenburg reicht der Vorrat nach Auskunft der sächsischen Talsperrenverwaltung noch bis Ende August.
Seit April hat es in der Niederlausitz kaum geregnet. Der wenige Niederschlag, auch die Gewittergüsse vor wenigen Tagen" habe nur die Erdoberfläche befeuchtet und sei gleich von den Pflanzen verbraucht worden, sagt Ernst Hanuschka: "Davon ist nichts ins Grundwasser gegangen." Für LUA-Chef Freude und den Cottbuser Wasserfachmann Hanuschka ist die Situation jetzt ähnlich dramatisch wie im Sommer 2003. Mehr als 20 Millionen Kubikmeter Wasser aus sächsischen Talsperren waren damals notwendig, um der Spree durch den extrem heißen und trockenen Sommer zu helfen. In Berlin wurde der Fluss vor drei Jahren für einige Wochen zum stehenden Gewässer, obwohl im Frühjahr des gleichen Jahres die Spremberger Talsperre einen maximalen Füllstand aufwies.
Tagebauseen-Flutung gestoppt
Seit Anfang Mai dieses Jahres ist bereits wieder die Flutung der Tagebaurestseen in der Lausitz gestoppt. Im Frühjahr konnten jedoch durch die reichliche Schneeschmelze 100 Millionen Kubikmeter Wasser in die Restlöcher gepumpt werden. "Das ist relativ gut", so die Einschätzung von Günter Wannack von der Flutungszentrale der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- VerwaltungsgesellschaftmbH (LMBV) in Senftenberg. Er kann auch deshalb gelassen bleiben, weil 2005 das bisher beste Flutungsjahr war. Fast 200 Millionen Kubikmeter Flusswasser konnten im Vorjahr in die neuen Lausitzer Seen umgeleitet werden.
Auch
das ist einmal interessant ... Lausitzer Rundschau, 21.07.2006;:
In
der Lausitz scheint es derzeit am heißesten in Deutschland
zu sein
Der heißeste Tag des Jahres in der Wetterwarte Cottbus
Wann kommt endlich die erhoffte Regenwolke?
Der Deutsche Wetterdienst betreibt landesweit 68 Wetterstationen, die rund um die Uhr besetzt sind. Eine davon steht
in Cottbus am Meisenweg. Hier wird seit 1946 kontinuierlich gemessen. gestern erwarteten die meteorologen den heißesten Tag des Jahres. Schon die Tagesanfangswerte aus der Nacht zum Donnerstag standen auf Rekordniveau.
VON CHRISTIAN MATHEA
Das Büro steht voller Computer, die Jalousien sind heruntergelassen und der Ventilator läuft auf Hochtouren. Die Sonne musste gestern draußen bleiben. So waren die beiden Wetterwächter Mario Fellmann und Carsten Schneider ideal auf den heißesten Tag des Jahres vorbereitet.
Erste Messung um 10 Uhr: 29 Grad. Das sind genau zwei Grad wärmer als am vergangenen Mittwoch um die gleiche Zeit. Das Thermometer steht natürlich draußen.
"In einem weißen Kasten auf zwei Meter Höhe mit Tür nach Norden", erklärte Meteorologe Carsten Schneider. "Das ist durch die World Meteorological Organization in Genf so vorgeschrieben." Der 42-jährige arbeitet seit mehr als 20 Jahren an der Wetterstation im Meisenweg. Sie ist eine von 68 durchgängig besetzten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes. Täglich werden hier neben Temperatur auch Niederschlag, Luftdruck, Windstärke und Sicht gemessen. "Wir müssen auch die Wolken beobachten und deren Struktur einschätzen", so Schneider.
Aber richtige Regenwolken sehen die beiden Wetterbeobachter aus Cottbus im Sommer nur selten. Das sei einerseits durch den starken kontinentalen Einfluss zu erklären.
Heranziehende Tiefdruckgebiete aus West oder Südwest würden durch ein stabiles, Hochdruckgebiet über Cottbus meist nach Norden weggedrückt. Die stabilen Hochdruckgebiete über der Lausitz würden langsamer als anderswo nach Osten weiterziehen.
Andererseits ist es laut Schneider für lokale Wärmegewitter zu trocken: "Die Luft kann sich nicht
genügend mit Wasser aufladen." In Berlin sei das anders, die vielen Seen' sowie sowie die Hitze und die Staubteilchen über der Stadt könnten schneller zu lokalen Wärmegewittern führen.
"Aber vielleicht ändert sich die Lage in Cottbus durch die neuen Seen, die hier mal entstehen sollen", fügt sein Kollege Mario Fellmann bei.
Mittlerweile ist es zwölf Uhr. Carsten Schneider geht zum Thermometerkasten und liest ab: 34 Grad. Das sind sogar vier Grad mehr als gestern. Obwohl die Sonne jetzt im Zenit steht, soll es im Laufe des Tages noch heißer werden. Denn zusätzlich zur Sonneneinstrahlung heizt sich tagsüber die Erde auf.
Die beiden Meteorologen tragen ihre Messwerte ständig in einen Computer im Büro ein. Einmal pro Tag lädt der Großrechner aus der Zentrale in Offenbach die Daten zu sich herüber. "In Zukunft werden wir auch ein Radar in Cottbus haben", freut sich Schneider.
In ganz Deutschland gibt es bisher nur 16 solcher Anlagen. Vom Boden werden Radarwellen in den Himmel geschossen und von den Wolkenschichten reflektiert. Dadurch lassen sich Angaben über Wolkengröße und Wolkendicke machen.
Der Deutsche, Wetterdienst hat sich zwar auf Unwetterwarnungen spezialisiert, aber dem einen oder anderen Anrufer helfen die beiden Meteorologen auch mal mit einem kleinen Wetterbericht weiter: "Normalerweise machen wir das nicht, nur wenn uns ein Kindergarten oder ein Partyveranstalter zwei Stunden vor der Feier fragt, ob es gleich Regen geben wird", sagte Schneider.
Gestern machten sie eine kleine Ausnahme und zeigten der RUNDSCHAU, woran man das Wetter der weiteren Zukunft erkennen kann. Dafür schauten sie sich die Satellitenbilder und die Radaraufnahmen an: "Von Westen kommt eine Tiefdruckzone und das stabile Hochdruckgebiet über unserer Region zieht langsam nach Osten weiter", erklärte Fellmann die vielen Striche und Farbpunkte auf dem Bildschirm. "Heute zeigt das Satellitenbild und das Radar schon eine Regenfront über Frankreich. Freitagabend müsste es höchstwahrscheinlich regnen." Als Nächstes analysierten die Meteorologen das Isobarenbild, das Luftmassen mit gleichem Druck zeigt. Danach ist das nächste Hoch mit dem gewohnten Sommerwetter schon im Anmarsch. Spätestens am Montag wird es seinen angestammten Platz über Cottbus einnehmen.
Inzwischen schlägt der Wecker in der Wetterwarte 18 Uhr. Das Außenthermometer zeigt 36,3 Grad. Damit wurde zwar nicht die 37 geknackt, aber eins ist sicher: Gestern war der heißeste 20. Juli seit Messbeginn im Jahre 1946.
Und noch etwas: Nimmt man den Durchschnitt aller bisherigen Julimonate von 1960 bis 1990, wäre der jetzige Juli um wahrscheinlich mehr als vier Grad wärmer als der Durchschnitt und so einer der drei heißesten Juli in den letzten 60 Jahren.
Unter dem Titel "Hitze-Sommer trocknet die Lausitz aus" ist in der "Lausitzer Rundschau" vom 26.07.2006 zu lesen:
Erste Notabfischungen in der Region
COTTBUS. Anhaltende Hitze trocknet Flüsse und Teiche in der Lausitz aus. Teichwirte mussten bereits die ersten Gewässer aus Not abfischen.
In Rietschen, Kreba-Neuendorf und Klitten im Niederschlesischen Oberlausitz-Kreis wurden aus Wassernot Fische umgesetzt. In Betrieben in Uhyst und Wartha bei Hoyerswerda ist das Wasser in den Teichen dramatisch gesunken.
In der Talsperre Spremberg schrumpft der Vorrat. Täglich wird eine Million Kubikmeter Wasser in die Spree geleitet. In der gleichen Zeit fließen in den Speicher nur gut 600 000 Kubikmeter: Ein Teil des Wassers wird über den Nordumfluter erst in der Mitte des Spreewalds abgegeben.
Dadurch soll die. Entnahme für Gartenbewässerung eingeschränkt werden. Bei einem Durchfluss von 0,6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde am Pegel Leibsch ist die Spree praktisch zum Stillstand gekommen. Normal sind dort 13 Kubikmeter.
"Wir sind mitten in einem Klimawandel, daran ist nichts zu deuteln" , sagt Matthias Freude, Präsident des Landesumweltamtes Brandenburg.
(Eig. Ber./sw) SEITE 3
hitze_1_260706lr.doc
Notstand in Lausitzer Teichen und Flüssen,
Schwarze Elster stellenweise ausgetrocknet / Spree fließt kaum noch / Notabfischung in Teichwirtschaften
Der Hitzesommer hält unvermindert an. In den Flüssen, Seen und Teichen wird das Wasser knapp. Pflanzen verdorren, Fische müssen gerettet werden. Die Lausitz trocknet aus. Umwelt- und Klimaexperten gehen davon aus, dass in diesem Landstrich in den nächsten 50 Jahren die Niederschläge so dramatisch zurückgehen könnten wie sonst nirgendwo in Deutschland.
VON WOLF GANG SWAT
Ruckzuck ist der etwa fünf Hektar große Teich geleert. Weniger als eine Stunde dauert das Ablassen des Wassers. Dann beginnen der Teichwirt Christoph Junghanns (45) aus Forst-Eulo und seine Mannen bereits mit dem Abfischen. Normal dauert es fünf bis sieben Tage, bis solch ein Gewässer geleert ist. "Es war halt kaum noch etwas im Teich", stellt Junghanns nüchtern fest.
23 Teiche werden abgefischt
Seit knapp drei Wochen, drei Monate früher als geplant, sind die Fischer nun bereits dabei, um die Fische aus 23 Teichen mit einer Gesamtgröße von 40 Hektar zu retten, weil die Gewässer ihnen kaum noch Lebensraum geboten haben. Dabei hätten die Tiere noch drei Monate heranwachsen sollen. "Ein Teich ist ganz umgekippt, weil plötzlich kein Wasser mehr zugeflossen ist. Da konnten nur noch die Fischreiher ernten", klagt Junghanns. Auch in den anderen Teichen verschärft sich die Lage. "Die Wasserqualität lässt nach, die Brühe wird immer dicker."
So hitzig wie in Eulo ist die Situation in vielen Teichwirtschaften. "Wenn das Wetter so bleibt, müssen wir in Größenordnung abfischen und die Fische in andere Teiche umsetzen", befürchtet der Präsident des Landesfischerverbandes in Sachsen, Wolfgang Stiehler. Die Teichwirte in Rietschen, Kreba-Neuendorf und Klitten im Niederschlesischen Oberlausitzkreis mussten bereits damit beginnen.
Was Binnenfischer wie Christoph Junghanns aus Forst beunruhigt, ist die "auffällige Häufigkeit" und die kürzer werdenden Zyklen von trockenen Sommern.
"Ich betreibe seit 14 Jahren die Teichwirtschaft. In elf Jahren war nicht ausreichend Wasser da", stellt er fest.
Matthias Freude, Präsident des brandenburgischen Landesumweltamtes, sieht es nicht anders. "Wir sind mitten im Klimawandel, daran ist nichts zu deuteln", sagt er. Der Blick in die Zukunft verspricht keine Besserung. Laut Freude gehen Klimaexperten davon aus, dass es bis 2055 in der Lausitz den dramatischsten Niederschlagsrückgang innerhalb Deutschlands geben könnte. .
Wie groß regionale Unterschiede sind, zeigt ein Blick auf die Regenmengen im Juli.
Danach hat es in Cottbus und dem Spreewald gerade mal drei Liter je Quadratmeter "zusammengetröpfelt".
Im Raum Potsdam flossen dagegen stattliche 64 Liter Wasser vom Himmel ins Grundwasser, in Flüsse, Seen und Teiche.
Bei der Analyse der gegenwärtigen Situation gebraucht Freude Superlative, die ihm nicht oft über die Lippen kommen. "Noch nie" sei aus der Talsperre Spremberg so viel Wasser abgeleitet worden, um die Spree vor dem Austrocknen zu bewahren.
Eine Million Kubikmeter sind es jeden Tag. Trotz dieser gewaltigen Menge stellt der Chef der märkischen Umweltbehörde fest: "Praktisch steht die Spree." Am Pegel in Leibsch im Unterspreewald quälen sich höchstens noch 0,6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Berlin. Normal sind 13 Kubikmeter. Und das, obwohl aus der Talsperre Bautzen die Wasserzufuhr ins Brandenburgische um 1,6 auf 4,6 Kubikmeter je Sekunde erhöht wurde. Zum Glück sind die Talsperren in Sachsen mit 92 Prozent überdurchschnittlich gut gefüllt. Normal ist laut Katrin Schöne von der Landestalsperrenverwaltung für diese Jahreszeit ein Füllstand um 85 Prozent. Laut Staatsvertrag füllen die Talsperren Bautzen und Quitzdorf die Spree jährlich bei Bedarf mit bis zu 20 Millionen Kubikmeter Wasser auf. "Wenn es so weitergeht, ist die Menge im August ausgeschöpft", so Schöne.
Mehr Abfluss als
Zufluss
Trotz alledem nimmt der Vorrat im Speicherbecken in Spremberg ab. Tag für Tag sinkt der Wasserspiegel um etwa vier Zentimeter, weil mit elf Kubikmetern je Sekunde vier mehr in die Spree gepumpt werden als in die Talsperre zufließen.
Das Zusatzwasser wird seit Anfang der Woche über den Nordumfluter an Teilen des Spreewaldes vorbeigeleitet und erst später in die Lagunenlandschaft eingespeist. "Das haben wir, noch nie gemacht", erklärt Freude. Die Umweltexperten erhoffen sich davon; die "Lecks" zu finden, in denen das Wasser bislang verschwand. Dass es aus den Fließen für die Bewässerung von Gemüse, Rasen, Bäumen genommen wird, ist für Freude nahe liegend.
Laut Wasserhaushaltsgesetz sei die Entnahme jedoch verboten, wenn Gefahr für die Umwelt droht. "Die ist da", warnt Freude. Schon sind die ersten der 30 Millionen Flussmuscheln, die die Spree reinigen, gestorben.
Auch in anderen Flüssen hinterlassen extreme Hitze und Trockenheit Spuren. In der Schwarzen Elster oberhalb von Senftenberg ist das Flussbett staubtrocken. "Das gab es zwar schon, ist aber dennoch eine absolute Seltenheit", schätzt Freude ein. Dabei hat die Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbau Verwaltungsgesellschaft (LMBV) allein im Juli
1,9 Millionen Kubikmeter Wasser aus der Grubenentwässerung und dem Tagebau-Restloch Sedlitz in die Schwarze Elster bei Senftenberg gepumpt.
Trinkwasserversorgung
gesichert
Für die Spree ist eine solche Zugabe in Notzeiten aus dem LMBVReservoir noch nicht möglich. Der Wasserspiegel in den sächsischen Bergbausanierungsgebieten Dreiweibern, Lohsa 2, Burghammer und Bärwalde liege noch unterhalb des Ausleiters, so die Begründung von Rudolf Heine von der LMBVFlutungszentrale in Senftenberg.
Nicht "ganz so gruselig" wie in "Spree und Elster" ist nach Angaben des Landesumweltamtes die Lage in den anderen Flüssen. Am Neißepegel in Guben fließen noch sieben Kubikmeter je Sekunde, zwei Drittel weniger als normal Die Elbe bei Mühlberg ist nur noch etwa zur Hälfte gefüllt. Teilweise ist der Schiffsverkehr eingeschränkt.
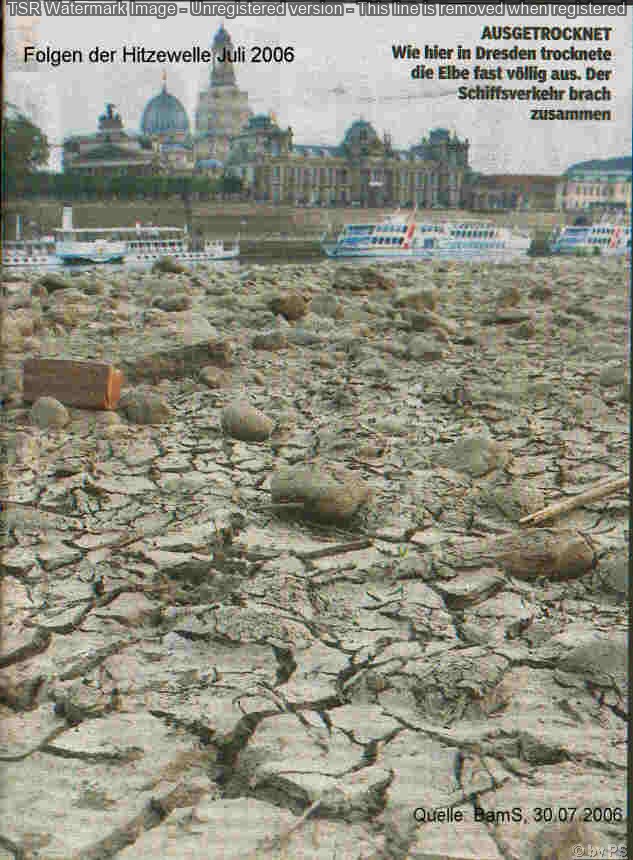
... und so sah die Elbe in Dresden im September 2008 aus:
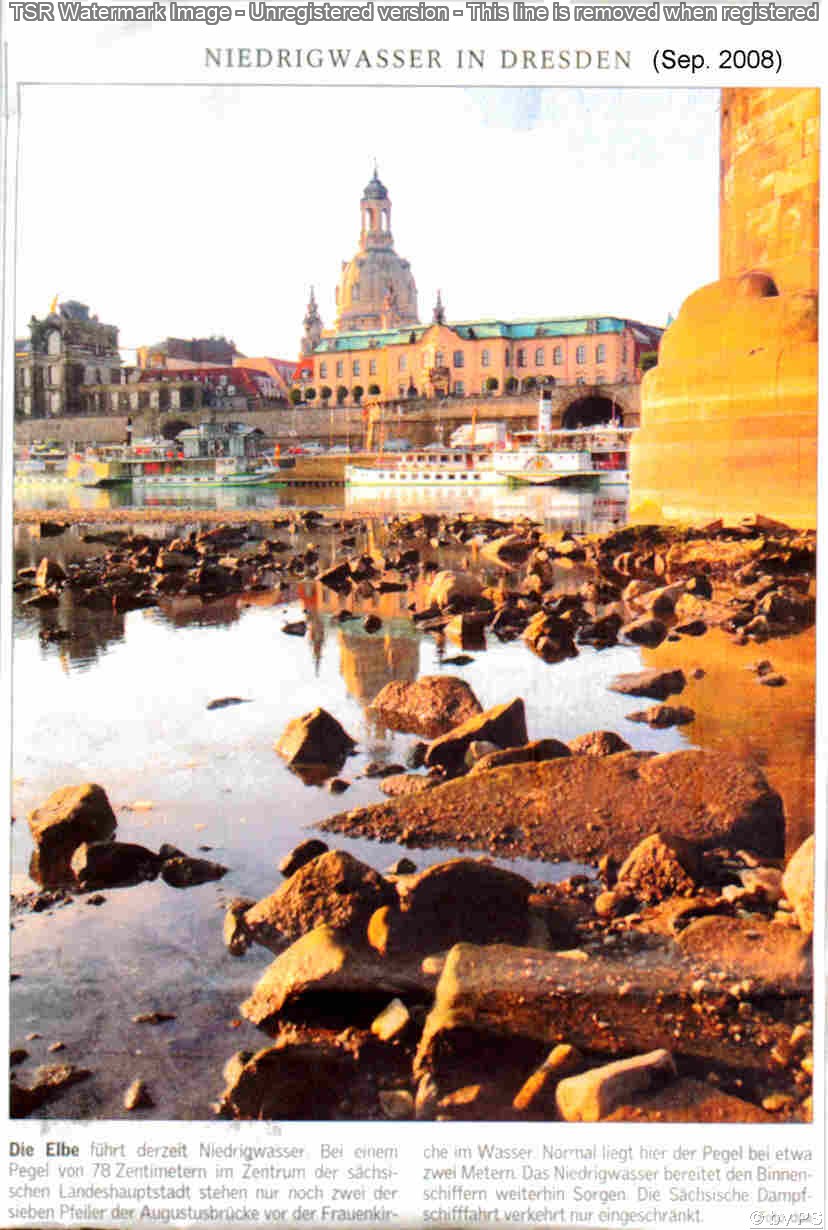
... es ist eben alles relativ !
Trotz der extremen Trockenheit war die Trinkwasserversorgung in der Region gesichert. "Unsere Wasserwerke sind noch nicht an der Kapazitätsgrenze", beruhigt Heidrun Dittmann von der Lausitzer Wassergesellschaft in Cottbus. Mit 25 700 Kubikmeter wurde am 19. Juli der diesjährige Spitzenverbrauch gemessen. "Gut das Doppelte könnten wir liefern", so Dittmann.
hitze_2_260706lr.doc
Heute auf Seite 1 der "Lausitzer Rundschau":
Die Hitzeperiode ist vorbei
August beginnt wechselhaft und mit Regen / Bauern klagen über Verluste
COTTBUS, Die Hitzeperiode ist endlich vorbei - der August beginnt wechselhaft. Tief "Xaviera" bringt ein Mix aus Sonne und Schauern sowie niedrigeren Temperaturen nach Deutschland.
Bereits heute (Anm. d.Verf.:01.08.2006), meldet der Wetterdienst Meteomedia,
setzt Regen ein, die Temperaturen klettern noch auf Spitzenwerte zwischen 21 und 29,Grad..
Das kühle Nass von oben wird das Wasserdefizit in der Region vorerst jedoch nicht ausgleichen können.
Die Probleme durch den Wassermangel im Spreewald haben sich vor allem für die Landwirte weiter zugespitzt. Nach den ersten Ernteeinsätzen ist klar, dass beim Getreide zum Teil mit hohen Verlusten gerechnet werden muss. Noch schlimmer sieht es beim Mais und bei den Kartoffeln aus, wenn die Felder nicht bewässert werden können.
Sehr gut fällt in diesem Jahr hingegen offenbar die Gurkenernte aus. (dpa/roe)
hitze_5_010806lr.doc
Der interessierte Leser kann auch einmal die Adresse www.luis.brandenburg.de anklicken, um durch das
Studium der Hydrologischen Wochenberichte immer auf dem laufenden zu sein.
Um
künftig gegen Niedrigwasserperioden gefeit zu sein:
Behörde erstellt Konzept gegen Wassermangel im Spreewald
Landesumweltamt erarbeitet Bewirtschaftungsplan
COTTBUS. Das Landesumweltamt, Regionalabteilung Süd in Cottbus, arbeitet an einem Wasserbewirtschaftungsplan für den Spreewald in ausgeprägten Trockenperioden.
Die notwendigen Daten dafür werden gerade erhoben, sagte Regionalleiter Wolfgang Genehr.
Dieser Plan, der mit den Nutzern abgestimmt wird, soll Festlegungen treffen, bei welcher Wassermangelsituation in dem Feuchtgebiet welche Nutzungseinschränkungen vorgenommen werden.
Dazu gehört beispielsweise die Schließung von Fließen für den Kahnverkehr.
Das Landesumweltamt reagiert damit auf die Situation während der extremen Trockenheit in der Region in diesem Sommer. (Eig. Ber./sim)
nwspreew_170806lr.doc
Quelle:
Lausitzer Rundschau, 17.08.2006
Vielleicht hat dieser Zustand nichts mit der Klimaveränderung zu tun, sondern ist einfach der verminderter Einleitungsmenge
von Grubenwässern geschuldet ??? (siehe auch Bemerkung des Verfassers: unter dem "Wasser")
Regenmangel
bereitet Lausitzer Flüssen Probleme
Spree
und Schwarze Elster fehlt Wasser
COTTBUS.
Wochenlanger Regenmangel hat nach Einschätzung von Wasserexperten zu
Problemen bei der Spree und der Schwarzen Elster in Südbrandenburg geführt.
"In dem Abflussgebiet verdunstet zwar nicht mehr so viel Wasser wie im
Sommer, doch der Wasserstand ist niedriger als sonst", sagte gestern Wolfgang
Genehr vom Landesumwelt in Cottbus. "Die Schwarze Elster ist
sogar streckenweise trocken gefallen." Es dauere somit länger, die im
Sommer stark reduzierten Wasserspeicher zu füllen. "Das Wasser in der
Talsperre Spremberg reicht aber aus, um damit den Spreewald ausreichend zu
versorgen", betonte der Abteilungsleiter.
"Zurzeit
fließen 8,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Talsperre", berichtete
Genehr. Das sei ein Drittel weniger als im durchschnittlichen Oktobermittel.
"Zugleich werden etwa 6,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus der Talsperre
abgelassen, das sind zwei
Drittel des Monatsmittels. " Auf diese Weise solle der Vorrat in dem nur
halb gefüllten Speicherbecken langsam wieder erhöht werden. Am Pegel der
Spree in Leibsch (Dahme-Spreewald) werde jetzt ein Viertel weniger Wasser
abgelassen als normalerweise.
Als
Konsequenz aus den trockenen Sommern der vergangenen Jahre bereite das
Landesumweltamt jetzt ein Konzept für den Spreewald vor, damit er auch bei
Niedrigwasser funktionieren könne.
"Nur
die Hälfte der Wasserverluste entstehen dort durch Verdunstung", bemerkte
Genehr. "Deshalb soll gemeinsam mit Kommunalvertretern, Fischern, Kahnfährleuten,
Landwirten und Privatleuten ein Programm erarbeitet werden, wie die geringere
Wassermenge in trockenen Sommern am besten verteilt werden kann."
So
gehe es darum; wie viel Wasser in die einzelnen Fließe geleitet und an den
Stauanlagen abgelassen wird. (dpa/lh)
Quelle: Lausitzer Rundschau, 20.10.2006
Hier
kommt ein Vorreiter zu Wort mir echten Ideen.
Das heißt: Sich Gedanken um den Wasserhaushalt machen und die Ärmel hochkrempeln ....
und
nicht auf Bundes- oder Landessubventionen warten
Landwirte
im Trockenstress
Neue
Ideen, Methoden und Pflanzen sind gefragt
REGION. Es war der wärmste und trockenste April seit Aufzeichnung der
Wetterdaten. An trockene Sommer und nasse Winter müssen wir uns gewöhnen,
sagen die Experten. Lausitzer Landwirte stellen sich darauf ein.
Der
Ruf nach Subventionen ist das eine, das andere sind neue Strategien, damit die
Landwirte auch in den kommenden Jahrzehnten in der Lausitz ihr Auskommen haben.
Einer, der sich intensiv mit neuen Anbaumöglichkeiten befasst, ist Egon
Rattei, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes und außerdem Geschäftsführer
der Agrargenossenschaft Forst.
2.200
Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bieten neben der herkömmlichen
Bewirtschaftung Platz für wissenschaftliche Versuche. Experten der BTU Cottbus,
der Universität Göttingen und des Zentrums für Agrarlandschaft- und
Landnutzungsforschung Müncheberg testen den Pflanzenanbau auf sandigen
Böden, die das Wasser kaum halten können.
Die
Lausitz hat davon reichlich - rund 34 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Der
Mais ist die Pflanze, an der sich das Dilemma bestens darstellen lässt. Als
Futterpflanze oder Rohstoff für Bioenergie überaus beliebt, benötigt er viel
Wasser.
Das
heißt, für die vielbesungene Märkische Heide ist der Mais eigentlich nicht
geeignet
und wird doch vielerorts angebaut.
Für
die sandigen Böden prädestiniert wären Roggen, Lupine oder auch Luzerne.
Roggen jedoch bringt wenig Geld, Lupine wenig Ertrag. Bleibt die Luzerne, die
ein gutes Viehfutter ergibt und zudem noch klimagünstig ist, denn sie nimmt
sich Stickstoff aus der Luft und trägt zum Abbau des klimaschädlichen
Lachgases bei.
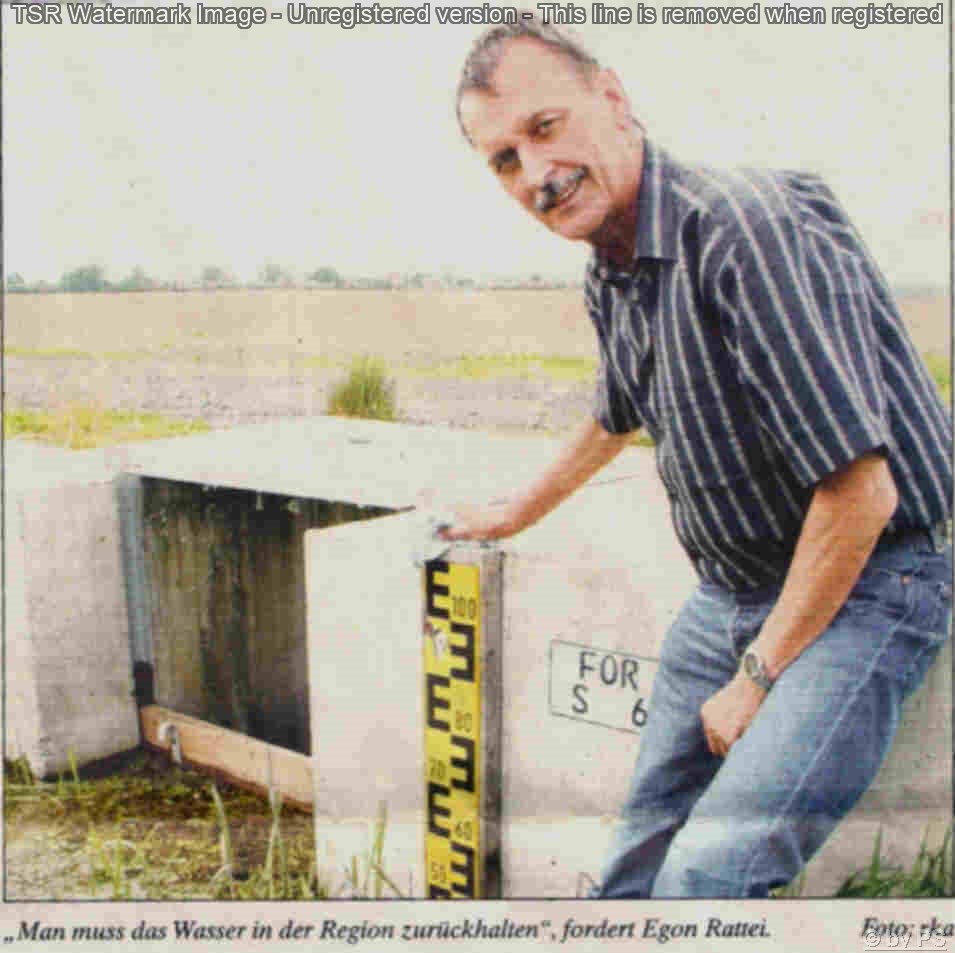
Davon
lässt sich so mancher Landwirt überzeugen.
"Schwierier
ist es, wenn es um den Anbau untypischer Pflanzen geht", stellt Egon
Rattei fest. Auf Flächen bei Welzow laufen zur Zeit Versuche mit Energiehölzern
wie Robinie und Pappel. "Mal sehen, was dabei herauskommt", ist er
selbst gespannt.
Eine
weitere Richtung, die man seiner Meinung nach nicht verteufeln sollte, ist die
Biotechnologie. "International gibt es züchterische Erfolge bei Mais,
Reis, Soja und Ölpflanzen, gerade in Bezug auf die Trockenverträglichkeit.
Auch die deutschen Züchter sind dicht dran. Politisch ist das momentan aber
sehr schwierig."
Daher setzt er mittelfristig erst einmal auf die dritte Säule, nämlich
das regionale
Wassermanagement.
Über'
Jahr betrachtet habe die Niederschlagsmenge kaum abgenommen - von trockenen
Jahren wie 2003 oder 2006 abgesehen. Auffällig ist jedoch, dass die
Sommerniederschläge abnehmen und die Winterniederschläge zunehmen. Deshalb müssen
Lösungen gefunden werden, das Wasser im Winter zu speichern, um dann
Trockenperioden wie jetzt im April 2009 (4,8 Liter/Quadratmeter zu 60,1 Liter im
März 2009) überbrücken zu können.
In
Zusammenarbeit mit dem Forster Boden- und
Wasserverband sind schon einige Wasserläufe
mit Stauwerken und Stützschwellen versehen worden, die das Wasser zurückhalten.
Die Erfahrungen sind gut.
Wasserhaushalt
Eine
Doktorandengruppe des Klimaforschungsinstitutes Potsdam begleitet diese Maßnahmen.
Vor allem aber ist der Umbau der Wasserläufe mit hohen Kosten verbunden. Hier
fordert Egon Rattei die Hilfe der Landesregierung ein.
Seine
Auffassung: Langfristig gesehen ist es besser, die regionalen Wasserkreisläufe
zu stärken, die Biotechnologie zu fördern und trockenresistente Pflanzen
anzubauen, als in jeder Trockenperiode in Potsdam um finanzielle Überbrückungshilfen
bitten zu müssen.
rka/möb
Quelle: Wochenkurier, 13. Mai 2009
Cottbuser
Institut tüftelt an Bewässerungssystemen für Bauern
Weniger
Wasser für umfangreichere Gemüse-Produktion
Cottbus.
Staubwolken über den Feldern und stark abgesunkene Pegelstände in den Fließen
sind während des Sommers
im Spreewald keine Seltenheit mehr. Der Wassermangel könnte sich in den
kommenden Jahren nach
Einschätzung von Fachleuten sogar noch verschärfen. Damit auch bei wachsender
Trockenheit die Gemüsebauern ihre gefragten Proukte weiter anbieten können,
arbeitet das Cottbuser Institut für Wetterforschung und Energie an neuen Bewässerungssystemen.
Sie sollen auf die Bedürfnisse der Gemüsebauern der
Region zugeschnitten werden.
"Wir
wollen die Tröpfchenbewässerung und Feuchtesensoren mit einer Chipsteuerung
kombinieren", erläutert Geschäftsführer Axel Hübner. "Dabei wird
das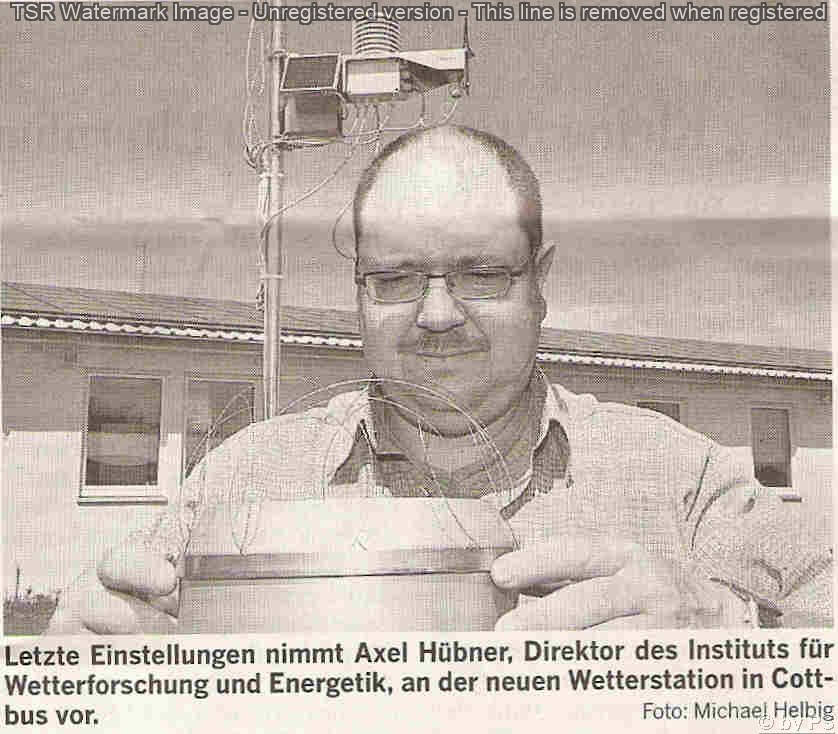 Wasserangebot an den Wurzeln gemessen, und abhängig vom Bedarf der Pflanzen
erfolgt dann die Bewässerung."
Wasserangebot an den Wurzeln gemessen, und abhängig vom Bedarf der Pflanzen
erfolgt dann die Bewässerung."
Bei
dem Projekt geht es einerseits um Wassereinsparungen. Zwischen 20 und 50 Prozent
sollen gegenüber derzeitigen modernen Bewässerungsmethoden gespart werden, die
von den Landwirten zurzeit nach Erfahrung und subjektiver Einschätzung
gesteuert werden. Gegenüber den längst nicht mehr zeitgemäßen Schlagregnern
und Sprengern wäre die gesparte Summe noch deutlich höher. Zudem soll nach
Auskunft des Instituts die Ertragsfähigkeit der Pflanzen optimal genutzt
werden, was derzeit noch nicht gelingt. Über die Schläuche der Bewässerung könnten
in einem weiteren Schritt auch Nährstoffe oder Präparate zur Schädlingsbekämpfung
direkt an die Pflanze gebracht werden.
Das
vor einem halben Jahr gegründete Institut wirkt bereits mit Spreewälder
Landwirten zusammen. Kooperiert wird auch mit dem Pflanzenschutzdienst des
Landes Brandenburg, der seine Wetterdatenbank zur Verfügung stellt. Derzeit bemüht
sich Axel Hübner um Fördergeld des Landes, um für die Boden- und
Gemüsearten
des Spreewaldes Informationen zu sammeln. So können die für die Steuerungen nötigen
Profile erarbeitet werden. Spreewaldbauer Karl-Heinz Ricken will 20 Hektar
Versuchsflächen für einen Praxistest zur Verfügung stellen.
Dabei
sollen bei verschiedenen Kulturen Nachbarparzellen mit dem neuen und dem
bisherigen System mit Wasser versorgt werden, um. Vergleichsdaten zu erhalten.
Ronald Ufer
Quelle: Lausitzer Rundschau, 19.06.2009
Dürre und Trockenheit im Freistaat
Leipzig Der Klimawandel sorgt in Sachsen für immer neue Hitzerekorde. Kälterekorde wurden schon lange nicht mehr aufgestellt. Eine Herausforderung für Land-, Forst und Wasserwirtschaft.
Dürre und
extreme Wetterlagen werden Sachsen wegen des Klimawandels künftig stärker
heimsuchen. Das sagen Klimaforscher des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie in einem neuen Klimaatlas voraus. Besonders die Land- und
Forstwirtschaft, aber auch andere Branchen wie die Wasserwirtschaft müssten sich
auf die Veränderungen einstellen, sagte Umweltminister Frank Kupfer (CDU) am
Montag (06.06.2011)
in Leipzig bei der Vorstellung des „Kompendiums Klima – Sachsen im Klimawandel.“
Die Experten erwarten bis zum Jahr 2100 in Sachsen eine Erwärmung um etwa 3,5
Grad Celsius. Je nachdem, wie sich die weltweiten Kohlendioxid(CO2)-Emissionen
entwickelten, sei auch eine Erwärmung um sechs Grad nicht auszuschließen, hieß
es. Dazu regne es im Sommer immer weniger.
In den
vergangenen 100 Jahren sei die Niederschlagsmenge im Sommer um 16 Prozent
zurückgegangen, sagte Klimaforscher Udo Mellentin. Ähnlich stark sei der
Rückgang bundesweit nur noch in Brandenburg gewesen. Diese Sommer-Trockenheit
werde sich zuspitzen.
„Bei den Land- und Forstwirten ist es existenziell notwendig, sich auf den
Klimawandel einzustellen“, betonte Minister Kupfer. „Ein Weg ist es, Sorten zu
züchten, die mit höheren Temperaturen und weniger Niederschlägen zurechtkommen.“
Auch beim Waldumbau müsse die Entwicklung bedacht werden. Das Klima-Kompendium
enthalte die nötigen Informationen. Es solle ständig erweitert werden; das
Landesamt werde die neuesten Daten jeweils im Internet zum Download
bereitstellen.
Neben Dürre und Trockenheit prophezeien die Experten dem Freistaat auch mehr
Extremwetterlagen mit Folgen wie Tornados oder Hochwasser. Kupfer äußerte
deshalb Unverständnis für örtlich heftige Proteste gegen
Hochwasserschutzmaßnahmen. „Man weiß, dass extreme Witterungslagen mit
Hochwasser zunehmen. Das wird in Zukunft so weitergehen.“
Auf die Landwirte sieht Präsident des Landesamtes Norbert Eichkorn noch weitere
Herausforderungen zukommen. So behindere fehlendes Wasser nicht nur das
Wachstum, auch Nährstoffe im Boden würden sich schlechter lösen und seien so für
die Pflanzen nicht verwertbar. Da helfe auch Kunstdünger nicht mehr. „Wasser ist
der entscheidende Faktor“, sagte Eichkorn.
In Zukunft würden dürreresistente Pflanzen immer wichtiger.
dpa/roe
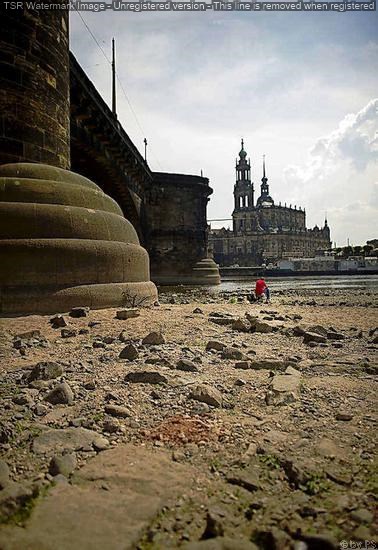
Trockene Zeiten: Ein Mann sitzt am Montag (06.06.2011) bei einem Pegel von 1,14 Meter an der Elbe in Dresden unterhalb der Augustusbrücke . Foto: ZB
Foto: ZB
07. Juni 2011 01:26:34
Quelle: Lausitzer Rundschau, 06.06.2011
Der Wald gefährdet die Lieberoser Heide-Moore
Lieberose Die Moore in der Lieberoser Heide drohen auszutrocknen. Wissenschaftler beobachten seit rund 20 Jahren einen Rückgang des Wasserspiegels um bis zu drei Meter. Jetzt will das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz mit verschiedenen Maßnahmen gegensteuern.
Der Wald
gefährdet die Moore. Was auf den ersten Blick paradox klingen mag, ist in der
Lieberoser Heide traurige Wirklichkeit. Denn die monotonen Kiefernbestände
saugen den Mooren regelrecht das Wasser weg. Beispiel Kesselluch: In diesem
Moor, das sich ganz versteckt zwischen Schönhöhe und Staakow (Spree-Neiße)
erstreckt, wachsen die Kiefern bereits direkt auf dem Moorkörper. Auch rund um
das mehrere Hektar große Feuchtareal dominiert die Nadelbaumart.
 Forstrat Arne Barkhausen, der die Oberförstereien Cottbus und Tauer leitet,
weiß, dass Kiefern sehr viel mehr Wasser verbrauchen als Laubbäume. Seit einem
halben Jahrzehnt baut Barkhausen deshalb Waldflächen um die Moore in der Lieberoser Heide gezielt um: „Eiche statt Kiefer“.
Forstrat Arne Barkhausen, der die Oberförstereien Cottbus und Tauer leitet,
weiß, dass Kiefern sehr viel mehr Wasser verbrauchen als Laubbäume. Seit einem
halben Jahrzehnt baut Barkhausen deshalb Waldflächen um die Moore in der Lieberoser Heide gezielt um: „Eiche statt Kiefer“.
Insgesamt zehn Hektar neuer Laubwald an fünf Moorstandorten bei Staakow und
Pinnow seien inzwischen zusammengekommen. Zwei weitere Hektar sollen im Jahr
2012 am Kesselluch folgen. „Auch dort bringen wir Traubeneichen in den Boden“,
kündigt der Forstmann an.
Damit folgt er einer Empfehlung der Arbeitsgruppe „Stabilisierung der
Grundwasserstände in der Lieberoser Hochfläche“. Dieses Gremium, das sich aus
verschiedenen Fachleuten und Wissenschaftlern zusammensetzt, befasst sich mit
der seit zwei Jahrzehnten anhaltenden Austrocknung der Moore und Gewässer in der
Lieberoser Heide.
In einer Untersuchung, die durch zwei Ingenieurbüros im Auftrag des
Brandenburger Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz erstellt
wurde, heißt es, dass sich die Grundwasserneubildung im 450 Quadratkilometer
großen Untersuchungsgebiet in den Jahren zwischen 1998 und 2007 um bis zu 40
Prozent verringert habe. Zudem sei die Jahresdurchschnittstemperatur auf mehr
als 9,5 Grad Celsius angestiegen. Noch in den 1990er-Jahren habe sie sich unter
neun Grad bewegt. Dadurch werde die Wasserverdunstung erhöht. Nicht zuletzt
wirke sich die Wiederbewaldung des einst offenen Lieberoser Schießplatzes
negativ auf den Grundwasserstand und damit auf die Moore aus.
„Mancherorts ist der Wasserstand um zwei bis drei Meter gefallen“, weiß Dr.
Christian Gerstgraser vom gleichnamigen Cottbuser Ingenieurbüro.
Er empfiehlt gegen die Austrocknung der Moore
neben dem Waldumbau den Wasserrückhalt in Fließgewässern sowie die Wiederherstellung von lokalen Wassereinzugsgebieten, beispielsweise dem Quellmoor Atterwasch bei Guben.
Der
Wissenschaftler betont aber auch, dass Trockenphasen im natürlichen Zyklus der
Moore lägen. So kämen in manchen dieser Feuchtgebiete alte Wurzelstubben zum
Vorschein, die auf eine mögliche Dürrezeit vor langer Zeit hindeuten.
„Der
Ansatz mancher Leute, dass alles so bleiben müsse wie es derzeit ist, betrachte
ich als Quatsch.
Denn Natur bedeutet auch immer Veränderung“,
sagt Gerstgraser. Torsten Richter / trt1
Quelle: Lausitzer Rundschau, 11.07.2011
Kaum sind die Hochwässer 2011 vorbei:
Spree-Wasser in Cottbus knapp
Niedriger Pegel sorgt für Probleme / Fährleute im Spreewald gelassen / Nachschub kommt
Cottbus/Lübbenau/Lübben Eher Flüsschen als Fluss. Die Spree zeigt sich in Cottbus von ihrer harmlosen Seite. Gerade einmal noch 89 Zentimeter Pegelstand wurden am Dienstag an der Sandower Brücke gemessen. Während dort erste Sorgen laut werden, gibt der Spreewald zwischen Lübbenau und Lübben Entwarnung.
Bei Thomas Bergner sorgte eine Mitteilung am Dienstagvormittag für ein wenig mehr Gelassenheit. Ab sofort, so wurde der Cottbuser Umweltamtschef informiert, wird aus der Talsperre in Spremberg wieder mehr Wasser in die Spree gelassen. In den vergangenen Tagen gab es laut Bergner 7,96 Kubikmeter je Sekunde aus der großen Badewanne. "Das war nicht besonders viel", so der Umweltamtschef.
Seit Dienstag (29.05.2012) fließen immerhin 9,55 Kubikmeter in den Fluss. Damit wird die Stadt vorerst wohl auf eine drastische Reaktion verzichten können. "Wir hätten uns sonst über ein Verbot der Wasserentnahme Gedanken machen müssen". Zuletzt hatte die Stadt im Jahr 2010 eine entsprechende Allgemeinverfügung verhängt. Die Flussanlieger mussten damals ihre Pumpen, die zum Beispiel zur Bewässerung der Grundstücke eingesetzt worden waren, abstellen.
Ein paar kräftige Regengüsse und mehr Wasser aus dem Speicherbecken – das wünscht sich Gerd Michaelis vom Teichgut Peitz. "Wir haben zwar Staurechte, doch wenn kein Wasser da ist, gibt es auch nichts zu verteilen", so Michaelis. Dabei stecken die Karpfenfischer auch ein wenig in der Zwickmühle. Zum einen freuen sie sich über sonniges Wetter, weil bei höheren Temperaturen die Tiere besonders gut gedeihen. Andererseits wird bei zu wenig Wasser der Lebensraum für die Karpfen knapp. Dann drohen Notabfischungen. "Wir hoffen, dass es nicht soweit kommt", sagt Michaelis.
 Alarmsignale gibt es auch aus dem Spreewald – wenn auch nicht ausschließlich
wegen des Wasserpegels. Denn trotz anhaltender Trockenheit ist das Wasser in den
meisten Burger Fließen noch nicht knapp geworden. Das betont Bernd Lehmann,
Inhaber des Bootshauses am Leineweber. Probleme gebe es lediglich dort, wo das
Hochwasser des vergangenen Jahres zu Sedimentablagerungen geführt hat. "Dadurch
gibt es Stellen, die flacher sind als früher", so Lehmann.
Alarmsignale gibt es auch aus dem Spreewald – wenn auch nicht ausschließlich
wegen des Wasserpegels. Denn trotz anhaltender Trockenheit ist das Wasser in den
meisten Burger Fließen noch nicht knapp geworden. Das betont Bernd Lehmann,
Inhaber des Bootshauses am Leineweber. Probleme gebe es lediglich dort, wo das
Hochwasser des vergangenen Jahres zu Sedimentablagerungen geführt hat. "Dadurch
gibt es Stellen, die flacher sind als früher", so Lehmann.
Der Wasserstand an den Bootsstegen sei völlig normal. So könne er auch die üblichen Kahntouren durch Ostgraben, Greifenhainer Fließ, Scheidungsfließ, Kleines Leineweberfließ und Große Wildbahn anbieten. Lediglich die Stradower Kahnfahrt finde derzeit nicht statt. Bernd Lehmann: "Dort gibt es Sedimenteinspülungen aus dem Südumfluter."
Deshalb werden aus dem Spreewald Forderungen laut, den Schlamm aus den Fließen abzubaggern. Das Problem: Nach einer neuen Richtlinie wird der Schlamm als Sondermüll behandelt. Das macht die Entsorgung unbezahlbar.
Weitaus gelassener beobachten die Fährleute zwischen Lübbenau und Lübben das Geschehen. "Man merkt zwar, dass die Strömung nicht gar so stark ist", sagt Steffen Franke, Chef der Fährmanns-Genossenschaft vom Großen Hafen in Lübbenau. Es gebe aber kein Niedrigwasser. Lübbenau sei durch seine Lage ohnehin vor größeren Schwankungen gefeit. Bei den Kahnfahrten gebe es keine Einschränkungen. Lediglich an einzelnen Fließen, so heißt es beispielsweise am Kleinen Hafen, sei spürbar, dass Paddelboote tiefer eingelassen werden müssen.
Noch weiter flussabwärts in Lübben (Dahme-Spreewald) gibt es ebenfalls keine Bedenken. "Der Wassermangel beeinflusst uns überhaupt nicht", erklärt Martin Matthei aus dem Vorstand des Fährmannsvereins "Flottes Rudel". Auch in Lübben habe man bemerkt, dass die Pegel sinken. "Die Strömung verlangsamt sich und das Kahnfahren fällt dann etwas leichter", sagt Matthei. Er habe in den letzten 20 Jahren noch nie erlebt, dass Kahnfahren wegen zu niedrigem Wasserstand nicht möglich gewesen wäre. Ein voll besetztes Boot habe schließlich nur 40 Zentimeter Tiefgang.
Ulrike Elsner, Sven Hering,Jan Gloßmann und Anne Guckland
Quelle: Lausitzer Rundschau, 30.05.2012
Trocknet die Schwarze Elster aus?
Flussabschnitte 2003 und 2006 trocken / Wasser aus dem Senftenberger See wird in die Elster gespeist
Bad Liebenwerda/Herzberg Nur noch 30 Zentimeter Pegelstand an der Schwarzen Elster bei Bad Liebenwerda. Und der Regen in der Nacht zum Freitag entspannt die Situation nicht – war eher der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Trocknet die Schwarze Elster aus?
So mancher Kurstädter unkt in diesem Jahr schon: "An der Elster haben wir schon viel erlebt. Aber ausgetrocknet war der Fluss noch nie." Momentan ist dieses Szenario noch nicht zu erkennen. Die geringe Wassermenge macht dennoch Sorgen.
Christian Harig, Bereichsingenieur des Landesumweltamtes, hat genauere Zahlen parat.
"Das Mittelwasser der Elster liegt bei Bad Liebenwerda etwa bei 1,10 Metern. Jetzt haben wir schon 80 Zentimeter weniger als normal", erklärt er.
Bei Mittelwasser fließen etwa zwölf Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab. Jetzt sind es gerade mal noch zwei bis drei Kubikmeter pro Sekunde.
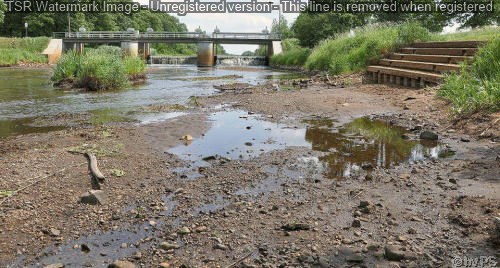
Und je näher die Elbemündung rückt, desto weniger Wasser fließt in der Elster. Bei München und Bomsdorf ist der Wasserstand noch niedriger, in Arnsnesta ragen die Sandbänke deutlich aus dem Wasser. Zwischen dem alten Wehr und Arnsnesta sind die Ausschwemmungen zwischen einem und 1,40 Meter hoch. Sie verhindern den natürlichen Durchfluss des Wassers. An ihnen bleibt Treibgut hängen, was in einer Hochwassersituation zu großen Problemen führt. Im Winter können sich hier die Eisblöcke stauen. Auf die Situation wurde schon mehrmals hingewiesen.
An den Bootsanlegern in München und Neumühl sind Holzpaletten auf den ausgetrockneten Flussgrund aufgestapelt worden, damit Gewässertouristen mit ihren Booten überhaupt anlegen können. Immer wieder kommen im Flussverlauf die Ablagerungen vergangener Hochwasser zutage. "Die wollten wir eigentlich schon raushaben. Aber dafür fehlt angesichts von Dammbauarbeiten das Geld", sagt Harig.
Auch im Landesumweltamt Cottbus hat man die Pegel der Flüsse genau im Auge. Wie Eckhard Schaefer erläutert, werde vom Senftenberger See, der auch als Speicherbecken fungiert, jetzt täglich ein Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Schwarze Elster abgegeben. Das wirke sich bis Bad Liebenwerda allerdings nicht aus. "Das reicht nur, um bis Plessa/Elsterwerda aufzufüllen. Bad Liebenwerda lebt eher vom Zulauf aus der Großen Röder. Und die führt gegenwärtig auch wenig Wasser", sagt der Gewässerspezialist.
Und er erinnert an die Trockenheit in den Jahren 2003 und 2006. Damals war im Senftenberger Ortsteil Buchwalde und bei Biehlen die Elster ausgetrocknet.
Schaefer erläutert: "Der Senftenberger See hat ein Stauziel von 99 Metern. Das erreichen wir meist im Winterhalbjahr. Doch diesmal fehlten Anfang Mai schon 20 Zentimeter." Jetzt sei der Staustand schon auf 98,75 Meter gefallen. In den Dürrejahren 2003 und 2006 wurde schon an der 98-Meter-Marke gekratzt. Fällt der Pegel des Senftenberger Sees noch weiter, ist ein natürlicher Abfluss in die Elster nicht mehr gegeben. Dann müsste gepumpt werden.
Und Schaefer zeigt ein weiteres Problem auf. In der Region Senftenberg wolle man eine Stauhaltung von möglichst nur 98,50 Metern im See haben, da man den höheren Pegelstand für die vernässten Keller in den Häusern verantwortlich macht. Schaefer zufolge habe die Stauhöhe im See aber nichts mit dem Grundwasseranstieg zu tun. "Uns würde ein halber Meter Wasser fehlen." Und das auch in trockenen Jahren, wie 2012 momentan eins zu werden scheint.
Und warum trocknet die Elster in Seenähe zuerst aus? "Auf dem Abschnitt zwischen Neuwiese in Sachsen und dem Pegel Biehlen versickert ein halber Kubikmeter pro Sekunde", erklärt Schaefer.
Brandenburg ist insgesamt für seinen angespannten Wasserhaushalt bekannt. Nach Angaben des Landesumweltamtes sind die Jahresniederschläge mit Werten zwischen 500 und 760 Millimeter die geringsten in Deutschland. Das Niederschlagswasser ist im Land Brandenburg die maßgebliche Quelle des Wasserhaushaltes. Rund zwei Drittel des verfügbaren Wassers wird aus den Niederschlägen und nur ein Drittel durch Zuflüsse aus den angrenzenden Gebieten gedeckt.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 02.06.2012
Karpfen und Co. drohen trockene Teiche
Anlagenbetreiber sehnen Regen herbei / Hohe Verluste befürchtet
Teichwirtschaften in der Region drohen herbe Verluste. Mangels Wasser können
in Kreba, Klitten und Rietschen die Gewässer noch nicht für das Übersetzen
der Fische aus den Hälterteichen vorbereitet werden, was regulär Mitte März
beginnt.
Klitten/Kreba/Rietschen. Helmut Tusche würde gern im Boot auf einen der
Hammerstädter Teiche hinausfahren und endlich mit der Arbeit beginnen. Zu
tun gäbe es genug. Die Gewässer müssten für das Übersetzen der Fische aus
den Hälterteichen vorbereitet, dazu unter anderen Kalk eingebracht werden.
Auch der Frühjahrsbesatz, Larven und kleine Fische, müssten dringend ins
Wasser. An Wasser jedoch herrscht derzeit akuter Mangel.
"Bei einem Pegel von 20 Zentimetern kann man nicht mit dem Boot fahren",
sagt der Mann von der Fischzucht Rietschen GmbH.
Tusche hat mit seinen 40 Jahren Berufserfahrung schon so manche trockenen
Jahre erlebt. 2014 aber scheint alle Rekorde zu brechen.
"So extrem trocken fing das Jahr noch nie an." Derzeit verdunste in den
Teichen fast mehr Wasser als nachfließt. Woher sollte es auch kommen, fragt
sich Tusche. Seit dem Herbst habe es keinen ergiebigen Regen mehr gegeben.
Der Winter war so mild, dass im Oberland auch keine Schneeschmelze zu
erwarten ist, die Wasser bringt.
Schließlich sei es auch nicht so, dass viele große Wasserläufe die Region
durchziehen, so Tusche weiter. Sämtliche Fischwirtschaften hingen am Tropf
des Schöps. Konkret sind das neben den Rietschener Fischwirten noch die
Kreba Fisch GmbH und die Teichwirtschaft Klitten.
Auch dort schrillen schon die Alarmglocken. "Es sieht sehr kritisch aus",
sagt Kreba Fisch-Geschäftsführer Wolfgang Stiehler.
Auch er könnte nicht sagen, wann es zuletzt einen so trockenen Winter
gegeben hat. Die Fische müssten jetzt aus den Winterteichen geholt werden.
Doch auch in Kreba stehen die Sommerteiche noch fast leer. Bei zu geringer
Wasserhöhe fänden sie außerdem nicht genug Nahrung und wären eine leichte
Beute für Kormorane. Stiehler bleibt jedoch optimistisch. Es müsse doch nun
endlich mal regnen.
Sollte das nicht bald passieren, müsse man allerdings einen "Notstandsplan"
schmieden. Daran will der Fischwirt heute noch nicht denken. Doch würde
dabei wohl auch eine Rolle spielen müssen, wie das Schöpswasser verteilt
wird.
Dietmar Bergmann, Chef der Teichwirtschaft Klitten, kann nur bestätigen, was
seine Kollegen sagen. Im Frühjahr oder Herbst sei es sicherlich schon mal so
trocken gewesen. "Aber schon im Winter? Ich kann mich nicht erinnern", sagt
er. An drohende Verluste, die das zur Folge haben könnte, will er noch nicht
denken. Der Rückstand ließe sich noch aufholen, ist er sicher.
Helmut Tusche sieht das etwas anders. Selbst wenn sich die Teiche noch
vollständig füllen, würde doch den Fischen Wachstumszeit fehlen und am Ende
Gewicht.
An den Klimawandel könnte man in diesem Zusammenhang schon denken, so
Tusche. Doch könne das nicht der alleinige Grund sein.
In jedem Fall aber erachte er die Investition des Unternehmens in eine
Zander-Aufzuchtanlage im Rietschener Ortsteil Hammerstadt mit
Wasserkreislaufwirtschaft nun erst recht für sinnvoll. Damit mache man sich
vom Wetter unabhängiger.
Daniel Preikschat
Quelle: Lausitzer Rundschau, 12.03.2014
Niedrigwasser - Elbdampfschiftfahrt stellt Betrieb ein
Dresden. Auf der Elbe sind wegen Niedrigwassers vorerst keine Dampfer und motorisierten Ausflugsschiffe der Sächsischen Dampfschiffahrt mehr unterwegs. "Die weiter fallenden Pegel zwingen uns, den Betrieb einzustellen", teilte das Unternehmen am gestrigen Montag (08.06.2015) in Dresden mit. Bis zum Montagmittag (08.06.2015) sei der Betrieb noch eingeschränkt möglich gewesen, am heutigen Dienstag sollen dann alle Verbindungen ausfallen. Tickets könnten umgebucht oder storniert werden.
Zuletzt hatte der Pegelstand der Elbe in Dresden nur noch bei 69 Zentimetern gelegen. Normal sind etwa zwei Meter.
"In ganz Sachsen sind die Wasserstände derzeit sehr niedrig", erklärte eine Sprecherin des Landesamtes Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Schuld daran seien neben der fehlenden Schneeschmelze, die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen.
"Jetzt hilft nur noch Regen."
Quelle: Lausitzer Rundschau, 09.06.2015
Großer Strom, ganz klein: Abendrot färbt in Dresden das Wasser der Elbe. Bei einem Pegel von 90 Zentimetern liegt an der Marienbrücke ein großer Teil des Flussbetts auf dem Tockenen.

Foto: Matthias Hiekel
Quelle: Lausitzer Rundschau, 03.06.2015
«Annelie» bringt Werte nahe der 40-Grad-Marke
Offenbach (dpa) Am Mittwoch (01.07.2015) kriegt zumindest der Norden noch ein wenig lauwarme Luft. Ab Donnerstag ist es dann im ganzen Land heiß - richtig heiß. Und die Hitze wird nicht so schnell wieder verschwinden.
Deutschland steht eine extreme Hitzewelle bevor. Am Mittwoch bleiben die Temperaturen nur im Norden noch unter 30 Grad, im Süden und Südwesten kann das Thermometer bereits auf 35 Grad klettern….
… «Ab Donnerstag (02.07.2015) kommt der Sommer dann in ganz Deutschland so richtig in Fahrt», sagte Meteorologe Marcus Beyer am Dienstag. Lokal sind 39 Grad Celsius möglich. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 32 und 38 Grad.
Der deutsche Hitzerekord wird zunächst wohl trotzdem nicht geknackt. Die magische Marke liegt bei 40,2 Grad. Viermal wurde laut DWD diese Temperatur bisher gemessen: einmal 1983 und dreimal 2003….
…Niedrigwasser hat bereits die Schifffahrt auf der Elbe ausgebremst. Die Ausflugsschiffe blieben am Dienstag (30.06.2015) an den Anlegestellen. Eine Containerlinie wurde eingestellt. Der Pegelstand der Elbe in Dresden lag nur noch bei 69 Zentimetern, normal sind etwa zwei Meter.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 30.06.2015 (auszugsweise)
Ausflugsdampfer fahren wieder auf Elbe
Dresden. Motorisierte Ausflugsschiffe und Dampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt fahren wieder auf der Elbe.
Eine Wasserwelle' aus Tschechien hat den Pegelstand in Dresden um 20 Zentimeter erhöht.
"Wir fahren, mit kleinen Einschränkungen", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag (02.07.2015) .
Der Prognose nach soll auch in den nächsten Tagen gefahren werden. dpa/juf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 03.07.2015
Hitze - und ihre Schattenseiten
Frankfurt/Main (dpa) Braun-gelber Rasen, Brandgefahr, Badeseen von Algen getrübt, Niedrigwasser in den Flüssen, Scharen von Wespen - der Sommer 2015 bietet neben Ferienlaune auch Widrigkeiten. Und wochenlang muss der menschliche Organismus in der Hitze Hochleistung bringen.
Mit 40,3 Grad ist 2015 schon zweimal die höchste Temperatur in Deutschland seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen vor 134 Jahren gemessen worden - zuletzt am Freitag wieder im fränkischen Kitzingen, wie bereits am 5. Juli. Seit Wochen gibt es Sonne satt hierzulande, das mag Urlaubern gefallen. Aber dieses Wetter hat auch Schattenseiten:
TROCKENE FLÜSSE
UND SEEN: Wenn Regen ausbleibt, bekommt die Schifffahrt Probleme. Frachtschiffe
können bei Niedrigwasser weniger laden.
 Kubikmeter
Wasser. Mit dem Wasser, das er abgibt, wird der Pegel auf der Weser für die
Schifffahrt konstant gehalten. Ohne Niederschläge könnten in eineinhalb Wochen
viele Schiffe nicht mehr fahren, sagt Odo Sigges vom Wasser- und Schifffahrtsamt
Hann. Münden. Auch am Mittelrhein sinkt der Wasserspiegel. An der Elbe wird
derzeit extremes Niedrigwasser registriert, der Fluss führt so wenig Wasser wie
seit 51 Jahren nicht mehr, die Schifffahrt ist ausgebremst. Auch kleine Flüsse
in Sachsen seien vom Austrocknen bedroht - «Fische und Pflanzen bekommen
Kubikmeter
Wasser. Mit dem Wasser, das er abgibt, wird der Pegel auf der Weser für die
Schifffahrt konstant gehalten. Ohne Niederschläge könnten in eineinhalb Wochen
viele Schiffe nicht mehr fahren, sagt Odo Sigges vom Wasser- und Schifffahrtsamt
Hann. Münden. Auch am Mittelrhein sinkt der Wasserspiegel. An der Elbe wird
derzeit extremes Niedrigwasser registriert, der Fluss führt so wenig Wasser wie
seit 51 Jahren nicht mehr, die Schifffahrt ist ausgebremst. Auch kleine Flüsse
in Sachsen seien vom Austrocknen bedroht - «Fische und Pflanzen bekommen
dann richtig Stress», sagte Uwe Höhne, Leiter des Landeshochwasserzentrums in Sachsen.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 07.08.2015 (auszugsweise)
Wüstenwind in der Lausitz brachte Hitzerekord
Wetterrückblick Juli: In Boblitz kletterte das Thermometer auf 38,5 Grad Celsius / Bauernregeln sagen Frostgefahr voraus
Boblitz Das tropische Hitzehoch "Annelie" hat Anfang Juli mit fast 40 Grad Celsius für eine heiße Überraschung gesorgt. So mancher sehnte sich nach einer Abkühlung.
Wer gestärkt über den Winter kommen will, muss im Sommer fleißig sammeln wie diese Hummel auf der Sonnenblume. Foto: Bernd Marx/bdx1
Vielleicht gehen die Wünsche schneller als gedacht in Erfüllung, denn Bauernregeln halten einige Überraschungen parat. Die Einwohnerschaft in und rund um den 555-jährigen Lübbenauer Ortsteil Boblitz pendelte innerhalb von nur 36 Stunden zwischen "Eisschrank" und "Kachelofen". Am 5. Juli zeigte das Thermometer den Jahresrekord von 38,5 Grad Celsius für das Spreewalddorf an. Ähnliche Temperaturen wurden auch in Cottbus, Hähnchen und Preschen (beide Spree-Neiße) gemessen.
Der bisherige Hitzerekord im Land Brandenburg wurde 1992 mit 39,2 Grad Celsius in Lübben (LDS) gemessen. Was unterhielten sich die Boblitzer Landwirte an diesem Tag? Im Juli warmer Sonnenschein – macht alle Früchte reif und fein.
Schon die Altvorderen tuschelten: Der Juli muss vor Hitze braten, was im September soll geraten. Einig waren sich die örtlichen Bauern in der Aussage: Im Juli will der Bauer schwitzen, als untätig hinterm Ofen sitzen. Denn, was der Juli verbricht, rettet der September nicht. Doch nur zwei Tage später sackte der Quecksilberstreifen im Thermometer in den frühen Tagesstunden auf recht kühle 10 Grad Celsius herunter. Am 11. Juli sogar noch auf sechs Grad Celsius in der Nacht.
Prompt gab es einen Jahresrekord bei der Registrierung der größten Tages-Temperaturdifferenz. Es wurden 24 Grad Celsius, denn am 7. Juli kletterte das Thermometer von 10 Grad Celsius in der Nacht auf 34 Grad Celsius am Tage.
Wer in diesen Tagen von Schneewehen und Eiszapfen träumte, könnte diesen Wunsch bald erfüllt bekommen. Denn eine Bauerweisheit besagt: Wenn die Ameisen im Juli ihre Haufen höher machen, folgt ein strenger Winter.
Und auch St. Jakobi, der 25. Juli, wartete mit einem Spruch auf: St. Jakobi klar und rein, wird das Christfest frostig sein. An diesem Tag gab es 29 Grad Celsius Tageshöchsttemperatur, aber keinen Niederschlag. An 14 Juli-Tagen wurde mit insgesamt 71,0 Millimetern (71 Liter) pro Quadratmeter Niederschlag registriert.
Der höchste Niederschlag fiel am 14. Juli mit 19 Millimeter (19 Liter) pro Quadratmeter. Nach sieben Monaten stehen jetzt 350 Millimeter (350 Liter) pro Quadratmeter in der Statistik des Jahres 2015.
Im Jahre 2014 waren es bis dahin 360 Millimeter (360 Liter) pro Quadratmeter. Von 212 Tagen im Jahre 2015 fiel an 103 Tagen Niederschlag.
Es gab im Juli vier Gewitter, sodass jetzt 11 Gewitter in der Jahresbilanz 2015 stehen.
Da hatten Spreewälder Bauern auch einen passenden Spruch parat: Ein tüchtiges Juli-Gewitter ist gut für Winzer und Schnitter. Die Sonne strahlte im Juli an allen 31 Tagen, insgesamt 264 Stunden lang. Von 212 Tagen zeigte sich die Sonne an 167 Tagen. Unser Heimatstern zeigte sich in den ersten sieben Monaten des Jahres 2015 insgesamt 1069 Stunden lang. Im Vergleichszeitraum 2014 waren es 1087 Sonnenscheinstunden. Die Tageshelligkeit sinkt im August vom Monatsanfang bis Monatsende um fast zwei Stunden. Am 31. August werden den Bauern, Kleingärtnern, Wanderfreunden und Freizeitsportlern aber noch 13 Stunden und 38 Minuten Helligkeit für ihre Betätigung in freier Natur zur Verfügung stehen.
Die höchste Windstärke wurde mit Stufe 6 der Beaufort-Grad-Warnskala am 7., 25. und 26. Juli gemessen. Bei dem starken Wind schwankten starke Äste, und so mancher Ast und unreifer Apfel fiel vom Baum. bdx1
Quelle: Lausitzer Rundschau, 05.08.2015
Elbe-Wasserstand sinkt weiter - Kleine Bäche in Sachsen trocken
Dresden
Die Elbe in Dresden ist nur noch ein Viertel ihrer selbst. Der Wasserstand am
Pegel Augustusbrücke lag am Montag noch bei 50 Zentimetern - normal sind zwei
Meter. Mit 59 Kubikmetern pro Sekunde war auch der Durchfluss nur fast halb so
groß wie der untere Mittelwert.

Der Pegel zeigt fünfzig Zentimeter, etwa ein Viertel des normalen Wertes. Foto: Matthias Hiekel (dpa-Zentralbild)
Vom historischen Tief sei der Fluss aber weit entfernt, sagte Hydrologe Uwe Höhne vom Landeshochwasserzentrum in Dresden. So sei es 1947 und 1952 bis auf 21 Zentimeter runtergegangen, seitdem habe sich aber auch das Flussbett ständig verändert, etwa durch Ausbaggerungen.
Laut Höhne wird in den tschechischen Talsperren kein Wasser mehr zurückgehalten, da die Schifffahrt eingestellt ist und die Talsperren im Einzugsgebiet der Elbe keine Kapazität mehr haben. «Alles, was reinkommt, läuft durch.» Der Fluss profitiere derzeit von aus Felsen laufendem Nass und Grundwasser. Obwohl kleine Bäche in Sachsen schon versiegt sind, rechnet Höhne trotzdem nicht damit, dass auch die Elbe trocken fällt. «Der Wasserstand wird noch eine Weile gleichbleiben oder langsam weiter fallen.» dpa
Quelle: Lausitzer Rundschau, 10.08.2015
Hitzestress in Südbrandenburger Fischteichen
Update |
Spree-Neiße Extreme Trockenheit und Hitze machen den Teichwirten zu schaffen,
die nicht von Spree und Oder profitieren, sondern mit dem auskommen müssen, was
Grundwasser und Himmel hergeben. Um Forst, in Groß Schacksdorf und in Guben ist
die Lage kritisch.
Der Euloer Teichwirt Christoph Junghanns sorgt sich um den Fischbestand in seinen Teichen. Der Wasserstand und der Sauerstoffgehalt sinken dramatisch. Im Hintergrund ist schon der Teichboden zu sehen. Die Frischwasserzufuhr aus der Malxe und Grabensystemen ist erschöpft. Helfen können nur noch 150 Liter Regen pro Quadratmeter, möglichst bald. Foto: Beate Möschl
150 Kilogramm Zander hat der Euloer Teichwirt Christoph Junghanns am Montag aus dem Großen Rosswinkel im Forster Ortsteil Mulknitz ablesen müssen. Sie haben das Hitzewochenende nicht überlebt. Die Karpfen versuchen noch, dem Hitzestress standzuhalten. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zeigt das Messgerät an der tiefsten Stelle des Fischteiches 25,7 Grad Celsius Wassertemperatur und 1,1 Milligramm Sauerstoff pro Liter.
"2,5 Milligramm sind die physiologische Untergrenze für Karpfen. Sinkt der Sauerstoffgehalt unter den Wert, ist mit dauerhaften Schäden zu rechnen." 2500 zweisömmrige Karpfen hat der Teichwirt hier im Frühjahr eingesetzt. Die müssten jetzt eigentlich viel fressen, damit sie zu Weihnachten und Silvester ordentlich Gewicht auf die Waage bringen und gut gefragt über den Ladentisch gehen. Doch in diesem Sommer ist alles anders. "Die Karpfen schieben jetzt Kohldampf. Wegen des Sauerstoffmangels im Teich mussten wir die Fütterung einstellen, sonst sterben sie uns weg." Statt der für die Jahreszeit üblichen zwei Kilogramm haben die Karpfen erst 1200 Gramm Gewicht erreicht. Abfischen und Umsetzen kann der Euloer seine Fische nicht. "Es sind alle Teiche betroffen, uns fehlt der Frischwasserzulauf. Die meisten Gräben sind trocken oder haben nur noch stehendes, mit Eisenocker belastetes Wasser. Das können wir nicht zuführen", sagt Junghanns und fügt an: "Was wir jetzt bräuchten, wäre ein kräftiger Regen, mindestens 150 Liter pro Quadratmeter. Das muss ja nicht alles an einem Tag runterkommen."
Ähnlich sieht es Ralf Müller, Geschäftsführer der Teichwirtschaft Janke&Müller GbR, aus Tauche bei Beeskow (Oder-Spree), die unter anderem Fischteiche in Guben und der Gemeinde Schenkendöbern bewirtschaftet. Aus dem Schwarzen Fließ in Guben komme zu wenig Wasser. "Die Niederschläge fehlen und der Grundwasserspiegel ist stark abgesunken", sagt Müller. Das mache die Situation in den Sprucker Teichen kritisch. "Noch geht es, aber wir prüfen das Notabfischen und Umsetzen der Karpfen. Ich hoffe, es regnet bald." Im Speicherbecken Krayne und den Lübbinchener Teichen sehe es noch ganz gut aus. "Hier profitieren wir von Quell- und Schichtenwasser, aber auch das ist niederschlagsabhängig."
Auch der sächsische Teichwirt Armin Kittner, der seit 2013 die Schacksdorfer Teiche (Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf) bewirtschaftet, sehnt Regen herbei. Er nennt die Situation "katastrophal, weil wir nicht eine Stelle haben, von der wir Wasser aus der Malxe bekommen, und allein auf das angewiesen sind, was die Himmelsteiche hergeben". Das ist nicht viel, wie er sagt. Schon der Winter sei zu trocken gewesen. "Der Schnee hat gefehlt. Deshalb waren schon im Frühjahr nicht alle Teiche voll. Die Trockenheit ist absolut extrem."
Kittner betreibt im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, bei Quitzdorf, seit 1992 eine eigene Teichwirtschaft. Die Schacksdorfer Teiche hat er zusätzlich gepachtet, von der Peitzer Edelfisch GmbH. Auch der Euloer Teichwirt Christoph Junghanns ist Pächter bei der Peitzer Edelfisch-GmbH. Bis 2023 läuft sein Pachtvertrag. Ob er sich dann noch einmal langfristig festlegen wird, das vermag er heute nicht zu sagen. Überlegt hat er schon, ob es sich lohnt, unter den Bedingungen weiterzumachen.
1992/93, 2003 und 2006 habe es bereits ähnliche Extreme gegeben. "Doch so trocken, wie in diesem Sommer, hatten wir es noch nicht. Natürlich haben wir gelernt und in weiser Voraussicht in diesem Jahr einige Teiche gar nicht geflutet, darunter die drei großen Teiche, die ich 2006 abfischen musste. Aber, alles kann der Teichwirt nicht alleine stemmen", sagt Junghanns mit Blick auf das, was die Teichwirte in der Extremsituation zusätzlich belastet: das In-Schach-Halten von Kormoran und Fischreiher und die Pflege der Teichlandschaft, in der sich ein Tausendfaches mehr an Artenvielfalt entwickelt als in einem Maisfeld, wie der Euloer sagt. "Wenn wir das Teichgebiet erhalten wollen, muss auch ein Ertrag rauskommen. Ich bestelle den Teich wie ein Landwirt sein Feld. Ich muss die Fische vorher großpäppeln. Wenn mir dann jemand die Fische wegnimmt, kann ich die Anfangskosten nicht decken." 70 000 bis 80 000 Euro Verlust bescheren Kormoran und Fischreiher dem Euloer nach eigenen Angaben schon bei normalen Wasserständen. "In diesem Jahr wird es erheblich mehr sein." Mitleid könne er nicht gebrauchen, äußert Junghanns. "Hilfreich wäre ein flächendeckendes Management geschützter Arten, die in Teichwirtschaften große Schäden zufügen". Beate Möschl
Quelle: Lausitzer Rundschau, 11.08.2015
Fische- Rettungsaktion in der Schwarzen Elster
Senftenberg. Die Natur leidet extrem unter der anhaltenden Hitze. Die Schwarze Elster ist bei Kleinkoschen fast trocken gefallen. Aus der noch etwa 40 Zentimeter hohen Schlammbrühe im Flussbett retten Naturfreunde in Regie von Kreisgewässerwart Ralf Stephan deshalb jetzt die Fische vor dem Erstickungstod. Stattliche Karpfen sind überraschend im Kescher gelandet. kw
Quelle: Lausitzer Rundschau, 15.08.2014
Trotz Regen weiterhin Waldbrandgefahr
Oder-Pegel sinkt noch immer / Juli heißester Monat seit 135 Jahren
Der Juli 2015 war der weltweit heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880. Im Schnitt war es 16,61 Grad warm - 0,81 Grad mehr als im Mittel des 20. Jahrhunderts. Folgen in der Region: sinkende Flusspegel, brennende Wälder.
Potsdam. Die wenigen Regenfälle der vergangenen Tage haben gegen die Trockenheit in Brandenburg kaum etwas ausrichten können. In vielen Regionen ist die Waldbrandgefahr weiter hoch.
Auch die Flüsse führen immer noch Niedrigwasser. An der Oder sinken die Pegel derzeit sogar weiter, sagte eine Sprecherin des Wasser- und Schifffahrtsamtes Eberswalde am Donnerstag (20.08.2015)…..
… Auch Flüsse haben kaum vom Regen profitiert. Am Elbepegel Wittenberge wurde am Donnerstagnachmittag (20.08.2015) eine Wasserhöhe von 118 Zentimetern gemessen. Das sind zwar 20 Zentimeter mehr als noch vor zehn Tagen, der Wert liegt aber deutlich unter dem für das Mittlere Niedrigwasser, teilte die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mit.
Noch schlimmer ist es an der Oder. "Die Pegel sinken immer noch", sagte eine Sprecherin des Schifffahrtsamtes. An der Messstation Frankfurt (Oder) sei der Wasserstand auf 92 Zentimeter gesunken. Für die Schifffahrt habe das weitreichende Folgen. Bei einer solchen Wasserhöhe könnten nur noch Schiffe mit einen Tiefgang von maximal 50 Zentimetern fahren. Das gelte eigentlich nur für Sportboote. dpa/bf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 21.08.2015 (auszugsweise)
Dampfschiffe auf Elbe legen wieder ab
Dresden. Nach fast zwei Wochen Pause wegen Niedrigwassers der Elbe will die Sächsische Dampfschiffahrt am heutigen Dienstag (18.08.2015) den Betrieb wieder aufnehmen. Aufgrund des leicht gestiegenen Wasserstands und der Vorhersage werde davon ausgegangen, dass Stadtrundfahrten sowie die Nationalparklinie und eine weitere verkürzte Tour in der Sächsiscben Schweiz wieder angeboten werden können, teilte das Unternehmen am Montag (17.08.2015) mit. Es gelte ein Sonderfahrplan. Die historischen Raddampfer lagen seit dem 5. August (2015) am Pier fest, nachdem der Pegelstand unter 60 Zentimeter gefallen war. dpa/uf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 18.08.2015
Kein Niedrigwasser in Spreewaldfließen - Kahnfahrt ungehindert
Lübbenau/Burg Kein Niedrigwasser in den Spreewald-Fließen: Die Kähne können trotz der großen Hitze ungehindert durch das kleinteilige Wassernetz fahren. «Wir schwitzen, aber sonst ist alles ok», sagte der stellvertretende Hafenmeister am Spreehafen Burg, Thomas Petsching, am Dienstag (11.08.2015).
Wegen der andauernden Trockenheit führen Elbe und Oder in Brandenburg derzeit starkes Niedrigwasser - nicht so im Spreewald.
Das liegt laut Petsching auch daran, dass die Fließe keine direkte Sonneneinstrahlung haben. «Wir haben zu 80 Prozent Schatten durch die vielen Bäume.» Sein Kollege Steffen Franke von der Kahnfährgenossenschaft Lübbenau ergänzte: «Der Spreewald ist wie ein Schwamm.» Er sauge sich an Uferbereichen in niederschlagsreichen Zeiten mit Wasser voll. Dieses fließe derzeit zurück in die Fließe. dpa
Quelle: Lausitzer Rundschau, 11.08.2015
Anm.: Ganz so wie oben geschildert, ist es nicht. Ohne Zuschusswasser aus der
Tagebauentwässerung von Vattenfall sehe es schon ein wenig dramatischer aus.
Wasser aus aktiven Tagebauen hilft dem Spreewald gegen Trockenheit
Cottbus. Alle verfügbaren Brunnen in den Vattenfall-Tagebauen laufen nach derzeit auf vollen Touren, um möglichst viel Wasser in die Spree zu leiten. Damit käme das Unternehmen einer Bitte der Wasserbehörden angesichts der großen Trockenheit nach.
Derzeit würden täglich 600 Millionen Liter (entspricht 600.000 m3 bzw. 6,9 m3/s) in den Fluss abgegeben, was fast der Gesamtmenge entspricht, die am Eingang des Spreewaldes fließe.
Die drei Braunkohlekraftwerke der Region fahren gleichzeitig im oberen Leistungsbereich. Sie müssten auf ein geringes Angebot an Wind-, aber große Mengen Solarstrom in der Mittagszeit reagieren und entsprechend den Anforderungen für Versorgung und Netzstabilität hoch- und runtergefahren werden. Sim
Quelle: Lausitzer Rundschau, 13.08.2015
Region: Hunderte Brunnen füllen die Spree
21. August 2015 | Von CGA Verlag | Kategorie: Region


Der Durchflussmesser dieses Brunnen im Tagebau Jänschwalde zeigt:
178 Liter Grundwasser werden von diesem pro Minute gehoben (links)
So sieht ein Brunnen zur Tagebauentwässerung aus.
Hier handelt es sich um einen Randriegel (rechts)

Über eintausend Punkte zeigt diese Karte vom Tagebau Jänschwalde. Dr. Stephan Fisch weiß, dass jeder Punkt für einen Brunnen steht. Außenherum die Randriegel und innen die Feldriegel. Der Leiter der Tagebauentwässerung erklärt, dass die Region bei Trockenheit ein großes Niedrigwasserproblem ohne dieses zusätzliche Wasser hätte Fotos: Mathias Klinkmüller
Lausitz profitiert von der Tagebauentwässerung:
Region
(mk). Auf der Elbe bei Dresden kann derzeit kein Schiff mehr fahren. Die
Trockenheit führt zu Niedrigwasser. Rein rechnerisch, da ist sich Dr. Stephan
Fisch sicher, hätten die Spreewälder Fließe ohne das Tagebaugrundwasser ein
ähnliches Schicksal. Der Leiter der Tagebauentwässerung bei Vattenfall verweist
auf den derzeitigen Wasserstand der Spree. Oberhalb von Boxberg bei Lieske
kommen derzeit 3,3 Kubikmeter Spreewasser pro Sekunde an. Aus den Tagebauen
Reichwalde, Jänschwalde, Welzow, Nochten und Cottbus-Nord werden 6,75
Kubikmeter Tagebaugrundwasser hinzugegeben.
Im Ergebnis fließt in Cottbus im Vergleich zur Messung in Lieske die dreifache
Wassermenge Richtung Spreewald. 583 Millionen Liter zusätzliches Wasser sind das
täglich. Gerade bei Trockenheit ist dieser Zufluss durch die Tagebaue ein Segen,
sagt Dr. Stephan Fisch. Ein Segen, mit dem in Zukunft immer weniger zu rechnen
sein wird. Weniger Tagebaue bedeuten auch weniger Grundwasser, das eingeleitet
wird. Der Experte verweist darauf, dass es bei der Tagebauentwässerung
vordergründig auch nicht um Spreewald-Hilfe bei Trockenheit geht, sondern um die
Standsicherheit der Großgeräte und somit der Mitarbeiter in den Tagebauen. Die
Entwässerung ist dabei eine Mammutaufgabe für die Planer. Im gesamten Lausitzer
Revier werden Jahr für Jahr 420 Millionen Kubikmeter Wasser gehoben. Dreitausend
Brunnen, davon allein 1056 im Tagebau Jänschwalde, erledigen diese Aufgabe.
Dabei unterscheidet der Leiter der Tagebauentwässerung Randriegel von
Feldriegeln. Die Rand-riegel sorgen dafür, dass kein neues Wasser dem Tagebau
zufließt. Die Feldriegel verlaufen parallel zum Bagger und sorgen für stabile
Böschungen. Wie viel Wasser jeder einzelne Brunnen fördert, kann vor Ort aber
auch vom zentralen Leitstand in Schwarze Pumpe abgelesen werden. Zwischen 50 und
2000 Liter pro Minute schafft ein Brunnen nach oben zu pumpen. Das
Tagebaugrundwasser fließt dann zunächst zu den Grubenwasserbehandlungsanlagen an
den Kraftwerken. Hier wird es als Kühl- und Brauchwasser genutzt. Das restliche
Grubenwasser wird dann an die Spree abgegeben. „Unsere Daten werden wöchentlich
an die Wasserbehörden sowie der Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft übergeben, die mithilfe ihrer Flutungszentrale
den Spreeabfluss in der Region steuert“, erklärt Dr. Stephan Fisch. Auch die
Neiße profitiert mit zehn Millionen Kubikmeter pro Jahr. Die Malxe oder die
zwischen Jänschwalde, Tauer und Peitz gelegenen Laßzinwiesen, aber auch die
Peitzer Teiche werden mit Tagebauwasser unterstützt.
Quelle: Märkischer Bote, 22.08.2015
Fehlende Staustufe bereitet Saspower Anwohnern Sorgen
Grundwasserspiegel sinkt, Brandgefahr steigt
Cottbus Auf seiner diesjährigen Sommertour hat der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Schierack (CDU) in Saspow Station gemacht. Die Anwohner haben ihn zunächst mit einem ganzen Bündel von Problemen konfrontiert und ihn dann auf den Saspower Spreedeich "entführt".

Hans Pschuskel (v. l.) und Karsten Gohr zeigen Michael Schierack, wie hoch der gestaute Wasserpegel der Spree früher war. Foto: hil
Dort stiegen die Saspower Hans Pschuskel und Karsten Gohr sogar ins Wasser, um zu demonstrieren, was ihrer Meinung nach schief gelaufen ist.
"Hier wurde nämlich eine Fischtreppe eingebaut und eine kanugängige Fahrrinne", erklärt Hans Pschuskel.
Jetzt aber fließe das Wasser so rasch ab, dass die Wiesen – auch wegen des sinkenden Grundwasserspiegels – immer mehr abtrocknen und irgendwann zur Brandgefahr für den Ort werden.
Michael Schierack will sich zunächst einen Überblick verschaffen, warum die Staustufen abgebaut wurden. "Nach einem Gespräch mit dem Landesumweltamt wissen wir, ob es eine Lösung für das Problem gibt." Hil
Quelle: Lausitzer Rundschau, 21.08.2015
Anm.: Sind das die Folgen des Projektes „Renaturierung der Spree“.?
BUND drängt Sachsen zu neuer Elbe-Politik
Dresden. Angesichts der sinkenden Wassermenge hat der Umweltverband BUND Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) zu einer Neuausrichtung seiner Elbe-Politik aufgefordert. Die Vorstellung eines logistisch sicheren und planbaren Güterverkehrs auf der Elbe habe sich als Chimäre erwiesen, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am Freitag (11.09.20015) in Dresden. „Das Monate währende Niedrigwasser der Elbe hat den Schiffsverkehr lahmgelegt." Stattdessen solle der Güterverkehr vom Wasser auf die Schienen verlagert werden. dpa/jbl
Quelle: Lausitzer Rundschau, 12.09.2015
Anm.: Es ist ein großer Irrtum anzunehmen und zeugt von wenig Sachverstand, dass die Schifffahrt von einer „sinkenden Wassermenge“ abhängig ist.
Es interessieren für die Schiffahrt nur Wasserstände und Tauchtiefen.
Aber irgendwie muss man ja seine Existenzberechtigung nachweisen.
Da kann man nur gespannt sein, welche Argumente (z.B. zusätzliche Landinanspruchnnahme,
Lärmbelästigung, Naturschutzbelange u.ä.) bei einer Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Schiene ins Feld geführt werden.
Trennmole für Mühlbergs Hafen
Eine Million Euro werden investiert / Naturschützer bleiben skeptisch
Mühlberg Die wasserseitige Einfahrt zum Elbehafen Mühlberg wird für fast eine Million Euro saniert. Zwei Hochwasser haben die aus Sand bestehende alte Trennmole komplett abgetragen und im Flussbett abgelagert. Jetzt wird sie mit Wasserbausteinen neu errichtet. Für Naturschützer ist das Geldverschwendung. Die Elbe habe zu wenig Wasser, um sie ganzjährig befahren zu können, sagen sie.

Vor dem Baggerponton "Bussard” im Hintergrund verläuft die Elbe. Das Motorboot im Vordergrund liegt schon in der Hafeneinfahrt. Foto: Frank Claus
Ein Schiff wird kommen – Dalida hat es gesungen. Caterina Valente und Nana Mouskouri auch. Nur in Mühlberg ist das mit dem Schiffsverkehr nicht ganz so einfach. Auf der Kaimauer warten seit Wochen Holzstapel auf den Abtransport. Die Elbe hat wieder mal akutes Niedrigwasser. Die Schifffahrt war lange Zeit ganz eingestellt. Selbst "Kaiser Wilhelm" hat kürzlich kapituliert. Einer von nun noch zwei kohlebefeuerten Dampfschiffen auf der Elbe lag lange in Roßlau fest, bevor es zum ersten Mal seit seinem Stapellauf 1900 wieder nach Dresden fahren konnte.
Doch Vertreter von Bund, Land und Wirtschaft wollen nicht locker lassen, sehen in der Elbe eine auszubauende, wichtige Bundeswasserstraße. Für die Tschechen ist es der direkte Weg zu den Ostseehäfen.
In Mühlberg wird gegenwärtig die Hafeneinfahrt saniert. An der flussaufwärts liegenden Seite wird mit Schüttsteinen eine etwa 200 Meter lange Trennmole errichtet. Eingebaut werden etwa 9000 Tonnen Wasserbausteine in extra großer Kubatur. Die sollen so den starken Hochwasser-Strömungen standhalten. Die Mole wird sechs Meter breit sein. Bauleiter Stefan Kopplow von der Domarin Tief-, Wasserbau und Schifffahrtsgesellschaft mbH mit Sitz in Vilshofen an der Donau sieht allerdings ein Problem: "Wenn die Elbe weiter Niedrigwasser führt, kann ,Bussard', das ist ein Baggerponton, nicht weiterarbeiten. Dann haben wir wohl Baustopp." Denn der Bagger holt die durch die zurückliegenden Hochwasser angespülten Sande aus der Fahrrinne. Die sollen später im angrenzenden See des Hafenbeckens verkippt werden. Auch landseitig wird die Hafeneinfahrt direkt an der Einmündung neu gestaltet. 10 000 Kubikmeter Boden werden bewegt.
Wie die Hafeneinfahrt beschaffen sein muss, um nicht wieder durch die Strömungsverhältnisse zu versanden, ist vorher per hydronumerischer Modellierung am Computer bei verschiedenen Hochwasservarianten ermittelt worden.

Seit Wochen liegen die Holzstapel auf der Kaimauer. Das Niedrigwasser der Elbe verhindert den Abtransport. Foto: Frank Claus
Für den Naturschutzbund BUND ist das alles rausgeschmissenes Geld. Der Bundesvorsitzende Hubert Weiger hat auf dem kürzlichen Elbe-Kirchentag in Dessau-Roßlau erklärt: "Zu lange wurde an dem Glauben festgehalten, dass sich aus der Elbe eine ganzjährig befahrbare Wasserstraße machen lässt. Dies ist gründlich gescheitert. Mehrere Hundert Millionen Euro wurden in den letzten 20 Jahren in die Häfen und die Wasserstraßen Elbe und Saale gesteckt. Die Elbe ist als Wasserstraße passé. Ein Verkehrsträger ohne Verlässlichkeit ist sinnlos. Für die Elbe brauchen wir andere Zukunftsvisionen, als sie die Bundesregierung und das Land derzeit mit utopischen Fahrrinnentiefen und der Fixierung auf die Güterschifffahrt verfolgen." Der naturnahe Charakter der Flusslandschaft Elbe müsse erhalten und gestärkt werden. Die Schifffahrt müsse sich den Bedingungen der Elbe anpassen und nicht umgekehrt, forderte der BUND-Vorsitzende.
Elbe-Experte Dr. Ernst Paul Dörfler erklärt gegenüber der RUNDSCHAU zu den Bestrebungen, Staustufen einzubauen. "Tschechien verfolgt den Staustufenbau bis zur deutschen Grenze. Innerhalb Deutschlands wären allein bis zum Wasserstraßenkreuz Magdeburg 20 Staustufen, bis Hamburg 30 Staustufen nötig, um die Elbe zu einer ganzjährig befahrbaren Wasserstraße auszubauen. Schon 1992 wurde dazu eine Kosten-Nutzen-Rechnung durch die Bundesregierung angestellt: Die Kosten würden den Nutzen um den Faktor zehn übertreffen." Frank Claus
Quelle: Lausitzer Rundschau, 15.09.2015
Und so sah es an der Oder aus:
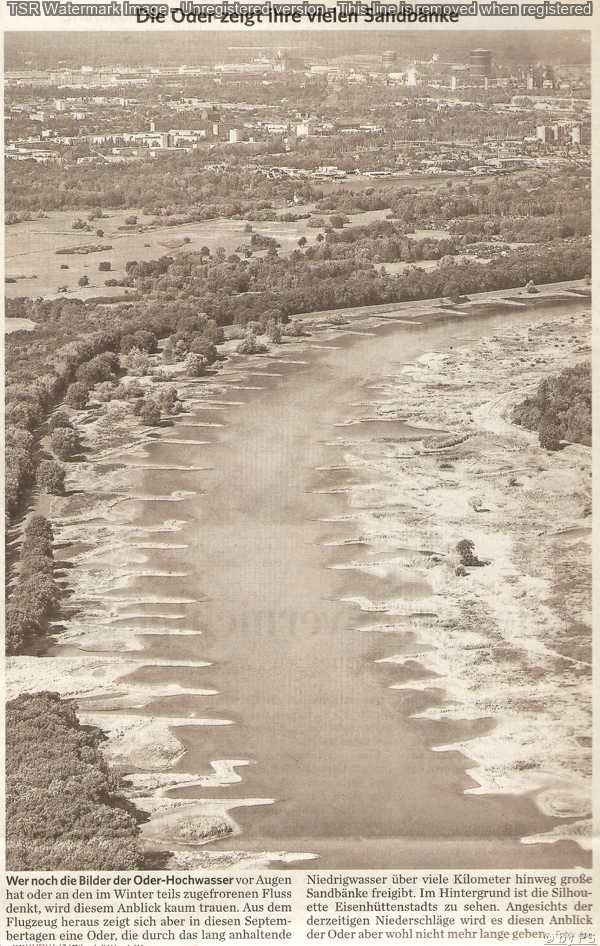
Quelle: Lausitzer Rundschau, 15.09.2015
Zusätzliches Wasser für den Pastlingsee
Grabko Der Pastlingsee bei Grabko bekommt nun zusätzliches Wasser aus der Wasserfassung Drewitz. Darüber hat Vattenfall informiert.
Der seit Jahren sinkende Wasserstand des Sees und die extreme Verschlammung hatten im Juli zu einem dramatischen Fischsterben geführt. Mehrere Hundert Kilogramm tote Fische mussten die Bärenklauer Angler aus dem See bergen. Die noch lebenden Zander, Hechte, Plötzen und Bleie wurden in andere Gewässer umgesetzt. Laut Vattenfall sind natürliche Ursachen verantwortlich für den Zustand des Sees. Aufgrund fehlender Niederschläge habe sich in den vergangenen Jahren die Wasserfläche des Pastlingsees wie auch vieler anderer Flachwasserseen sichtbar reduziert. Es liege an dem extrem flachen Ufer, dass sich bereits bei Wasserstandschwankungen von zehn Zentimetern die Wasserfläche um einige Meter zurückziehe, so das Unternehmen. Ein Zusammenhang mit der Grundwasserabsenkung für den Tagebau Jänschwalde bestehe nicht. Sven Hering
Quelle: Lausitzer Rundschau, 05.10.2015
Elbe-Kommission sieht neues Problem in Niedrigwasser
Dresden Die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe sieht nach dem Erfolg beim Hochwassermanagement weitere Probleme. Präsident Helge Wendenburg zog zum 25-jährigen Bestehen am Donnerstag
(08.10.2015) in Dresden positiv Bilanz, nannte aber Nährstoffbelastung und die Folgen des Niedrigwassers als Aufgaben.Der chemische Zustand der Elbe habe sich durch Reduzierung der Altlasten und der Belastung durch Abwasser zwar verbessert. "Es gibt aber nach wie vor eine zu hohe Belastung mit Nährstoffen aus Landwirtschaft und Industrie, die sich am Ende auch im Meer wiederfinden." dpa/uf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 09.10.2015
Elbe- Dampfschifffahrt verkauft 30 Prozent weniger Tickets Dresden.
Die Sächsische Dampfschiffahrt hat nach einem schwierigen Vorjahr (2014) Verluste eingefahren. Die Zahl der verkauften Fahrscheine ging um 30 Prozent auf rund 402 000 Tickets zurück, teilte das Traditionsunternehmen am Dienstag (22.03.2016) mit.
Zahlen zu Umsatz und Gewinn machte die Dampfschiffahrt nicht. Es werde aber ein deutliches Minus geben, so Geschäftsführerin Karin Hildebrand.
Wegen des extremen Niedrigwassers im vorigen Sommer (2015) musste an insgesamt 15 Tagen der Fahrbetrieb auf der Elbe eingestellt werden, über drei Monate hinweg konnten die historischen Schaufelraddampfer und Motorschiffe nur eingeschränkt fahren. dpa/bl
Quelle: Lausitzer Rundschau, 23.03.2016
Und so sah die Elbe auch schon einmal (oder schon mehrmals?) aus:
Elbe 1905
Umweltschützer lehnen Elbe-Staustufe ab
Chemnitz. Der Bund für Umwelt, und Naturschutz Deutschland lehnt die geplante Elbe-Staustufe im tschechischen Decin ab. Gestern (09.05.2016) gab die Organisation ihre Stellungnahme zu dem Projekt ab und bezweifelte dessen Sinn und Nutzen.
"Seit Jahrzehnten geht der Güterverkehr auf der Elbe in Tschechien wie in Deutschland zurück und ist inzwischen bei einem historischenTief angekommen", sagte Sachsens Bund-Vize Lars Stratmann. Eine Belebung der Güterschifffahrt sei auch durch den Bau von Staustufen nicht zu erwarten. dpa/uf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 11.05.2016
Anm.:
Vielleicht ist der Güterverkehr auf der Elbe gerade wegen der fehlenden Staustufe auf einem „historischen Tief“ angekommen. Die fehlende Staustufe sollte sicher auch einen Beitrag zur Niedrigwasser-Aufhöhung leisten, die auch der deutschen Seite zugutekommen könnte.
Musste in den vergangenen Jahren nicht öfter die Elbeschiffahrt wegen Niedrigwasser eingestellt werden und zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führte.
Natürlich müssen alle Vor- und Nachteile eines solchen Eingriffs sorgfältig abgewogen werden.
Die Elbe steht im Stau
Sachsen lehnt Staustufe Decin ab / Land macht sich große Sorgen um bedrohte Fische
Dresden Trotz aller Bedenken will Tschechien eine weitere Staustufe in die Elbe bauen. Aber von den neuen Plänen hält Sachsen so wenig wie von den alten.
Die Pläne zum Bau der Staustufe haben die tschechischen Behörden nun zwar nochmals überarbeitet – soweit das Neue. Aber auf sächsischer Seite bleibt alles beim Alten:
Die Bedenken bleiben schwer. Insoweit hatte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Dienstag in Dresden wenig Spektakuläres zu berichten.
Man habe über die Jahre nun schon die vierte oder fünfte Stellungnahme zu dem umstrittenen Bauprojekt geschrieben, sagte er.
Trotzdem hat sich "grundsätzlich nichts geändert". Die entsprechende Stellungnahme zur grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung ging
Ende vergangener Woche fristgerecht beim Umweltministerium in Prag ein.
Große Umweltauswirkungen
Sachsen hält grundsätzlich wenig davon, dass Tschechien die Elbe bei Decin stauen will. Das hat Schmidts Amtsvorgänger Frank Kupfer (CDU) zuletzt 2012
in einer Stellungnahme klargemacht. Die geplante Staustufe soll zwar elf Kilometer vor der sächsischen Grenze entstehen, hätte aber flussabwärts gravierende Umweltauswirkungen. Aber da hat der überarbeitete Vorschlag aus Prag wenig an Verbesserungen zu bieten, meint Schmidt.
Zwar sind für wandernde Fische inzwischen Fischtreppen an der Staustufe vorgesehen, aber die führen nur aufwärts, nicht abwärts.
Der Fischbestand hat sich zwar in den letzten Jahren erholt – auf tschechischer wie auf deutscher Seite. Wenn aber den Fischzügen ein weiteres Hindernis
in den Weg gestellt wird, kann es wieder trübe werden im Lebensraum Elbe.
Besonders für geschützte Fischarten wie Neunauge, Lachs, Rapfen, Bitterling und Groppe. Sie können an Rechenanlagen hängen bleiben
oder in die Turbinen geraten. Ihre Laichplätze könnten verschwinden oder unerreichbar werden. Der Nachweis, "in welchem Maße Ökosysteme und Arten
im sächsischen Abschnitt der Elbe beeinträchtigt werden können", ist nach Ansicht Sachsens in den neuen Planungsunterlagen nicht erbracht.
Außerdem fordert die schwarz-rote Staatsregierung von den Tschechen eine Zusicherung, dass sich der Wasserzustand der Elbe
auf sächsischem Gebiet nicht verschlechtern wird.
Die inzwischen geplante Renaturierung im Umfeld der Anlage wertet Schmidts Haus positiv. Trotzdem bleibt das Ungetüm im Wasser ein Hindernis,
das Strömungsverhältnisse elbabwärts völlig auf den Kopf stellt.
Fachleute warnen
Die sächsischen Experten warnen deshalb in der Stellungnahme vor einer "hohen Wechseldynamik von Sedimentations- und Rücklösungsprozessen",
wenn die Anlage denn einst im Dauerbetrieb laufen sollte. Aber ob die Staustufe wirklich kommt, ist durchaus fraglich. Prag verspricht sich davon mehr Schiffsverkehr,
denn bislang fließt die Elbe oberhalb Sachsens eher flach. Zwar haben die deutschen Elbländer ein Wörtchen mitzureden, aber mehr als Bedenken äußern können sie nicht.
Sachsen hat in der Sache kein Klagerecht, tippt aber in seiner Stellungnahme auf die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Wenn das Staustufenprojekt die
Umweltanforderungen aus Brüssel nicht erfüllt, werden kaum Fördermittel für den Bau fließen.
Zum Thema:
Staustufen sind Wasserbauwerke zum Aufstauen eines Flusses.
Damit soll der Wasserstand flussabwärts oder auch flussaufwärts beeinflusst werden. Im Unterschied zu einem Staudamm sperrt eine Staustufe nicht die
gesamte Breite des Flusstales ab, sondern nur den Fluss selbst. Oft werden für Staustufen Wehre verwendet, die auch beweglich sind.
Hinzu kommt eine Anlage, mit der Schiffe geschleust werden können.
In Tschechien verspricht man sich von der umstrittenen Staustufe in der Elbe bei Decin eine ganzjährige Befahrbarkeit des Flusses für Frachtschiffe.
Gerade in den Sommermonaten kommt es wegen Niedrigwasser immer wieder dazu, dass die Schiffe im Hafen bleiben müssen.
Mit der Staustufe will Tschechien den Wasserstand in solchen Zeiten auf einem konstanten Niveau halten.
Kritiker ziehen das aber in Zweifel und verweisen auf negative Folgen für den Naturschutz.
Christine Keilholz
Quelle: Lausitzer Rundschau, 11.05.2016 (auszugsweise)
Näheres unter :
http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Die-Elbe-steht-im-Stau;art1047,5465853
Anm.:
Das Trockenjahr 2018 macht es jetzt den selbst ernannten Umweltschützern
diskussionslos möglichst jedes angedachte Vorhaben zu torpedieren.
Schiffsverkehr
Umweltverbände: Elbe als Wasserstraße Auslaufmodell

Wassermangel bringt immer wieder den Schiffsverkehr zum Erliegen. FOTO: dpa / Philipp Schulze
...Für Umweltverbände aus Deutschland und Tschechien ist die Elbe als Wasserstraße ein Auslaufmodell....
...Es sei illusorisch zu glauben, dass sich die Schiffbarkeit der Elbe in Deutschland maßgeblich verbessern würde, sagte Iris Brunar
vom Elbeprojekt des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)....
…Vieles, was derzeit noch extrem erscheint, wird in den kommenden Jahrzehnten üblich werden, denn durch den Klimawandel erleben wir
sowohl Trends – Veränderung der mittleren Verhältnisse über mehrere Jahrzehnte - als auch eine Vergrößerung der Schwankungsbreiten…
…Konstante Fahrbedingungen, wie man sie für die Planung von Gütertransporten auf der Elbe benötige, seien in Zukunft noch weniger
als jetzt zu erwarten, teilten die Verbände mit....
...Deshalb brauche man ein Umdenken an der Elbe....
...Statt den Fluss auszubauen, sollte man sein touristisches Potenzial nutzen....
...Seit mehr als zwei Jahrzehnten kritisiere man die Planung weiterer Staustufen an der Elbe, hieß es....
...BUND und Arnika forderten die sofortige Einstellung der Staustufenplanungen.... (dpa/uf)
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 28.08.2018
Ausführlich unter:
Anm.:
Damit vielleicht u.a. die Sächsische Dampfschiffahrt nach einem schwierigen Vorjahr (2014) keine Verluste bei Niedrigwasser in der Elbe
einfährt.
Es muss auch einmal geklärt werden:
Wer ist denn eigentlich für wen da:
Der Mensch im Einklang mit der Natur oder genießt die Natur Vorrang zu Ungunsten des Menschen.
Es ist wieder "Niedrigwasser-Zeit" in der Elbe:
Wassermangel in der Elbe
70 Zentimeter statt zwei Meter gemessen / Dampfschiffahrt muss Fahrten reduzieren
Dresden Wegen anhaltenden Niedrigwassers können Elbdampfer in der Sächsischen Schweiz nur noch eingeschränkt verkehren.
Die Sächsische Dampfschiffahrt hat ihre Fahrten zwischen Dresden und Bad Schandau nach eigenen Angaben am Montag (29,08.2016) reduziert.
Auch in diesem Jahr schrumpft die Elbe bei Dresden. Große Teile des Flussbetts sind ausgetrocknet. Foto: dpa
Am Pegel Dresden wurden am Morgen (29,08.2016) 70 Zentimeter – normal sind zwei Meter – gemessen, in Schöna an Grenze zu Tschechien 75 Zentimeter.
"Vormittags reicht das Wasser noch", sagte ein Unternehmenssprecher. Die Termine am Nachmittag könnten jedoch derzeit nicht bedient werden.
Bei fallender Tendenz kämen Schiffe dann nicht mehr über die extrem flachen Stellen in diesem Bereich. Dienstag (30,08.2016) solle neu entschieden werden, hieß es.
Zudem sind auf der Strecke nur noch historische Schiffe im Einsatz, die Passagierkapazität ist daher eingeschränkt.
"Wir wollen
den Fahrplan trotzdem so gut wie möglich aufrechterhalten." Schon im vergangenen
Jahr (2016)
hatte
Niedrigwasser die Saison d er Sächsischen Dampfschiffahrt beeinträchtigt.
Niedrigwasser herrscht derzeit in drei Viertel aller sächsischen Fließgewässer,
wie eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfUG) sagte. "Anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge machen sich
bemerkbar." Die Tendenz sei gleichbleibend.
dpa/uf
er Sächsischen Dampfschiffahrt beeinträchtigt.
Niedrigwasser herrscht derzeit in drei Viertel aller sächsischen Fließgewässer,
wie eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfUG) sagte. "Anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge machen sich
bemerkbar." Die Tendenz sei gleichbleibend.
dpa/uf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 30.08.2016
Niedrigwasser: Kaum noch Frachter und Dampfer auf der Elbe
Dresden. Das anhaltende Niedrigwasser bremst die Schifffahrt auf der Elbe aus. Sowohl Güter- als auch Fahrgastschiffe seien betroffen, sagte Klaus Kautz
vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Dresden gestern (30.08.2016) .
"Mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen."
Auf der anderen Seite freuten sich Sportboot-Fahrer und Paddler über schönes Wetter - und wenig Verkehr auf der Elbe.
Der Pegel in Dresden. hatte am Dienstag (30.08.2016) einen Wasserstand von 61 Zentimetern, normal sind zwei Meter.dpa/uf
Quelle: Lausitzer Rundschau, 31.08.2016
Besser geschützt und planbarer befahrbar
Magdeburg Wie weiter mit der Elbe? Als naturnaher, besser geschützter Fluss oder als verlässlicher Transportweg? Ein neues Konzept will jetzt alle Interessen bündeln.

Blick über die Elbe auf Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg. Foto: dpa
Vertreter des Bundes und mehrerer Landesregierungen sowie von Naturschutz- und Wirtschaftsverbänden haben das neue langfristige Entwicklungskonzept für die Elbe als großen Fortschritt und Meilenstein bezeichnet. Damit sei eine gute Arbeitsgrundlage
für die kommenden 20 bis 30 Jahre geschaffen worden, hieß es am Montag (27.03.2017) mehrfach auf einer Regionalkonferenz
in Magdeburg zum neuen Gesamtkonzept. …
... Kern des neuen Papiers sei es, dass Baumaßnahmen und Veränderungen an der Elbe nur umgesetzt werden dürften,
wenn sie sowohl der Ökonomie als auch der Ökologie nutzten…
…Nach Angaben der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler sind für die Umsetzung rund 300 Millionen Euro veranschlagt.
Ein Großteil davon sei für Umweltmaßnahmen vorgesehen…
Trotz eines Grundkonsenses sind viele Streitpunkte nicht ausgeräumt…
…Vor allem in den vergangenen Jahren hatte die Branche mit langen Niedrigwasserphasen zu kämpfen.
Mit Veränderungen an den Ufern und Aufschüttungen soll künftig an mehr als elf Monaten im Jahr
die Fahrrinne im Durchschnitt 1,40 Meter tief sein.... Franziska Höhnl und Christiane Raa
Quelle: Lausitzer Rundschau, 28.03.2017 (auszugsweise)
Ausführlich unter:
Sommer 2017: Spektakulär, aber für die Wasserversorgung, den Tourismus und andere Branchen unerfreulich
Atlantis soll nicht untergehen
Der Edersee, auch Ederstausee genannt, ist mit 11,8 km² Wasseroberfläche und mit 199,3 Mio. m³ Stauraum der flächenmäßig zweit- und volumenmäßig drittgrößte (siehe Liste) Stausee in Deutschland. Er liegt am Fulda-Zufluss Eder hinter der 48 m hohen Staumauer der Edertalsperre bei der Kernstadt von Waldeck im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen).
Waldeck Die Ruinen im hessischen Edersee locken an manchen Wochenenden Zehntausende Besucher an. Doch die Natur hat den Überresten alter Dörfer zugesetzt.
...Waldeck Die Ruinen im hessischen Edersee locken an manchen Wochenenden Zehntausende Besucher an....
...Doch die Natur hat den Überresten alter Dörfer zugesetzt....

Diese Brücke ist normalerweise im Edersee versunken
...Das mythenumrankte Inselreich Atlantis wurde berühmt, weil es unterging....
...Das Atlantis im nordhessischen Edersee ist dagegen bekannt, weil es auftaucht....
...Die Ruinen aufgegebener Dörfer haben sich zu einer Touristenattraktion entwickelt....
...Doch dieses Atlantis ist bedroht: Wasser und Sonne setzen den Mauerresten zu....
...Die Anwohner des Edersees versuchen auf unterschiedlichen Wegen, die Dorfstellen zu erhalten....
...Die meisten kommen wegen des Wassers....
...Die Pegelstände sind ein Politikum: Der Edersee soll die Weser-Schifffahrt sichern....
...Doch das Ablassen des Wassers ist ein Nachtteil für den Wassersport....
..."Unsere Marke ist der Edersee", sagt Claus Günther, Geschäftsführer der örtlichen Touristic GmbH....
...Doch wenn im Sommer die Pegel sinken, tauchen die Ruinen der alten Dörfer Berich, Asel und Bringhausen auf....
...Die Dörfer sind eine Attraktion, die für den See vielleicht immer wichtiger wird: "Wenn sich die Klimasituation vor Ort mit wenig Niederschlägen so weiterentwickelt, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit dem Thema umgehen", sagt Günther....
...Die alte Brücke bei Asel ist in hervorragendem Zustand und das Wahrzeichen des Edersee-Atlantis....
...Während alte Stützmauern ein paar Meter weiter kaum noch zu retten sind, hat der Förderverein zum Erhalt der Dorfstelle Berich die Konturen von vier Gebäuden einen halben Meter hoch aufgemauert....
...Und dort sieht man vor allem die Sicherung der Schifffahrt als Aufgabe – und nicht die Rettung alter Ruinen.... Göran Gehlen
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 11.07.2017
Ausführlich unter:
hydograhische Angaben zum Edersee:
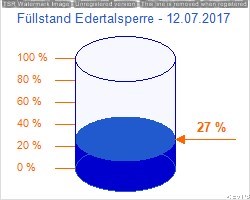

Edertalsperere bei Vollstau
Die Elbe doch als Güter-Highway?
...Dresden Sandbänke, Erosion und Niedrigwasser – die Problemliste der Elbe ist lang....
...Die Elbe ist ein launischer Fluss....
...Oft macht sie an vielen Stellen jede Fahrt unmöglich....
...Für Unternehmen, die die Elbe als Transportweg brauchen, ist der 1100 Kilometer lange Fluss ein extrem unberechenbarer Geschäftspartner....
...Die drei Siemens-Werke in Görlitz, Dresden und Erfurt, wo Turbinen, Transformatoren und Generatoren hergestellt werden, sind auf den Fluss angewiesen....
..."Wenn die Elbe längere Zeit nicht schiffbar ist, kann daraus Lieferverzug entstehen."...
...Nun gibt es für die Wirtschaft neue Hoffnung, dass der Fluss bald für den Güterverkehr gezähmt wird....
...Grund ist das Gesamtkonzept Elbe, ein Papier, das Naturschützer und Vertreter der Schifffahrt dreieinhalb Jahre lang gemeinsam ausgehandelt haben....
...Es wurde im Januar beschlossen und sieht vor, die Elbe künftig mehr als elf Monate im Jahr für Schiffe befahrbar zu machen – mit einer durchschnittlich 1,40 Meter tiefen Fahrrinne....
...Derzeit seien eigentlich schon 95 Prozent des Flusses für Schiffe in Ordnung....
...Dem Elektronischen Wasserstraßen Informationsservice Elwis zufolge lag die Fahrrinnentiefe des Flusses hier im vergangenen Jahr an 285 Tagen unter 2,02 Meter – diese Tiefe brauchen Schiffe für den Transport von Massengütern....
...An 98 Tagen war die Rinne nicht einmal 1,40 Meter tief....
..."Wir haben Erosion, die Elbe gräbt sich ein." Andernorts entstünden dadurch Sandbänke, die für Schiffe unüberwindliche Hindernisse sein können....
..."Es geht nicht darum, die Fahrrinne auszubaggern....
...Aber man könne Buhnen bauen, eine Art kleine Landzungen, die vom Ufer aus ins Wasser ragen....
...Sie erhöhen die Fließgeschwindigkeit, Sediment wird abgetragen und die Fahrrinne wird tiefer....
...Neue Buhnen könnten das Problem verschärfen....
...Ob dank neuer Buhnen wirklich mehr Güter von Straße und Schiene aufs Wasser kommen?...
..."Die Elbe wird immer unzuverlässig bleiben", sagt Iris Brunar, die die Naturschutzorganisation BUND bei der Entwicklung des Konzepts vertreten hat voraus....
...Die Menge der auf der Elbe verschifften Güter hat sich – wohl wegen schwankender Wasserstände – auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt....
Zum Thema:
Die Menge der auf der Elbe verschifften Güter hat sich – wohl wegen schwankender
Wasserstände – auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt in Magdeburg zählte im vergangenen Jahr (2016) gerade einmal 0,35 Millionen Tonnen Waren – der zweitniedrigste Wert seit 1997.
Zum Vergleich: Im Elbegebiet, zu dem auch die angrenzenden Kanäle gehören, waren es knapp 18 Millionen Tonnen. Violetta Kuhn
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 09.08.2017
Juni 2018: Wenig Wasser in der Havel: Sportboote fallen trocken
...Brandenburg/Havel Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen haben auf Havel und Spree zu extrem niedrigen Wasserständen geführt...
...Dies führe auch auf der unteren Havel zu extrem niedrigen Wasserständen, sagte sagte die Leiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Brandenburg, Gerrit Riemer....
…Wir bekommen im Moment nur 4 Kubikmeter Wasser pro Sekunde von der Havel aus dem Norden und der Spree aus dem Süden“, am Dienstag (26.06.2018) auf Anfrage von dpa …
…„Sonst bekommen wir 50 bis 150 Kubikmeter.“…
...„In Rathenow haben wir den niedrigsten Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen.“ Darüber hatte zuerst die „Märkische Allgemeine“ (26.06.2018) berichtet....
...Grund für das wenige Wasser in der Havel seien nicht nur die fehlenden Regenfälle, sondern auch die Verdunstung auf den großen Seen wegen der hohen Temperaturen, erläuterte Riemer....
Näheres zur Situation: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 27.06.2018
Ausführlich unter:
Anm.: Hoffentlich sehen alle Besucher meiner Webseite das eben so
Kommentar: Herrliche Hitze
…Kein Mensch kann sich an einen Sommer erinnern, der vom April bis in den Juli angehalten hat. Abgesehen von wenigen Regentagen herrschte immer Badewetter…
…Und in den Vorhersagen pendelt die Quecksilbersäule auch in der kommenden Woche um die 30 Grad. Aber Grund zu dramatisierenden Reminiszenzen gibt es nicht. …
…Wer unserem guten alten Fontane auf seinen Wanderungen durch die Mark folgt, liest schon mal von Ereignissen vor ein paar hundert Jahren,
„als zu Neujahr die Blumen blühten“...
…Die meteorologisch-wissenschaftlichen Aufzeichnungen sind noch nicht so alt, aber man darf der Literatur ruhig vertrauen….
…Wetterkapriolen gab es immer, und wenn sie so freundlich ausfallen, machen die
Menschen meist das Beste draus…
J.
Heinrich
Sie erreichen den Autor unter: j.heinrich@cga-verlag.de
Quelle: zitiert aus Märkischer Bote, 27.07.2018
Ausführlich unter:
https://maerkischer-bote.de/blog/2018/07/27/herrliche-hitze/
D
ie Niedrigwassersituation hält weiter an und ist vergleichbar mit der von 2003:Hier einige Bemerkungen zur Situation:
Niedrigwasser bremst Schifffahrt

Sachsen, Meißen: Blick auf das ausgetrocknete Flussbett der Elbe in der Nähe der Albrechtsburg. Das niederschlagsarme Wetter lässt die sächsischen Flusspegel weiter sinken. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ FOTO: ZB / Monika Skolimowska
…Dresden. (dpa/roe) Wegen der anhaltenden Trockenheit hat bereits die Hälfte der sächsischen Flüsse zu wenig Wasser…
… „Nennenswerter Regen ist nicht in Sicht, die Situation wird sich weiter verschärfen“, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch (04.07.2018) in Dresden. ...
…Am Mittag wurden am Pegel Dresden 68 Zentimeter gemessen, normal sind dort zwei Meter.
...Und auch in Meißen geht kaum was, wie das Bildbeweist...
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 04.07.2018
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/niedrigwasser-bremst-schifffahrt_aid-23807991
So geht der Spree bei Trockenheit nicht das Wasser aus
…Den Spreewald „rettet“ stets das mit Sachsen vertraglich fixierte Wassermanagement für die Spree…
…Zur Anwendung kommt das Konzept, wenn am Spreepegel Leibsch (Dahme-Spreewald) Alarm geläutet wird. Hier, am Ausgang des Unterspreewaldes Richtung Berlin, darf die Wasser-Abflussmenge von 2,5 Kubikmeter je Sekunde nicht unterschritten werden. …

Spreewasser für das Biosphärenreservat Spreewald, für den Erhalt von Natur und Umwelt in der Region, für die Trinkwasserversorgung von Berlin und auch von Frankfurt (Oder): Um den Flusslauf stets mit Wasser zu versorgen, haben die vor mehr als 40 Jahren angelegten Talsperren Quitzdorf und Bautzen in Sachsen eine herausragende Bedeutung. Sie stellen in Dürreperioden Wasser für Brandenburg zur Verfügung. FOTO: LR / Elisabeth Wrobel, Stepmap
…Um die Wasserversorgung der (Unterlieger an der) Spree zu sichern, greift die Behörde auf ein Maßnahmenpaket zurück, das in den zurückliegenden Jahren erarbeitet worden ist. Dabei sind in die Analyse die vergleichbaren Sommer 2006 und 2015 eingeflossen. …
…Der Freistaat Sachsen ist dabei der wichtigste Partner ist. Denn dessen Talsperrenverwaltung sowie die Flutungszentrale der Bergbausanierer von der LMBV sorgen dafür, dass die Spree und damit der Spreewald nicht trocken laufen….
…In solchen Situationen wird die Spree nach einem Konzept bewirtschaftet, das in der Region abgestimmt ist und dessen aktuelle Fassung dem Land als Handbuch dient….
… Für Oder und Havel oder für das Naturschutzgebiet Rhinluch im Norden des Landes gebe es keine Wasser-Rückhaltebecken, auf die in brenzligen Situationen zurückgegriffen werden kann…. Christian Taubert
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 10.07.2018
Ausführlich unter:
Dampfschifffahrt Dresden weiter eingeschränkt

DRESDEN (dpa/lsc) Die Dampfschifffahrt in Dresden ist aufgrund des niedrigen Pegelstands der Elbe weiter eingeschränkt und fährt nur im Stadtbereich.
Fahrten etwa nach Pillnitz fallen vorerst aus. Eine komplette Einstellung gebe es erst einmal aber nicht, sagte Karin Hildebrand von der Sächsischen Dampfschifffahrt am Montag (09.07.2018).
Die Elbe hatte am Montag (09.07.2018) einen Pegelstand von 55 Zentimetern.
Keine Einschränkungen gibt es derzeit beim Verkehrsverbund Oberelbe. Alle Elbfähren sind unterwegs.
Der Wasserstand der Elbe ist bis zum 28.07.2018 wegen ausbleibender Niederschläge weiter zurück gegangen, wie das folgende Bild zeigt:

Dieses Bild zeichnen die Wasserversorger:
Cottbus. Senftenberger Versorger arbeitet aber an der Kapazitätsgrenze. Cottbus hat reichlich Reserven.

… „Auch wenn es in den nächsten sechs Wochen nicht regnet, werden wir genügend Grundwasser zur Verfügung haben“, erklärt Roland Socher, Vorstandsvorsteher des Wasserverbandes Lausitz (WAL) in Senftenberg. „Unsere Wasserwerke in Schwarze Pumpe und Tettau sind seit Anfang Mai (2018) allerdings an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen.“...
…Der WAL stelle zurzeit 40 000 Kubikmeter pro Tag zur Verfügung. Normal seien 25 000 Kubikmeter pro Tag…
…DieLausitzer Wasser GmbH (LWG) in Cottbus prognostiziert trotz der Hundstage, dass der Rekord von Anfang Juli (2018) mit 29 000 m3 pro Tag jetzt nicht erreicht werde.
Bis 35 000 m3(pro Tag) ist man gerüstet.... Christian Taubert
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 24.07.2018
Ausführlich unter:
Die Lausitzer Rundschau vom 26.07.2018 berichtet u.a.:
…Auch für Sachsen werden zwar Schauer und Gewitter vorhergesagt. Dennoch steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 35 Grad Celsius….
…Um den Durchfluss in der Spree und der teils schon trocken gefallenen Schwarzen Elster zu sichern, hat die LMBV neben Wasser aus sächsischen Talsperren
auch Nass aus Lausitzer Bergbaufolgeseen abgegeben...
...Wie der Bergbausanierer informiert, wird Wasser aus den Speichern Bärwalde, Lohsa II und Rainitza eingeleitet...

Notfallplan soll Kollaps vorbeugen - Angler und Fische atmen auf
…Kleinsee. Leag startet Hilfe am Kleinsee: Eine Pumpe soll den niedrigen Sauerstoffgehalt erhöhen…
…Noch am Mittwoch (25.07.2018) hatte der Fachbereich Umwelt des Landkreises Spree-Neiße seine Sorge nicht geteilt.
Die Behörde hatte aufgrund aktueller Sauerstoff-Messungen keinen Anlass gesehen, die Leag um Hilfe zu bitte.
Und ohne diese Bitte konnte der Bergbaubetreiber nicht aktiv werden. …
…Doch aufgrund der anhaltend hohen Lufttemperaturen hat die Behörde ihre Meinung nun geändert und sich vorsorglich entschieden, die Leag um Hilfe zu bitten… Michèle-Cathrin Zeidler
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 28.07.2018
Weniger gut sieht z.Z. die Schwarze Elster im Bereich Senftenberg aus:
Schwarze Elster in Senftenberg ausgetrocknet

Erschreckend schön: Die Schwarze Elster, wie hier an der Senftenberger Stadtgrenze mit Blick nach Sachsen, ist wegen der anhaltenden Dürreperiode an vielen Stellen ausgetrocknet.
FOTO: Medienhaus Lausitzer Rundschau
Senftenberg. Das Flussbett bei Senftenberg ist ohne Wasser.
…Die anhaltende Hitzewelle hat der Schwarzen Elster in Senftenberg das Wasser geraubt und sie austrocknen lassen….
…Weil das Gewässer bei Senftenberg kaum von anderen Zuflüssen profitiert, ist die Situation in diesem Bereich besonders extrem…
…Der ungewöhnliche Anblick des verdorrten Flusses wird durch wucherndes Schilf und Unkraut verstärkt…
...Ähnliche Situationen habe es in den Jahren 2003 und 2010 gegeben. Wann wieder Wasser in der Schwarzen Elster fließt kann nicht gesagt werden… Jan Augustin
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 31.07.2018
Ausführlich unter:
Autofähren auf der Elbe sind wieder in Betrieb

Die Touristen wird es freuen, dass sie wieder über die Elbe schippern können. FOTO: dpa / Matthias Hiekel
Dresden. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage sind alle Fähren der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wieder in Betrieb. Seit Freitag 11 Uhr werden auch wieder Fahrzeuge zwischen
Kleinzschachwitz und Pillnitz übergesetzt, wie die DVB am Freitag (10.08.2018) mitteilte.
…Zuvor waren bereits alle Fahrten im Stadtgebiet Dresdens wieder aufnehmen worden….
…Wegen des geringen Wasserstandes der Elbe von unter 50 Zentimetern mussten am 31. Juli 2018 alle drei Fährstellen der
Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vorübergehend stillgelegt werden… (dpa/uf)
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau-online, 10.08.2018
Wenn Dürre zum Normalfall wird / Experten raten: Wassernotstand sollte schon mal geübt werden

Kein seltenes Bild in diesem Sommer: Eine einzelne Maispflanze steht auf einem von Trockenheit, Hitze und Unwettern stark geschädigtem Maisfeld.
FOTO: dpa / Julian Stratenschulte
Berlin. Bisher hat der deutsche Katastrophenschutz nur Überschwemmungen im Blick.
„Die Folgen eines langanhaltenden Ausfalls der Wasserversorgung sind nicht umfassend untersucht.“
Katastrophen-Experte Hans-Walter Borries vom BSKI
...125 Liter Wasser braucht jeder Deutsche pro Tag, 4000 bis 5000 Liter pro Einwohner werden zusätzlich in der Produktion und
Tierhaltung täglich genutzt....
...Der Dürre-Sommer 2018 sei Anlass genug, die Notversorgung mit Wasser wieder zu üben, sagt der „Bundesverband
für den Schutz Kritischer Infrastrukturen“ (BSKI)....
...Denn das Wissen darüber sei fast verloren gegangen....
...Tatsächlich haben die Behörden in Sachen Wasser bisher nur Deichbrüche oder Sturmfluten im Blick....
...2015 sollte dazu eine überregionale „Lükex“-Katastrophenschutz-Übung stattfinden, wurde aber
wegen der Überlastung der Innenbehörden durch die Flüchtlingskrise abgesagt....
...„2022 könnte man sich Wasser vornehmen“, meinte der Katastrophen-Experte Hans-Walter Borries vom BSKI....
...Wenn nach einem so trockenen Sommer wie in diesem Jahr noch ein regenarmer Winter und ein trockener Frühling komme, seien die Talsperren leer....
...„Dass die geduldig mit Eimern Schlange stehen, ist nicht zu erwarten.“ Krankenhäuser bräuchten Klarheit, woher sie im Notfall Wasser bekämen....
...Wenn die Abwasserleitungen nicht mehr ausreichend durchspült würden, könnten sie verstopfen, auch könnten sich zum Beispiel Ratten stark vermehren....
...Der BSKI ist ein neu gegründeter Verband von Experten, der auf Schwachstellen der Infrastruktur hinweisen und Lösungswege anbieten will....
...Als empfindlichste Stelle für Deutschland gilt auch dem BSKI die Stromversorgung....
...Ausfälle dort seien künftig nicht nur wegen Hacker-Angriffen häufiger möglich....
...Sondern auch wegen der angespannten Situation der Stromnetze im Zuge der Energiewende....
...Ein längerer Blackout hätte übrigens auch Rückwirkungen auf die Wasserversorgung, egal wie trocken es gerade ist:
Wassertürme wie in Südeuropa gibt es kaum noch; in Deutschland wird der Wasserdruck mit elektrischen Pumpen aufrechterhalten.... Werner Kolhoff
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 24.08.2018
Ausführlich unter:
Wenig Wasser in der Neiße

Die Neiße, hier hinter dem Forster Kegeldamm, führt derzeit sehr wenig Wasser. FOTO: LR / Steffi Ludwig
Forst. Trockenheit sorgt für sehr niedrige Pegelwerte. Totholz wird dennoch nicht extra entfernt.
... Am Pegel Klein Bademeusel sind in der vergangenen Woche durchschnittlich 46 Zentimeter gemessen worden, teilt
Thomas Frey, Referent des Landesamtes für Umwelt, auf Nachfrage mit….
... Am vergangenen Mittwoch (08.08.2018) war mit 44 Zentimetern der diesjährige Tiefstwert erreicht worden....
...Normalerweise liegt der Pegel in Klein Bademeusel bei etwa 70 Zentimetern…
...Damit liegen die Werte etwas tiefer als der langjährige Durchschnittswert für Niedrigwasser von 50 Zentimetern, teilt Thomas Frey mit.
Dieser Wert stammt aus der Zeitreihe 1996 bis 2010....
...Der Abfluss betrug am Montag 4,91 Kubikmeter pro Sekunde. In der vergangenen
Woche waren es durchschnittlich 5,6 Kubikmeter pro Sekunde,
d.h. unterhalb des langjährigen Mittelwertes der Jahre 1971 bis 2010 von 7,89 Kubikmetern pro Sekunde,
aber noch oberhalb des niedrigsten Wertes der Zeitreihe von 3,4 Kubikmeter pro Sekunde….
...Damit liegen die Abflusswerte für das Landesamt im unteren Bereich der langjährigen Sommerdurchschnittswerte…
…Das hat vor allem Auswirkungen für die Wasserkraftbetreiber, die nicht mehr den Strom erzeugen können wie gewünscht….
...Laut Landesamt für Umwelt ist eine gesonderte Kampagne zur Gehölzentnahme während des Niedrigwassers nicht notwendig.
Denn einerseits sei die Lausitzer Neiße ein relativ naturbelassener Fluss und stehe deshalb in weiten Teilen unter Naturschutz.
Darüber hinaus sei sie ein wichtiges Verbindungsgewässer und Laichgebiet für wandernde Fischarten….
...Auch bei der regelmäßigen Gewässerunterhaltung werde darauf geachtet, dass durch Totholz keine Gefährdung entsteht... Steffi Ludwig
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 15.8.2018
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/forst/wenig-wasser-in-der-neisse_aid-24345759
Dürre-Sommer / Zusätzliches Wasser für die Spree

Noch herrscht kein dramatischer Wassernotsand in der Spree. Doch wenn es so bleiben soll, braucht die Region endlich Regen. FOTO: dpa / Patrick Pleul
..Cottbus. Experten aus Brandenburg und Sachsen haben einen Katalog von Sofortmaßnahmen beschlossen, um den Wasserstand der Spree zunächst bis Ende September (2018) zu stabilisieren....
...Bis Ende September (2018) wird es in der Spree trotz der anhaltenden Dürre genügend Wasser geben....
...Die länderübergreifende Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Brandenburg und Sachsen hat bei einer Krisensitzung in dieser Woche entsprechende Not-Maßnahmen beschlossen....
...Demnach sollen aus den sächsischen Speichern Lohsa II und Bärwalde im Lausitzer Seenland insgesamt 3,6 Millionen Kubikmeter Wasser in die Spree eingeleitet werden....
...Weitere 2,5 Millionen Kubikmeter strömen aus der Talsperre Spremberg in die Spree....
...Darüber hinaus stehen von den 20 Millionen Kubikmetern Wasser, die der Freistaat Sachsen aus den Talsperren Bautzen und Quitzdorf ohnehin nach Brandenburg liefert,
zusätzlich drei Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung....
...Ohne die jetzt zusätzlich vereinbarten Mengen hätte bereits Anfang September (2018) nicht genug Wasser zur Stabilisierung der dürregeplagten Spree zur Verfügung gestanden....
...Im Gegenzug reduziert der Bergbaukonzern Leag die Einleitung von stark sulfathaltigem Wasser aus dem Tagebau Nochten in die Spree....
...Darüber hinaus soll bis spätestens 10. September (2018) entschieden werden, ob es ab der Talsperre Spremberg flussabwärts Nutzungseinschränkungen
für das Wasser der Spree geben muss.... Torsten Richter-Zippack
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 29.08.2018
Ausführlich unter:
Wasserwerk Schwarze Pumpe fährt seit Wochen unter Volllast
LEAG unterstützt bei der Hitze Wasserverbände der Region / Maximale Leistungsgrenze ist erreicht.

Die Becken im Wasserwerk müssen in der Nacht immer gut gefüllt werden, um dem Bedarf an Wasser gerecht zu werden | Foto: M. Klinkmüller
...Seit 1963 fließen Hunderte Milliarden Liter Trinkwasser vom Wasserwerk Schwarze Pumpe in die Haushalte der Region....
...Seit Wochen fährt die Anlage unter Volllast....
...Neben der Stadt Weißwasser, die zu einhundert Prozent das Trinkwasser aus dem Industriegebiet in Schwarze Pumpe erhält,
gibt es auch Verträge mit weiteren Wasserverbänden aus der Region....
...Am Abend wird derzeit mehr Wasser von den Haushalten entnommen, als produziert wird....
...Das Wasserwerk in Schwarze Pumpe ist ein besonderes Wasserwerk....
...Fünf Rohwässer unterschiedlichster Herkunft und Qualität kommen hier an, um aufbereitet zu werden....
...Per Vertrag mit der für die Maßnahmen gegen die „braune Spree“ zuständigen Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV)
reinigt LEAG bis zu 300 bis 360 Kubikmeter Wasser für die Spree pro Stunde....
...Aus den fünf verschiedenen hier ankommenden Wässern werden je nach Eignung und Bedarf vier verschiedene Wässer in unterschiedlicher
Qualität und Menge produziert, zwischengespeichert und zu den Abnehmern gepumpt....
...Und so verlässt ein Teil des Wassers bereits nach dem Anheben des pH-Wertes und Abtrennen des Eisens gemäß der wasserbehördlich
vorgegebenen Qualität die Anlage in Richtung Spree....
...Besser geeignete Rohwässer werden dagegen weiter behandelt und in der sogenannten Feinreinigung zur Brauch- und Kühlwasserwasser aufbereitet
sowie die besten Rohwässer zu Trinkwasser....
...Ohne das Kühlwasser aus dem Wasserwerk wäre die Stromerzeugung im Kraftwerk Schwarze Pumpe nicht möglich....
...„Die Spree führt auch zu wenig Wasser, als dass hier eine Papierfabrik noch Wasser entnehmen könnte....
...Das Wasserwerk liefert das notwendige Prozesswasser in der für die Papierproduktion erforderlichen sehr guten Qualität und ist damit ein wichtiger Standortfaktor.... M. Klinkmüller
Quelle: zitiert aus Märkischer Bote, 24.08.2018
Ausführlich unter:
https://maerkischer-bote.de/region/das-wasserwerk-in-schwarze-pumpe-faehrt-seit-wochen-unter-volllast-187886
Dr. Schulze: Ohne Bergbau trockene Flussbetten
Dr. Klaus-Peter Schulze

In einem offenen Brief hat sich Bundestagsabgeordneter Dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) an die vier Vorsitzenden der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung gewandt.
Er macht darin Barbara Praetorius, Matthias Platzeck, Ronald Pofalla und
Stanislaw Tillich auf die bisher wenig beachteten Wasserhaushalt-Folgen eines
schnellen Kohleausstiegs
am Beispiel der Lausitz aufmerksam.
Die wasserwirtschaftlichen Besonderheiten der Lausitz werden öffentlich kaum
thematisiert. Spree und Schwarze Elster hängen seit Jahrzehnten direkt am Tropf
der bergbaulichen Wassereinleitungen.
Am Beispiel Spree am Pegel Cottbus bedeutet dies, dass bei einem Mittelwasserdurchfluss im Zeitraum 1996-2010 von 13,9 m³/s dauerhaft ein Anteil von ca. 6,0 m³/s bilanzwirksamer Abfluss
aus den heutigen LEAG-Tagebauen resultierten.
In niederschlagsarmen Jahren ist die bergbauliche Wassereinleitung für die Spree, den Spreewald und die angrenzenden Teichwirtschaften ein „Überlebensfaktor“,
denn ohne diese Einleitung wären die vorgeschalteten Talsperren inzwischen leer.
Wie es aber aussieht, wenn der Bergbau kein Wasser mehr in ein Gewässer
einspeist, kann gegenwärtig an der Schwarzen Elster zwischen Neuwiese und
Senftenberg (Kleinkoschen)
beobachtet werden – der Flusslauf ist über weite Strecken trocken (ähnlich so in den Jahren 2003 und 2006).
Quelle: Märkischer Bote, 07.09.2018
Auch unter:
https://maerkischer-bote.de/region/ohne-bergbau-trockene-flussbetten-188543
A
nm: So niedeschlagsarm war es schon lange nicht mehr, so dass es notwendig wurde, derartige Maßnahmen zu ergreifen:
Pegel der Spree bleibt konstant
COTTBUS (dpa/sm) Trotz der andauernden Trockenheit bleibt der Pegel der Spree in Berlin und Brandenburg durch Zuflüsse aus den Tagebauen und Talsperren zumindest
bis Ende Oktober (2018) konstant.
Das sagte der zuständige Abteilungsleiter im Potsdamer Umweltministerium, Kurt Augustin, am Montag (08.10.2018) in Potsdam.
Derzeit helfe auch der Braunkohlekonzern Leag mit dem Abpumpen von Grundwasser für die Kohleförderung, dass genügend Wasser zur Verfügung steht.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 09.10.2018
Pläne für Wassereinlauf / Zu viel Phosphat im Wasser?

Der Wasserstand ist am Pinnower See innerhalb eines Jahres um rund 40 Zentimeter gesunken. Geplant ist, dass ab Mai 2019 Wasser eingeleitet wird.
FOTO: Michèle-Cathrin Zeidler
Schenkendöbern . Ab Mai 2019 will Leag Wasser in die betroffenen Seen lassen. Angler sorgen sich um Fische.
...Aufatmen beim Angelverein Bärenklau: Das Energieunternehmen Leag hat Pläne gegen den Wasserverlust vorgelegt....
Ausführlich hier:
…Im Mai 2019 soll mit der Wassereinleitung am Großsee, Kleinsee und Pinnower See begonnen werden…
…Die Leag will die Seen aktuell bis zum Wasserstand von 2010 auffüllen. „Dass die Seen bereits lange vor 2010 an Wasser verloren haben, ist unbestritten“, sagt Schinowsky.
Für mehr Klarheit fordert sie daher ein unabhängiges Gutachten….
Anm.:
Die Wasserstandschwankungen sind doch wesentlich abhängig von der hydrologischen Situation. Der sog. „bergbauliche Wasserverlust“ (wie von der „Expertin“ Schinowsky bezeichnet)
ist doch überhaupt nicht nachgewiesen.
Alle, die sich als sog. Experten fühlen, sollten sich vor Abgabe von Forderungen ohne Aufzeigen von Lösungsmöglichkeitten erst einmal mit der hydrogeologischen und meteorologischen Situation
vertraut machen.
Siehe auch Beitrag in der LR v. 29.09.2018:
Wassermangel nach trockenem Sommer extrem
Der Grundwasserstand sinkt um Cottbus auf neuen Tiefpunkt
…Auch hat Heide Schinowsky Zweifel daran, dass es beim Deulowitzer See ausreicht, das umliegende Grabensystem wieder herzustellen…..
…Steffen Krautz, Umweltausschusses der Gemeinde Schenkendöbern stellt fest: „Richtig und wichtig ist, dass es jetzt erstmal eine Maßnahme gibt, die die Seen insgesamt erhalten soll…
Kurzfristiges Handeln sei aber nicht ausreichend….
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 09.10.2018
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/guben/zu-viel-phosphat-im-wasser_aid-33575705
Auf dem Trockenen - Lage der Spree extrem angespannt

Die Spree braucht Wasser. Der Dürre-Sommer und der bisher extrem trockene Herbst lassen die Reserven in den Lausitzer Talsperren rasant schwinden.
Weiter sinkende Pegel machen den Wasserversorgern in Berlin und im Raum Frankfurt/Oder deshalb langsam Sorgen. FOTO: M. Behnke
Cottbus. Die Spreewaldfließe werden braun, wenn nicht bald frisches Wasser kommt. Die Reserven der Lausitzer Talsperren werden knapp.
...Ein weiter sinkender Spree-Pegel hätte erhebliche Auswirkungen auf die Wasserversorgung im Raum Frankfurt (Oder) und in Berlin.
Trotz einiger Regentropfen in der Lausitz hat sich die Wassersituation in der Spree nicht entspannt. ...
....Die drei Länder (SN, BB, B) hatten im Sommer eilig eine Ad-hoc-Kommission gebildet. Ein weiter sinkender Spree-Pegel hätte erhebliche Auswirkungen auf die Wasserversorgung im Raum Frankfurt (Oder) und in Berlin....
...Aktuell sei die Lage aber beherrschbar. Der Spreeabfluss am wichtigen „Pegel Leibsch“ beträgt stabil 2,5 Kubikmeter pro Sekunde.
Die Zahl ist wichtig, weil damit der Nitratgehalt der Spree im Bereich der Grenzwerte gehalten werden kann....
.
...Nach Einschätzung der Fachleute ist der Wasserstand in der Spree noch einen Monat gesichert. Dann muss es regnen,
weil die Sachsen in ihren Speichern Quitzdorf und Bautzen auch auf dem Trockenen sitzen.... Jan Siegel
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 03.11.2018
Ausführlich unter:
Wasserstand der Spree kann noch gehalten werden
Trotz weiter ausbleibender Regenfälle kann der Pegelstand der Spree noch konstant gehalten werden. Foto: Johanna Schlüter FOTO: Johanna Schlüter
Berlin. Trotz weiter ausbleibender Regenfälle kann der Pegelstand der Spree noch konstant gehalten werden.
Zumindest für die kommenden 14 Tage sei der Wassernachschub aus Brandenburg und Sachsen sicher, sagte Derk Ehlert aus der Berliner Umweltverwaltung
("ein besonders ausgewiesener Experte, u.a. für Wildtiere in der Stadt und jetzt auch für "Wasser") am Montag (05.11.2018) nach Beratungen von
Vertretern aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und des Bundes. dpa
…Dabei habe sich ergeben, dass noch Wasser-Restmengen aus Brandenburg kommen….
…Die Spree profitiere davon, dass die Binnenfischer aus Sachsen und Brandenburg zu dieser Jahreszeit das Wasser aus Karpfenteichanlagen ablassen...
Anmerkung: Der Experte vergisst zu erwähnen, dass den größten Anteil das Grubenwasser der noch in Betrieb befindlichen Tagebaue ausmacht.
…Die Einspeisungen aus Speichern und Talsperren in den Nachbarbundesländern tragen dazu bei, dass die Schifffahrt auf der Spree
trotz monatelanger Trockenheit weitergehen kann….
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 05.11.2018
Ausführlich unter:
BUND verlangt Aus für EIbe-Staustufe in Tschechien
Die tschechische Regierung plant eine riesige Staustufe an der Elbe. Doch mehrere Studien zeigen die Gefahren der Pläne auf.
DESSAU-ROSSLAU (dpa/uf) Der Umweltverband BUND hat erneut das Aus für eine an der Elbe in Tschechien geplante Staustufe gefordert.
Die Verwaltung des Nationalparks Böhmische Schweiz habe bekannt gegeben, dass der Bau nicht durch andere ökologische Maßnahmen kompensiert werden könne,
teilte Iris Brunar vom BUND-Elbeprojekt in Dessau-Roßlau am Dienstag (20.11.2011) mit.
Die Bundesregierung müsse sich in Prag für einen Stopp der Planungen in der Nähe der nordböhmischen Industriestadt Decin einsetzen.
:::Der BUND befürchtet, dass die Staustufe die Flusslandschaft an der Elbe zerstören würde. Es seien erhebliche negative Auswirkungen
auch für die deutschen Schutzgebiete an der Elbe zu erwarten....
Anm.: Welche da wären?
...Befürworter erhoffen sich eine bessere Schiffbarkeit der Elbe für den Güterverkehr.
Brunar kritisierte, selbst wenn die Elbe auf tschechischer Seite ganzjährig schiffbar wäre, gelte das für die deutsche Elbe nicht.
Sie verwies zudem auf lang anhaltende Niedrigwasser-Perioden wie in diesem Jahr (2018). ...
Anm.: Gerade in diesen Situationen würde eine Bewirtschaftung von Staustufen Sinn machen
....Ein Teil des Elbtals in Tschechien und die sogenannte Porta Bohemica (Böhmische Pforte) sind als Natura-2000-Schutzgebiete. geschützt. ...
....Die Regierung in Prag hatte Anfang des Jahres entschieden, dass das öffentliche Interesse am - ihrer Darstellung nach umweltfreundlichen -
Wasserstraßen-Güterverkehr den Naturschutz überwiegt. ...
....Der Nationalpark Böhmische Schweiz gab daraufhin zwei Studien zu den Auswirkungen einer stärkeren Regulierung der Elbe in Auftrag....
....Konkret ging es um die einzigartige Vegetation (?) an den Schlammufern mit Pionierpflanzen wie dem Roten Gänsefuß. ...
Anm.: Eine Frage sei in diesem Zusammenhang erlaubt: Lässt sich der Roten Gänsefuß nicht an eine andere geeignete Stelle der Nationalparks ansiedeln?
....Die Kosten der geplanten Staustufe werden auf umgerechnet rund 200 Millionen Euro geschätzt. Ein deutsch-tschechisches Memorandum von 2006 sieht vor,
dass die Elbe an 345 Tagen im Jahr mit einer Tiefe von mindestens 1,50 Metern schiffbar sein soll....
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 21.11.2018
Tschechien: Offenbar Aus für neue Elbe-Staustufe bei Děčín
Die Schiffbarkeit der Elbe soll verbessert werden. Dazu will die tschechische Regierung eigentlich zwischen Litoměřice und der deutschen Grenze eine Staustufe bauen.
Doch nun rudert der Umweltminister zurück.
...In Tschechien ist ein Streit um eine geplante Elbe-Staustufe bei Děčín entbrannt. Konkret geht es um die Porta Bohemica, jenen Abschnitt des Elbtales zwischen Litoměřice und der deutschen Grenze,
der seit 2016 als europäische Natura-2000-Schutzzone ausgewiesen ist. Hier wollte die tschechische Regierung eigentlich eine Staustufe bauen, damit Schiffe ganzjährig auf der Elbe fahren können....
Verkehrsminister verärgert, Umweltschützer erfreut
...Tschechiens Verkehrsminister Dan Tok hat seinem Kabinettskollegen Brabec daraufhin Wortbruch vorgeworfen.
Tok hat nach Information des ARD-Studios Prag auf einen Beschluss der Regierung verwiesen, wonach der Ausbau der Elbe höhere Priorität habe als der Umweltschutz.
Auch Staatspräsident Milos Zeman hatte sich für die Staustufe stark gemacht. Sollte das Umweltministerium bei seinen Plänen bleiben, kündigte Tok an, den Natura-Status für das Elbtal wieder aufzuheben....
...Positive Rückmeldung erhält der tschechische Umweltminister dagegen aus Deutschland....
So begrüsste der Naturschutzbund BUND Sachsen den Vorstoß Brabecs. Bund-Vorsitzender Felix Ekardt sagte MDR SACHSEN, der Bau von Staustufen an der Elbe würde die Flusslandschaft grundlegend zerstören.
Das verstoße gegen EU-Recht. Zudem würden die Auswirkungen von Maßnahmen auf tschechischer Seite nicht an der Grenze enden und der Effekt auf deutsche FFH-Schutzgebiete wäre immens.
Ähnlich sieht das Wolfram Günther, Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen im Sächsischen Landtag.
Anm.. Bei diesen Lebensläufen (Quelle: WIKIPEDIA) sind beide genannten Personen gerade de zu prädestiniert, zu dieser Thematik Stellung zu beziehen.
...Der Dürresommer im letzten Jahr habe gezeigt, dass eine ganzjährige Schiffbarkeit der Elbe völlig unrealistisch ist...
Anm.: Wäre aber mit Einschränkung durch die Staustufe gewährleistet gewesen.
Jahrelanger Protest von Naturschützern
Sowohl die Grünen als auch zahlreiche Umweltverbände im Freistaat Sachsen und Tschechien hatten über Jahre gegen den Bau dieser Staustufe protestiert.
Im November 2018 hat die Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz (NP České Švýcarsko) als Ergebnis mehrerer unabhängiger Studien und Stellungnahmen erklärt,
dass die Schäden der Staustufe nicht durch andere ökologische Maßnahmen ausgeglichen werden können.
Anm.: Mit welcher Begründung nehmen sich eigentlich "Grüne" (Ergebnis Landtagswahl Sachsen 2017: 4,5%) das Recht heraus, ökonomische Maßnahmen,
die auch aus ökologischer Sicht Sinn machen, zu torpedieren und zu verhindern.
Eine Staustufe ist eine Anlage zum Aufstauen eines Flusses, um den Wasserstand flussaufwärts und flussabwärts zu regeln. Meistens liegen in einem staugeregelten Flussabschnitt mehrere Staustufen hintereinander.
Häufiger Anlass zum Errichten einer Staustufe ist
unter anderem eine ganzjährige Schiffbarkeit der
Flüsse.
Der tschechische Teil der Elbe hat bereits 24
Staustufen, die vor allem seit den 1950er-Jahren
gebaut wurden. Ziel der Bauwerke ist es, den Fluss
soweit wie möglich schiffbar zu halten.
Zusätzlich dienen die Wehranlagen dem Hochwasserschutz und der Stromerzeugung. In Deutschland gibt es als vergleichbares Querbauwerk nur die Staustufe Geesthacht südöstlich von Hamburg.
Quelle: zitiert aus MDR/bb
Ausführlich unter:
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/freital-pirna/keine-neue-elbe-staustufe-in-tschechien-100.html
Anm.:
Es stellt sich wiederholt die Frage: Was will der BUND, neuerdings auch noch vernetzt mit Tschechiens Grünen, überhaupt?
Überall und gegen alles Protest einlegen? Ohne eigene Lösungsvorschläge zu unterbreiten..
Das Schienennetz im Elbtal und die Autobahnen und Strassen sind durch den Güterverkehr heute ohnehin schon überlastet und die Umweltbelastung dementsprechend hoch..
Wahrscheinlich ist die Rettung des „Roten Gänsefußes“ wichtiger als eine Verlagerung des Güterverkehrs weg von Straße und Schiene auf die Elbe
an 345 Tagen des Jahres durchgängig von Hamburg bis in die Tschechei, verbunden mit einer nicht unerheblichen Verringerung der Umweltbelastung .
Nebenbei bemerkt ist kein Eintrag in WIKIPEDIA zu „Iris Brunar“ zu finden, der einen Hinweis auf ihre berufliche und fachliche Qualifikation Auskunft geben könnte.
Auch auf der Oder ist Niedrigwasser angesagt:
Niedrigwasser bremst Güterschifffahrt weiter
KIENITZ (dpa/roe) Auf der Oder ist weiterhin keine Güterschifffahrt möglich. Noch immer betrage die Tauchtiefe durchschnittlich nur einen Meter, sagte Sebastian Doseh,
Sprecher des zuständigen Wasserstraßen - und Schifffahrtsamts WSA) Eberswalde. "Beladen kann da kein Schiff fahren", sagte er.
Ein normaler Güterverkehr auf dem Grenzfluss sei nicht in Sicht, solange Im Einzugsgebiet der Oder in Polen und Tschechien ergiebige Niederschläge ausblieben.
Zu den Niedrigwasser-Opfern zählen auch Paul und Marietta Kamstra. Seit mehr als einem halben Jahr liegen sie mit ihrem holländischen Wohnschiff
im Hafen von Kienitz (Märkisch-Oderland). Sie waren im Sommer (2018) aufgrund des extremen Niedrigwassers des Grenzflusses
auf einer Sandbank gestrandet und dann in den Hafen geschleppt worden.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 21.12.2018
„Leichte Entspannung“ nach Dürre-Sommer
Spree fließt wieder vorwärts
Berlin. Nach dem Dürre-Sommer 2019 geht es der Berliner Spree wieder besser. Sie fließt wieder vorwärts.
…Es gab so wenig Wassernachschub, dass der Fluss in Berlin teils rückwärts dümpelte oder stand: Nach den teils ausgiebigen Regenfällen der vergangenen Wochen hat sich die Situation der Spree entspannt...
… Der Wasserstand des Flusses werde auch in diesem Frühjahr (2019) noch ein Thema bleiben…
…Insbesondere in den vergangenen zwei Wochen habe es aber ausreichend Niederschläge gegeben, sagte Experte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt….
…Diese trugen demnach auch zum Absinken der Sulfatkonzentration im Wasser bei...
…Wichtig sei nun, so „der Experte“ Ehlert, dass sich die Wasserspeicher in den Nachbarbundesländern wieder füllen könnten.
Anm.: Der wichtigste Wasserlieferant in diesen Tagen war die Leag, die mit nicht unwesentlichen Mengen von gehobenem Grubenwasser
den Abfluss der Spree stabilisieren konnte.
...Andernfalls hätte es zur Einstellung der Spree-Schifffahrt kommen können…
…Seit dem Sommer (2018) fehlt der Spree nicht nur ein Großteil der üblichen Niederschläge, die Wärme ließ auch große Wassermengen verdunsten….
…Nach wie vor treffen sich Experten aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und des Bundes im Zwei-Wochen-Takt, um über die Situation zu beraten… (dpa)
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 10.01.2019
IGB-Studie von 2016 zur Sulfatbelastung der Spree
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/nachrichten/berlin/spree-fliesst-wieder-vorwaerts_aid-35558761
Anm.:
Schuster bleib´ bei Deinem Leisten (eigentlich ist Herr Ehlert Wildtierreferent bei der Senatsverwaltung für Umwelt)
Jetzt auch autorisiert für die Abgabe von Statements zum Thema Wasser ?
Niedrigwasser bringt Schifffahrt starke Einbußen
BONN/DRESDEN (dpa/chw) Das extreme Niedrigwasser wegen des trockenen Sommers 2018 hat zu erheblichen Einbußen bei den Binnenschiffern geführt.
Die Ladungsmengen auf deutschen Flüssen seien ungefähr um ein Viertel zurückgegangen, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Dienstag (05.02.2019) in Bonn mit.
…Die Reedereien reagierten auf das Niedrigwasser, indem sie mehr kleinere Schiffe mit niedrigerem Tiefgang einsetzten. Die Binnenschiffer fordern
nun mit noch größerem Nachdruck einen zügigen Ausbau der Wasserstraßen. Dabei geht es meist um die Beseitigung von sogenannten Tiefen - Engstellen.
Weil der Rhein und andere Flüsse aber auch Naherholungsgebiete sind und eine große ökologische Bedeutung haben, sind solche Fahrrinnenvertiefungen umstritten.
Das obere Mittelrheintal ist zusätzlich auch noch Weltkulturerbe….
…Michael Heinz, Leiter der Abteilung Umwelt und Technik bei der Behörde, sagte, "dass wir derzeit noch keine klimabedingten Veränderungen der Wasserstände am Rhein "erkennen können".
Von 1850 bis 1970 habe es fünf noch extremere Niedrigwasserlagen gegeben…
…Auch auf der Elbe traf das Niedrigwasser die Binnenschifffahrt.
Von Ende Juni (2018) bis Dezember (2018) musste die Binnenschifffahrt auf dem Fluss bei Pegelständen von teils weniger als 50 Zentimetern komplett eingestellt werden.
Erst seit Januar (2019) können wieder Schwerlasten auf der Elbe transportiert werden….
…Die Binnenschifffahrt ist wegen der niedrigen Kohlendioxidemissionen pro transportierter Ladungsmenge ein umwelt- und klimafreundlicher Verkehrsträger.
…Allerdings seien Schiffsmotoren oft ziemlich alt: Lastwagen-Motoren hielten etwa fünf bis zehn Jahre, Schiffsmotoren oft 40 bis 60 Jahre. Zur Reduzierung des Rußpartikelausstoßes der Schiffsmotoren,
wird der Austausch alter Motoren gegen schadstoffärmere gefördert. Dafür stehen jährlich 40 Millionen Euro zur Verfügung…
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 06.02.2019
Anm..
Bis jetzt wurde immer der (menschengemachte) Klimawandel für alles , was etwas vom langjährigen Mittel, z. B. die Niederschlagsmenge abweicht, verantwortlich gemacht,
so auch die "katastrophale Dürreperiode 2018".
Vielleicht sollte man in den Mainstream-Medien auch mal darüber berichten, dass fast alle bedeutenden Speicher, Deutschlands durch die Niederschläge im 1. Quartal 2019 wieder gut bis fast vollständig gefüllt sind.
Eine derartige Berichterstattung passt wahrscheinlich nicht in das Schema.
Ausführlich lässt sich der aktuelle Füllungsstand laufend unter:
http://www.talsperren.net/Fullstande/fullstande.html
abrufen.
Wasserpegel nun monatlich im Blick
COTTBUS (dpa/fh) Wegen möglicherweise drohenden Niedrigwassers in Spree und Schwarzer Elster tagt nun monatlich eine Arbeitsgruppe von Wasserexperten aus Brandenburg, Berlin und Sachsen.
Derzeit sei die Situation aber noch im mittleren Bereich und nicht dramatisch, sagte Kurt Augustin, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im Brandenburger Umweltministerium, am Montag (29.04.2019).
Durch umsichtiges Wassermanagement müsse dafür gesorgt werden, dass die Flüsse die mittlere Wasserhöhe behalten. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Niedrigwasser im Schnitt etwas geringer.
Die Stauinhalte im Bereich der Spree seien derzeit aber in Ordnung, sagte Augustin. Auch im Bereich der Schwarzen Elster seien die Speicher fast zu 100 Prozent gefüllt.
Lediglich der Speicher Lohsa 11 der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbaugesellschaft (LMBV) habe ein Defizit von acht Millionen Kubikmetern im Vergleich im Vergleich zu 2018.
Ursache sei, dass es in den vergangenen Monaten wenig geregnet habe.
Quelle: Lausitzer Rundschau, 30.04.2019
Anm.:
Diese Art von Mitteilungen sollte man vor ihrer Veröffentlichung in den Medien von
einem echten Experten redigieren lassen, damit sie sowohl von Laien als auch von
Fachleuten zu verstehen sind, z.B. bei der Verwendung von folgenden Ausdrücken:
- Was ist die mittlere Wasserhöhe von Flüssen?
- Im Vergleich zum Vorjahr seien die Niedrigwasser im Schnitt etwas geringer.
Zur Niedrigwassersituation 2019 - Nutzung von Wassern aus Seen schon verboten
Hitze macht Fachleute immer unruhiger: Geht der Lausitz das Wasser aus?

Die renaturierte Spreeaue wäre ohne das ausgeklügelte Wassermanagement der Fachleute in Brandenburg und Sachsen möglicherweise inzwischen wieder ziemlich ausgetrocknet.
Damit das Spreewasser weiter sprudelt, sind in den kommenden Wochen Augenmaß und Sparsamkeit angesagt. FOTO: M. Behnke
Cottbus. Die anhaltende Trockenheit in der Lausitz sorgt für Nervosität bei den Wasserfachleuten in Brandenburg und Sachsen
...In den nächsten Tagen bekommen die Unteren Wasserbehörden in den Lausitzer Landratsämtern Post aus dem Potsdamer Umweltministerium....
...In dem Schreiben weist der Ministerialbeamte auf die angespannte Wassersituation in den Flüssen Spree und Schwarze Elster hin und fordert die Unteren Wasserbehörden auf,
Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen....
...Das Verfahren läuft darauf hinaus, dass die Lausitzer Landräte, wie bereits im vorigen Sommer, Allgemeinverfügungen erlassen werden, die die Nutzung von Oberflächenwasser einschränken....
...Denn auch in den Wintermonaten hatte es in der Lausitz nicht besonders ausgiebig geregnet oder geschneit....
...Um das Wassermanagement in der Lausitz auch in trockenen Perioden beherrschen zu können, hatten die Länder Brandenburg, Sachsen und Berlin
vor geraumer Zeit schon die Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Flussgebietsbewirtschaftung Spree/Schwarze Elster“ gegründet....
...Dort arbeiten auch die Wasserexperten des Energieunternehmens Leag und der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) mit....
...Fachleute aus der Berliner Senatsverwaltung sitzen mit am Tisch, weil die Hauptstadt nicht nur beim Trinkwasser, sondern vor allem auch bei der Schifffahrt
von den Wasserlieferungen der Spree aus der Lausitz direkt abhängig ist....
...Um die Pegel beispielsweise in der Spree in Trockenperioden zu stützen, stehen in den Becken Bautzen, Quitzdorf, Bärwalde, Burghammer, Lohsa II und im Spremberger Stausee
bei voller Auslastung 88 Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung....
...Aktuell fließen acht Kubikmeter Spreewasser pro Sekunde in die Talsperre, am Abfluss aber entnommen werden zehn Kubikmeter pro Sekunde, um die Spree zu speisen....
...Sichtbar ist die Auswirkung fehlender Niederschläge beispielsweise in einem Abschnitt der Schwarzen Elster vor dem Senftenberger See bei Buchwalde....
...Normalerweise kümmert sich die LMBV um das Befüllen der Lausitzer Tagebaurestloch-Seen....
... Um die Schwarze Elster hinter Senftenberg nicht austrocknen zu lassen, wird beispielsweise auch Wasser aus dem Sedlitzer See und Grundwasser aus Absenkungen in der Senftenberger Region
über eine Aufbereitungsanlage der Rainitza genutzt, um die Schwarze Elster in Gang zu halten....
...Das ist wichtig, weil das geklärte Wasser aus dem tatsächlich hochmodernen Klärwerk des Chemieunternehmens BASF stets mit Flusswasser gemischt werden muss....

...Wichtigster Speicher für die Schwarze Elster ist eigentlich der Senftenberger See, auch heute immer noch als „Speicherbecken Niemtsch“ bezeichnet....
...Insgesamt stehen im Senftenberger See zur Stützung der Schwarzen Elster daher nur 7,4 Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung....
...Entscheidender Grund dafür, dass der gesamte Wasserhaushalt in der seit vielen Jahrzehnten vom Bergbau geprägten Lausitz nicht kollabiert, ist die Einspeisung von Grubenwasser durch die Leag....
...Das Unternehmen pumpt jeden Tag etwa eine Million Kubikmeter davon aus großen Tiefen vor allem rund um die derzeit noch fünf aktiven Tagebaue in der Lausitz,
um den Bergleuten die Füße trocken zu halten....
...Ein Teil dieses Wassers wird als Brauchwasser in die Großkraftwerke gepumpt....
...Ein Großteil des Grubenwassers aber fließt inzwischen nach der Ausfällung eines Großteils des unansehnlichen braunen Eisenhydroxids direkt in die Spree...
.
...„Vor dem Spreewald steigt der Anteil des Grubenwassers in der Spree auf 60 Prozent, weil aus Richtung Jänschwalde auch eingeleitet wird.“...
...Ein Trockenfallen der Spree muss nach Ansicht der Fachleute, auch im Hinblick auf den Tourismus im Spreewald, unbedingt verhindert werden.... Torsten Richter-Zippack
Bis zum Buchwalder Wehr ist die Schwarze Elster auch in diesem Jahr weit gehend trockengefallen. FOTO: Torsten Richter-Zippack
Quelle. zitiert lr-online.de, 01.07.2019
Ausführlich unter:

Wegen Dauerdürre - Wasserentnahmeverbot in Cottbus und Spree-Neiße FOTO: Stadt Cottbus
Cottbus. Landwirte und Gärtner in Cottbus dürfen ab Sonntag tagsüber kein Wasser aus Flüssen und Gräben zapfen, im Spree-Neiße-Kreis gilt das Verbot ab der kommenden Woche.
Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.
…Die anhaltende Trockenheit fordert ihren Tribut: Der Grundwasserspiegel in Cottbus liegt bereits jetzt 50 Zentimeter unter dem Vorjahrespegel, der Wasserstand der Spree
kann nur dank ausgeklügelter Managementleistungen gehalten werden. Das Umweltamt verbietet daher ab dem kommenden Sonntag, 7. Juli 2019, Wasser aus Gräben, Flüssen oder Seen zu entnehmen…
…Betroffen sind vor allem Gartenbesitzer und Landwirte, die das kostenlose Nass vor ihrer Haustür nutzen, um Flächen zu bewirtschaften und Tiere zu tränken…
Wasserhaushalt gerät aus den Fugen
….Das Grundwasser hat sich längst nicht von der Folgen der Dürre aus dem Vorjahr erholt. Die momentane Trockenheit, gekoppelt an große Hitze und entsprechende Verdunstungsmengen, tun ein Übriges, um den Wasserhaushalt in der Region zu strapazieren…
…Zwar läge der Wasserstand der Spree derzeit noch bei 8,5 Kubikmetern, doch das verdanken wir nur der Tatsache, dass die Kahnfährleute im Spreewald ein Mindestmaß an Wasser brauchen.
Zudem werde die Spree durch Zuleitungen unterstützt, um die Trinkwasserversorgung Berlins mit abzudecken…. .
Zehn Wochen kein Regen
…Hydrologen, so sagt der Umweltamtschef, Stephan Böttcher, gehen davon aus, dass auch in den kommenden zehn Wochen kein nennenswerter Niederschlag fällt (????) …
Anm.: Es gibt also doch noch Hellseher?
…Um zumindest die Stadtbäume im Kampf gegen das Vertrocknen etwas zu unterstützen, setzt die Verwaltung auf drei Säulen:
die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren
das Grünflächenamt
die Anwohner, so die Bitte der Stadt, können helfen, indem sie Bäume und Sträucher bewässern…Andrea Hilscher
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 02.07.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/duerre-in-cottbus-jeder-tropfen-zaehlt_aid-39814947
Anm.:
An dieser Stelle soll auf die sog. „ausgeklügelten Managementleistungen“ aufmerksam gemacht werden,
die durch Einleitung von Grubenwässern eine relativ konstante Wasserführung der Spree gewährleisten:
Spreewasser kommt zum Großteil aus der Grube
COTTBUS (roe) Angesichts der Trockenheit profitiert die Lausitz immens vom Wassermanagement des Tagebau-Betreibers Leag.
…Aktuell fördern die rund 2700 Tiefbrunnen um die vier aktiven Tagebaue in Brandenburg und Sachsen täglich rund eine Million Kubikmeter Grundwasser, wie die Leag am Dienstag (02.07.2019) mitteilte….
…In der letzten Juni-Woche (2019) sind Rekorde im Trinkwasserabsatz aufgestellt worden…
…Gegenwärtig liegt der Leag-Anteil am Spreewasser beim Eintritt in den Spreewald nahe Schmogrow bei mehr als 60 Prozent…
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 02.07.2019
Anm.:
Man darf überhaupt nicht daran denken, wie sich der Wasserhaushalt der Spree nach einem überstürzten Ausstieg aus der Braunkohle einstellen würde.
Nebenbei bemerkt gehörte die Lausitz (auch ohne Klimawandel) schon immer zu den Regionen Deutschlands mit den geringsten jährlichen Niederschlagssummen.
Anm.:
Man kann eben nicht alles haben:
Eine naturbelassene Elbe mit großen Wasserstandsschwankungen oder
eine (weitgehend) kanalisierte Elbe mit ausgeglichenen Wasserständen unter Einbeziehung ökologischer Aspekte.
Die Elbe führt weiter Niedrigwasser
DRESDEN Die Elbe in Dresden führt weiter Niedrigwasser. Zwar ist der aktuelle Wasserstand mit 59 Zentimetern höher als erwartet.
…Kleine Schwankungen seien aber normal. Die Lage sei weiterhin angespannt....
……Niedrigwasser führt die Elbe in Dresden, wenn es nur noch eine Höhe von 69 Zentimetern erreicht.
Normal sind laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes knapp zwei Meter (200 cm) ….
…Im vergangenen Sommer (2018) war in Dresden ein Tiefststand von 46 Zentimetern gemessen worden. Der bisher niedrigste bekannte Wasserstand liegt bei 21 Zentimetern…dpa/uf
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 04.07.2019
Anm:
Die Auswirkungen, die das Niedrigwasser der Elbe 2018 für die Binnenschiffahrt hatte, sind weiter obern noch einmal nachzulesen.
Auswirkung der Niedrigwassersituation 2019 im Schwarze-Elster-Gebiet
Der pH-Wert ist deutlich gesunken
Saures Wasser: Großes Fischsterben in der Schwarzen Elster
Plessa/Wahrenbrück. Nachweislich seit Wochenbeginn (ab 01.07.2019) ist der pH-Wert in der Schwarzen Elster ab Plessa flussabwärts dramatisch gesunken.
Das Wasser ist derart sauer, dass die Fische inzwischen verendet sind.
…In Plessa, wo über Gräben eisenhydroxidhaltiges (braunes) und vor allem saures Wasser aus den Altbergbaugebieten um Plessa und Lauchhammer eingeleitet wird,
ist der pH-Wert auf mindestens 4,5 abgesunken….
Anm.: vermutlich aus den Altbergbaugebieten eingeleitete Wässer
…Am Dienstag (02.07.2019) wurden weitere Wasserproben an der Elsterbrücke bei Kahla und an der Kotschkaer Brücke in Elsterwerda genommen…
…Die
 Schwarze Elster und die Zuflüsse führen einfach zu wenig Wasser oder es wird zu
viel saures Wasser eingeleitet….
Schwarze Elster und die Zuflüsse führen einfach zu wenig Wasser oder es wird zu
viel saures Wasser eingeleitet….
…Nur in der Pulsnitz wurde mit einem pH-Wert von 5,5 bis 6 eine fischverträgliche Umgebung festgestellt. Dieser Vorfluter mündet in Elsterwerda in die Schwarze Elster….

linkes Bild: Bei Wahrenbrück: Das Elsterwasser ist braun gefärbt. FOTO: Michael Prochaski
…Die ersten toten Fische wurden am Wehr Würdenhain gesehen. Dort treffen Röder und Elster aufeinander….
…Zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück kamen die toten Fische dann massenhaft an die Oberfläche….
rechtes Bild: Rechts unten im Bild die langsam dahin fließende Schwarze Elster in Plessa.
Dort trifft sie auf das braune und saure Wasser vom Floß-, Binnen- und Hammergraben (l.), das aus den Altbergbaugebieten im Raum Plessa/Lauchhammer kommt. FOTO: LR / Manfred Feller
…Die untere Wasserbehörde führte am 1. Juli eine Kontrolle der Schwarzen Elster durch. Hierbei wurden der Sauerstoffgehalt und der pH-Wert an mehreren Standorten gemessen.
Das Ergebnis ergab eine deutliche Unterschreitung der üblichen pH-Werte…
….Nach Einschätzung der unteren Wasserbehörde ist der niedrige pH-Wert ursächlich für das Fischsterben verantwortlich…. Manfred Feller
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 03.07.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/elsterwerda/saures-wasser-eingeleitet-fische-sterben-in-der-schwarzen-elster_aid-39855733
B
eispiele für die Auswirkungen der Niedrigwasserperiode 2019:
Auch die Neiße führt wenig Wasser
Nach Auskunft von Uwe Landow habe die Neiße bei Forst momentan eine Abflussmenge von rund sechs Kubikmetern pro Sekunde. „Auch das ist erschreckend wenig“, so der Stauwärter.
Das langjährige Mittel der Jahre 1971 bis 2010 liegt nach Einordnung des Landesamtes für Umwelt bei 7,89 Kubikmetern pro Sekunde.
Mitte August 2018 hatte die Abflussmenge der Neiße auch einen Niedrigwert von 4,91 Kubikmetern pro Sekunde erreicht.
Niedrigwasser: Drei Schleusen in Südbrandenburg geschlossen
Potsdam. Wegen des extremen Niedrigwassers der Spree werden in Südbrandenburg drei Schleusen von Mittwoch (10.07.2019) an geschlossen.
Durch die Sperrung der Schleusen Leibsch (in den Dahme-Umflut-Kanal), Krausnicker Strom und Groß Wasserburg für den Bootsverkehr solle das bei Schleusungen im Staugürtel Schlepzig
und der Wehrgruppe Leibsch in das Einzugsgebiet der Dahme abfließende Wasser in der Spree gehalten werden, teilte das Landesumweltministerium am Dienstag (09.07.2019) mit. dpa
Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt laut dem Ministerium in mehreren Landkreisen bereits seit vergangener Woche ein Entnahme-Verbot für Wasser.
In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Cottbus, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster darf zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr aus Flüssen und Seen kein Wasser mehr gepumpt werden.
Dies gilt auch im Landkreis Barnim.
Quelle: lr-online.de, 09.07.2019
Lesermeinung zu Spreewasser von der Leag / Die Lausitz verliert an Wasser
Ein Bild
von Leser Christian Dulitz dokumentiert wie viel Wasser der Pinnower See bei
Guben schon verloren hat. FOTO: Christian Dulitz
Was, wenn
Leag-Tiefbrunnen nicht mehr helfen können?
Zur
Meldung „Spreewasser kommt zum Großteil aus der Grube“ vom 2. Juli 2019: Am 30.
Juni haben wir den Pinnower See nahe Guben besucht.
Der Weg führte uns zu der
Stelle, an der jetzt Grundwasser (!) dem See zugeführt wird, um ihn vor der
drohenden Austrocknung zu bewahren.
Ein dort
noch stehender ehemaliger Steg zeigt anschaulich den Wasserverlust der letzten
Jahre.
Das beiliegende Bild ist aussagekräftiger als alle in den letzten Jahren
geführten Ausreden der Leag zur Ursache.
Mehr als 3,6 Meter Höhenunterschied zur
jetzigen Oberfläche des Pinnower Sees.
Sollten die noch aktiven 2700 Tiefbrunnen
der Tagebaue eines Tages mal deaktiviert sein – dann Spreewald und Cottbuser
Ostsee ade!
Wetter -
Cottbus - Abschied vom Zierrasen? Wassersparen wird Thema
Direkt aus
dem dpa-Newskanal
Berlin
(dpa) - Wasserhahn aufdrehen - und es kommt nichts raus? In Deutschland kennen
die meisten Bundesbürger das bisher nur von Rohrbrüchen oder Reparaturarbeiten.
Doch im
zweiten trockenen Sommer und nach Hitzerekorden wie zuletzt im Juni stehen
Regionen wie die Lausitz vor einem Problem: Wenn es weiter so wenig regnet,
könnten Wasservorräte knapp werden.
Für
Deutschland ist das völlig neu.
…Verteilungsstreits, zum Beispiel zwischen Wasserversorgern und Landwirtschaft,
sind bereits absehbar…
…Elbe und
Oder führen schon vor Beginn des Hochsommers so wenig Wasser, dass Sandbänke und
Felsen freiliegen….
…In
Magdeburg konnten Anfang Juli (2019)
keine Schiffe mehr festmachen, in Dresden war Güterverkehr auf dem Wasser nicht
mehr möglich...
…In der
Lausitz fassen die Speicher normalerweise 88 Millionen Kubikmeter
Wasserreserven. Nun sind nur noch 58 Millionen vorhanden.
In Cottbus
dürfen Landwirte und Gartenbesitzer darum seit Sonntag zwischen 6 bis 21 Uhr
kein Wasser mehr aus Flüssen, Seen oder Gräben pumpen…
…Von
flächendeckendem Wasserstress in Deutschland will das Umweltbundesamt noch nicht
sprechen. Die Bundesrepublik habe eine Süßwasserressource von 188 Milliarden
Kubikmetern…
…Damit sei
sie, verglichen mit Südeuropa, reich an Grund- und Oberflächenwasser.
Deutschland entnehme diesem Vorrat bisher auch nur rund 13 Prozent pro Jahr.
Von
Knappheit wäre erst bei mehr als 20 Prozent Entnahme die Rede…
…Viele
Bundesbürger gingen bereits sensibel mit Wasser um. Doch etwa in Gärten lasse
sich noch Wasser sparen - durch Gießzeiten am frühen Morgen oder späten Abend
zum Beispiel. Dann verdunste nicht so viel….
…In Asien
ist Wasserknappheit schon lange ein Problem. In China leben heute rund 20
Prozent der Weltbevölkerung, doch hat es nur sieben Prozent der
Frischwasservorräte.
Vor allem
die ungleiche Verteilung ist problematisch: Im Süden des Landes fallen deutlich
mehr Niederschläge als im Norden. Um das Defizit auszugleichen, wurden gewaltige
Kanäle angelegt. …
…In Indien
müssen Anwohner in privaten Wohnanlagen bei zu hohem Wasserverbrauch mit
Strafgebühren rechnen. Im schlimmsten Fall stellen die Behörden das Wasser
stunden- oder gar tageweise ab….
…Mit
Trinkwasser-Knappheit rechnet in Deutschland heute noch kaum jemand. Doch bei
langer Dürre könnte die Landwirtschaft umdenken müssen….
…Um
nicht nur auf Oberflächengewässer und Grundwasser zurückzugreifen, wird
Wiederaufbereitung von Brauchwasser für die Landwirtschaft zu überlegen sein… …In
Spanien, einem der trockensten Länder Europas, wird das seit vielen Jahren
praktiziert. Es gibt mehr als 3000 Aufbereitungsanlagen, die 2017 knapp ein
Fünftel aller Abwässer recycelten. Spanien hat zudem mehr als 900
Meerwasserentsalzungsanlagen im Einsatz. Oft reicht aber selbst das nicht….
…Regulieren lässt sich der Wasserverbrauch auch über den Preis. In
Ostdeutschland zeigte sich nach der Wende ein deutlicher Effekt. Zu DDR-Zeiten
kostete Wasser praktisch nichts.
Als
Gebühren dafür anfielen, sank der Verbrauch rapide. Bis heute liegt er pro Kopf
unter dem Niveau von Westdeutschland….
Quelle: zitiert aus
https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/wetter---cottbus-abschied-vom-zierrasen-wassersparen-wird-thema-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190708-99-967178
Apropos:
Vielfalt der Medien:
Dieser Artikel ist auch in der Printausgabe der
Lausitzer Rundschau, 09.07.2019 erschienen.
Ausführlich unter:
Abgesenkter Grundwasserspiegel - „Grüner Rasen muss nicht sein“: Wasser in
Brandenburg weiter knapp
Potsdam/Pirna. Brandenburger Umweltministerium ruft zu Sparsamkeit auf. Zurzeit
keine Entspannung in Sicht. Wasser aus Sachsens Talsperren trägt zu Entlastung
bei. Anm:
Es hat
für den aufmerksamen Leser den Anschein, als ob sich alle Zeitungen
Deutschlands mit Nachrichten durch den dpa-Newskanal versorgen lassen. Man
sollte von dpa nicht unbesehen Artikel übernehmen, sondern sie vielleicht
durch eigene Recherchen objektiver und transparenter machen. Dass
Wasser aus „Sachsen“ zur Stabilisierung des Wasserhaushalts der Spree in
Niedrigwasserzeiten beiträgt ist unbestritten. So ist
es z.B. durchaus erwähnenswert, dass der Hauptanteil des Spreewassers
jedoch
aus der Tagebaubauentwässerung LEAG stammt. Bei
einer sofortigen Einstellung der Tagebauentwässerung wäre die
Wasserversorgung von Berlin und Frankfurt und für einige Teichwirtschaften in
Niedrigwassersituationen nicht mehr gewährleistet.
…Die
anhaltende Trockenheit hat Brandenburg nach wie vor fest im Griff, Wasser ist
weiterhin Mangelware....
…Dass es
in der Spree nach wie vor fließt, sei dem guten Wassermanagement zu verdanken,
so werde Wasser von der Talsperre Spremberg in die Spree geleitet.
Allerdings: Es fließt weniger in die Talsperre rein als raus. Nach derzeitigem
Stand sollte das Wasser der Talsperre dafür noch 45 Tage reichen, ausgehend von
einem angestrebten Wasserspiegel von 90 Metern über Normalnull (NN)…
…Bleibt es
aber auch die nächsten Wochen so trocken, dann müssten eventuell die
Wasserspeicher der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
angezapft werden…
…Der
Wasserspiegel der Talsperre Spremberg müsse vielleicht sogar auf 89 Meter über
NN gesenkt werden, das brächte rund 40 Millionen Kubikmeter Wasser, um die Spree
zu speisen.
Das Eisen(hydr)oxid
hätte dann wohl nicht mehr genug Zeit, sich abzusetzen, die Spree würde
vermutlich braun...
…Auch beim
Grundwasser seien die Folgen der Hitze und Trockenheit längst angekommen. So
gebe es Grundwasserabsenkungen um 20 Zentimeter bis hin zu 80 Zentimetern…
Anm.:
Dass in den
Sommermonaten die Grundwasserstände, u.a. auch hervorgerufen durch die erhöhte
Verdunstung der Vegetation jährlich absinken, ist eigentlich eine
„Binsenweisheit“.
Diese Tatsache
hat nur bedingt mit der Witterung im Juli 2019 zu tun.
…Dass es
in Sachsen an der Wasserfront gut aussieht, liegt auch daran, dass dort im
niederschlagsreichen ersten Quartal dieses Jahres (2019)
Wasser zwischengespeichert wurde,
das nun
für die unterschiedlichen Nutzungen abgegeben werden kann, wie die
Landestalsperrenverwaltung in Pirna mitteilt….
…Wegen der
geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen sinken die Füllstände aber auch
dort, weil die Zuflüsse weniger Wasser führen, zur Zeit ohne Auswirkungen auf
die Rohwasserbereitstellung,
weder für
Trinkwasser noch für Brauchwasser…
…Die für
die Trinkwasserversorgung genutzte Talsperre Eibenstock oder auch das
Talsperrensystem Mittleres Erzgebirge sind demnach zu 92 Prozent gefüllt.
Auch die
großen Brauchwasserspeicher haben noch genug Wasser. So ist die Talsperre Pöhl
zu 78 Prozent gefüllt und die Talsperre Bautzen zu 79 Prozent….
…Durch
ihre Wasserabgaben entschärfen sie so wie andere Rückhaltebecken die
Niedrigwassersituation an den unterhalb liegenden Flüssen…
…In
Brandenburg spüren einige Wasserwerke die anhaltende Trockenheit…
…Das
Wasserwerk Tettau fährt wegen der anhaltenden Hitzewelle derzeit unter Volllast,
informierte der Wasserverband Lausitz (WAL)…
…Rund
41 000 Kubikmeter Trinkwasser wurden etwa am Donnerstag (25.07.2019)
ins öffentliche Netz abgegeben – an normalen Sommertagen mit moderatem
Wasserabsatz sind es etwa 26 000 Kubikmeter….
…Alle zwei
Wochen trifft sich die Brandenburger AG Niedrigwasser, um zu besprechen, wie der
Stand der Dinge ist, was getan werden muss….
dpa
Mit Blick auf den starken Wassermangel in
Brandenburg sollte Grundwasser gespart und nur fürs Nötigste verwendet werden.
Den Rasen täglich sprengen, damit dieser schön grün ist, ist zum Beispiel
unnötig.
FOTO: dpa / Hauke-Christian Dittrich
Quelle:
zitiert aus lr-online.de, 30. 07.2019
Ausführlich unter:

Gefahren durch Trockenheit - Die Lausitz ist extrem im Hitze-Stress
Cottbus. Der Wasser haushalt der Natur ist angespannt. Das birgt Gefahren. Auch
im Senftenberger See wird das Wasser gefährlich knapp.
haushalt der Natur ist angespannt. Das birgt Gefahren. Auch
im Senftenberger See wird das Wasser gefährlich knapp.
…Der Lausitzer Wasserhaushalt ist angespannt. Gut 30 Millionen Kubikmeter Wasser fehlen der Natur. Und bei weiter sinkenden Pegeln wird es bereits schwierig, die wichtigsten Abflüsse zu stabilisieren….
…Die Talsperren Bautzen und Quitzdorf (Sachsen) helfen mit Wasserabgaben. Denn auch der Senftenberger See hat nur noch einige Zentimeter bis zum kritischen Punkt,
an dem der Wasserstand nicht weiter sinken darf, damit die unsanierte Insel des Alttagebaus nicht ins Rutschen kommt… Kathleen Weser
Die Badenden finden Abkühlung im Senftenberger See - hier am Niemtscher Strand. Doch die Idylle trügt. Der Wasserstand sinkt.
Dabei wird kein Wasser in die Elster abgeführt. Die Verdunstung ist groß. Der See muss einen Grenzwasserstand halten, damit die Insel nicht ins Wanken kommen kann. FOTO: Steffen Rasche
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 26.07.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/lausitz-extrem-im-hitze-stress_aid-44427725
Niederschlag sorgt kaum für Entlastung - Weiter angespannte Lage an Schwarzer Elster

Endlich Regen!. Die Schwarze Elster schwillt wieder an und bringt Wasser-Nachschub für den Unterlauf. Das Foto zeigt den Fluss am Mittwochabend. FOTO: LR / Rita Seyfert
Senftenberg/Hoyerswerda. Dank der kräftigen Niederschläge fließt die Schwarze Elster wieder. Doch trotz des Regens gibt die AG „Extremsituation“ keine Entwarnung. Eine Notabfischung wurde in letzter Sekunde gestoppt.
…Aam Donnerstag (01.08.2019) ist das Wasser in der Schwarzen Elster zwischen Hoyerswerda und Senftenberg wieder geflossen.
Die im Dürrejahr 2018 gegründete Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Extremsituation“ kommt nach ihrer jüngsten Zusammenkunft zu folgendem Fazit:
„Die Lage in den beiden Flussgebieten Spree und Schwarze Elster ist nach wie vor ernst.“ ..
…Wie vom Brandenburger Landesamtes für Umwelt (LfU) bestätigt, sind die Abflüsse in den Fließgewässern, die bereits seit Wochen im Niedrigwasserbereich liegen, wegen fehlender Niederschläge weiter zurückgegangen.
…Am 15. Juli (2019) wurde in der Spree am Unterpegel Leibsch (Dahme-Spreewald) ein Abfluss von 0,6 Kubikmeter pro Sekunde gemessen. Der mittlere Abfluss für diesen Pegel liegt im Juli aber normalerweise bei 11,8 Kubikmeter pro Sekunde …

Vor gut einer Woche war das Flussbett der Schwarzen Elster bei Senftenberg noch komplett ausgetocknet. FOTO: dpa / Patrick Pleul
Unverändert leide die Schwarze Elster unter der Trockenheit - Regen verhindert Notabfischen per Elektroschocker
…In allerletzter Sekunde hat der Regen auch ein Elektro-Notabfischen in der Schwarzen Elster verhindert.
Links die noch vor wenigen Tagen ausgetrocknete Schwarze Elster, rechts der
Senftenberger See. FOTO: dpa / Patrick Pleul
Sachsen
gibt elf Millionen Kubikmeter Wasser ab
Dass die
Flüsse und Seen in der Lausitz noch Wasser führen, ist auch den Abgaben aus den
Talsperren und Wasserspeichern ….zu verdanken.
Anm.: …und der Einleitung von Sümpfungswässern durch die Leag…
. ..So
wurden aus den sächsischen Talsperren Bautzen und Quitzdorf in diesem Jahr (2019)
bereits circa elf (11)
Millionen Kubikmeter für Brandenburg und Berlin abgegeben…
…Die
wichtigsten Wasserspeicher in Brandenburg sind für die Spree die Talsperre
Spremberg und für die Schwarze Elster das Speicherbecken Niemtsch, also der
Senftenberger See….
Wasser
sparen als Gebot der Stunde
Am
Donnerstag (01.08.2019)
fließt die Schwarze Elster bei Niemtsch wieder. FOTO: LR / Jan Augustin
…Wie
ausgetrocknet weite Teile des Landes sind, zeigt auch die Auswertung der
Abflussdaten der Regionen, in denen es zuletzt besonders stark geregnet hat,
aber in den Pegelverläufen der größeren Fließgewässer bildeten sich die
Niederschläge kaum ab…
…..Wasser
sparen, ist und bleibt das Gebot der Stunde…
…Jeder
kann dazu seinen Beitrag leisten. Unter dieser Prämisse sollen auch die
Talsperren und Speicher in Sachsen und Brandenburg weiterhin ressourcenschonend
bewirtschaftet werden.
Das Verbot der Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen
mittels Pumpen bleibe bestehen….
….Die Ad-hoc-AG „Extremsituation“ kommt das nächste Mal am 12. August
(2019)
in Cottbus zusammen. Vertreter aus allen betroffenen Ämtern, Behörden,
Ministerien und Verwaltungen aus Brandenburg und Sachen sind zugegen…
Jan
Augustin
Quelle: zitiert aus lr-online.de,
01.08.2019
Ausführlich unter: 

Anm.:
Noch einmal zum Verständnis …
Ein Einfluss der Tagebauflächen auf das Ausbleiben von Niederschlägen in der Lausitz kann nicht nachgewiesen werden
Trockenheit in der Region
Warum der Regen einen Bogen um Cottbus macht
Cottbus. Wolken türmen sich auf. Es blitzt und donnert - der erhoffte Regen in und um Cottbus aber bleibt aus. Warum ist das so?
Die Cottbuser schauen seit Wochen sehnsüchtig gen Himmel, doch allen Prognosen zum Trotz sind in den vergangenen Wochen nur wenige Regentropfen am Boden angekommen.
Seit Wochen kein Regen in Cottbus
…Die Regen- und Gewitterwolken können noch so groß und dunkelblau sein - es gibt keinen Regen in Cottbus…
…Dr. Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst erklärt, es sind gleich mehrere Faktoren schuld...
… Das liege zum einen an der Omega-Wetterlage, aber auch an der Lage der Lausitz im Allgemeinen….
Omega-Wetterlage schickt Regen auf einen Umweg
…Bei einer Omega-Wetterlage wird ein Hochdruckgebiet östlich und westlich von einem Tiefdruckgebiet flankiert.
Das Gebilde ist ziemlich stabil und kann deshalb neben typischem Schönwetter eben auch zu einer ausgeprägter Trockenheit und Hitzewelle führen.
Die Hochs und Tiefs kommen dabei kaum voran…
Große Tagebauflächen in der Region haben keinen Einfluss
…Dass die lang anhaltende Trockenheit auch durch die großen Tagebauflächen in der Region bedingt werde, kann der Potsdamer Meteorologe nicht bestätigen…
„Für diese Theorie gibt es keine sinnvolle Begründung. Die Lausitz ist ganz einfach die Ecke von Deutschland mit der kontinentalsten Lage.“
Die lang anhaltende Hitze und Dürre in Deutschland des vergangenen Jahres (2018) sei ebenfalls durch eine Omega-Wetterlage verursacht worden. Peggy Kompalla
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 03.08.2019
Ausführlich unter:
Anm.:
Man kann ja vieles auf den Klimawandel zurückführen, aber nicht alles…
Es wird aber immer wieder versucht.
Trockenheit - Extreme Wassernot in der Lausitz
&
Die Schwarze Elster liegt bei Tätzschwitz im Landkreis Bautzen komplett trocken. FOTO: Rasche Fotografie / STEFFEN RASCHE
…Cottbus. Seit Monaten gab es keinen ergiebigen Regen in der Lausitz. Pflanzen vertrocknen, die Flüsse in der Region weisen nur ein Bruchteil der normalen Pegelstände auf.
Geht der Lausitz das Wasser aus?...
…Behörden sprechen von einer „sehr angespannten Lage“, Forscher von einer „außergewöhnlichen Dürre“.
…Abzulesen ist das an den Pegeln der Flüsse….
…Die Elbe liegt bei Torgau über einen Meter tiefer als normal und führt nur noch ein Drittel der im Mittel üblichen Wassermenge….
…Ähnlich sieht es an der Neiße aus….
…Die Schwarze Elster leidet besonders unter der Trockenheit. Ihr Flussbett ist oberhalb von Senftenberg kilometerweit ausgetrocknet….
Spree profitiert von Talsperren
An der Spree in Cottbus ist der Pegel noch nahe der Normalwerte, allerdings nur, weil aus den Talsperren massiv Wasser zugeführt wird.
…In der Talsperre Spremberg liegt die Füllmenge in der Folge bereits rund acht Millionen Kubikmeter unter dem Mindestwert….
…Die Bestände reichen laut Kurt Augustin, Leiter der Abteilung im Umweltministerium, für weitere 30 bis 40 Tage. Zusätzlich habe man das aus Sachsen zugesicherte Kontingent noch nicht ausgeschöpft…
Anm.:
Eigentlich müsste selbst Herr Augustin begriffen haben, dass der größte Anteil des Wassers in der Spree nicht nur aus den sächsischen Talsperren kommt, sonders zu fast 60% aus den Sümpfungswässern der Tagebaue stammt.
Ist die Unterschlagung dieser Tatsache beabsichtigt?
Entnahmeverbote in Brandenburg bleiben in Kraft
…Die Entnahmeverbote, die die Landkreise erlassen haben, bleiben nach wie vor in Kraft….
…Der „Dürremonitor“ der Forscher des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung weist für weite Teile der Lausitz die höchste Alarmstufe aus. in den Böden ist eine „außergewöhnliche Dürre“ zu verzeichnen…. Bodo Baumert
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 14.08.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/nachrichten/extreme-wassernot-in-der-lausitz_aid-45082751
Sterben Lausitzer Flüsse ohne Grubenwasser?
Neuhausen. Die Spree wird zurzeit zu 70 Prozent aus Grubenwasser gespeist. Aber was passiert, wenn die Kohle geht? Eine Experten-Runde in Neuhausen hat einen Masterplan, ein Kompetenzzentrum und mehr Engagement des Bundes gefordert.
Anm.: nur am Rande …
…„Als die grüne Landtagskandidatin Isabell Hiekel aus Byhleguhre erklärte, dass auch sie für den Kohleausstieg schon 2030 eintrete, reagierte Moderator Raik Nowka mit der spitzen Bemerkung:
„Warum 2030? Der Kohlekompromiss mit dem Ausstieg 2038 ist doch nicht am Küchentisch entschieden worden.““…
Auf die Frage des CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Schulze, als Gastgeber der Gesprächsrunde: „Reicht das Wasser in Spree und Neiße, wenn die Kohle geht?“, müssen die Anwesenden zurzeit die einhellige Antwort „Nein“ geben. Und das ist nachvollziehbar. Nicht wegen der Trockenjahre 2018 und nun auch 2019….
…Leag-Chefgeologe Ingolf Arnold erläutert, 70 Prozent des Wassers würden für die Spree ohnehin aus den Tagebauen kommen. Grundwasser wird gehoben und in den Fluss geleitet, um die Arbeit in den Tagebauen zu ermöglichen (siehe Infobox). Bei der gegenwärtigen Trockenheit fließen die restlichen 30 Prozent fast ausschließlich aus den Talsperren im Sächsischen zu….
….Woher also soll das Wasser kommen, wenn die Kohle geht? Im Klartext heißt das, so schnell wie möglich auf die veränderte Situation zu reagieren….
So forderte Geologe Arnold, dass der Bund neben einer „verbindlichen Perspektive“ folgende Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes in der Lausitz ergreifen müsse:
■ Es braucht einen Masterplan für Spree und Schwarze Elster bis zum Jahre 2050. In diesem Zusammenhang sei zu klären, welche Rolle Sulfat spielt.
■ Strukturen und Kompetenzen gehören auf den Prüfstand. Die Flutungszentrale, die bisher nur Daten sammeln und Empfehlungen geben könne, brauche Entscheidungskompetenz.
■ Für die Schwarze Elster, die das zweite Jahr hintereinander trocken gefallen ist, werde ein Kopfspeicher von 20 bis 25 Millionen Kubikmeter Wasser südlich von Hoyerswerda dringend benötigt. Arnold: „Hier gibt es zurzeit nichts.“ Zugleich seien „Leitplanken“ für beschleunigte Genehmigungsverfahren erforderlich.
■ Neben dem Neißewasser-Überleiter müsse auch ein Elbewasser-Überleiter in Angriff genommen werden.
…Dabei zählt der Bereichsleiter Technik des Bergbausanierers LMBV, Eckart Scholz, den vor Ort „ungeliebten“ Elbe-Überleiter zu einem alten, aber längst überfälligen Lösungsansatz….
…Der Cottbuser Wasser-Professor Uwe Grünewald pflichtet ihm bei: „Bei gut 60 Kubikmetern pro Sekunde Fließgeschwindigkeit der Elbe in Trockenzeiten würde ein Abzweigen von drei Kubikmetern die Schiffbarkeit des Flusses auch nicht retten.“
…Aber für die Spree (mit gerade rund 14 Kubikmetern/Sekunde) wäre dies bedeutsam. für das künftig ausbleibende Grubenwasser…
…Es braucht neue Lösungsansätze, um künftig alle Ansprüche bedienen zu können. Damit ist die private Entnahme von Spreewasser ebenso gemeint wie der Erhalt des Biosphärenreservates Spreewald mit dem Tourismus oder die Wasserversorgung von Frankfurt (Oder) und Berlin….
…„Wir brauchen ein Kompetenzzentrum Wasserhaushalt mit dem Bund“, verweist Professor Grünewald auch darauf, dass mit Polen über einen Speicherbau für die Spree verhandelt werden müsse…Christian Taubert

Die Schwarze Elster Mitte August im sächsischen Tätzschwitz ist völlig ausgetrocknet. Dass die Spree in der Lausitz derzeit überhaupt noch Wasser führt, hat sie Grubenwasser aus dem Kohlebergbau und Wasser aus der Talsperre Spremberg zu verdanken. FOTO: Rasche Fotografie / Steffen Rasche
Quelle: zitiert aus theworldnews.net, 28.08.2019
Ausführlich unter:
https://theworldnews.net/de-news/sterben-lausitzer-flusse-ohne-grubenwasser
· Info I
Grundwassertrichter
Aufgrund der Grundwasser-Absenkung in 150 Jahren Bergbau in der Lausitz hat sich ein gewaltiger Trichter gebildet. In den 90er-Jahren erklärte
der damalige Brandenburger Umweltminister Matthias Platzeck (SPD) die Situation so:
Würde man alle Tagebaue in der Lausitz mit einem Mal schließen, würde die Spree rückwärts fließen.
Weder im Spreewald noch in Berlin würde ein Tropfen Spree-Wasser ankommen.
Die Flüsse hatten kaum noch Kontakt zum Grundwasser. Dieser Absenkungstrichter hat sich nach Angaben von Leag-Geologe Ingolf Arnold erst ab 2010 in dem Maße wieder gefüllt,
dass Grundwasser nicht nur in die Ex-Tagebaue fließt, sondern ganz normal wieder in die Flüsse gelangt.
· Info II
Lage weiter kritisch
Trotz vereinzelter Niederschläge habe sich die Niedrigwassersituation in den Flüssen Spree und Schwarze Elster nicht entspannt, so am Mittwoch die Einschätzung der länderübergreifenden Arbeitsgruppe „Extremsituation“
mit Vertretern aus Berlin, Brandenburg und Sachsen.
Mit Wasserabgaben aus Sachsens Talsperren Bautzen und Quitzdorf sowie der Talsperre Spremberg in Brandenburg konnte der Abfluss in die Spree auf dem niedrigen Niveau von 1,5 Kubikmetern pro Sekunde gehalten werden.
Normal seien im August 12,8 Kubikmeter pro Sekunde.
Damit die Spree aufgefüllt werden kann, wurde mit Sachsen für 2019 eine Abgabe von 20 Millionen Kubikmeter Wasser vereinbart. 16,6 Millionen Kubikmeter seien bereits abgegeben worden.
Mit den verbliebenen 3,4 Millionen Kubikmetern und den Reserven in der Talsperre Spremberg könnten die Spreewasserstände wohl bis Ende September (2019) auf niedrigem Niveau gehalten werden.
Ernster ist die Lage der Schwarzen Elster. Oberhalb von Senftenberg liegt der Fluss laut der Arbeitsgruppe vollkommen trocken.
Nur durch Stützung aus dem nahen Speicherbecken Niemtsch – die Wasserreserven liegen hier bei nur noch einer Million Kubikmeter – konnte der Fluss auf einem unteren Level stabilisiert werden.
Mit strenger Bewirtschaftung der Ressourcen und bei gleichbleibenden Wetterbedingungen sei die touristische Nutzung des Senftenberger Sees zumindest bis Ende September gesichert.
Taucher aus Wassernot für Talsperren-Reparatur im Einsatz

Die Idylle an der Talsperre Quitzdorf trügt. Der Zustand ist bedenklich. Sie muss repariert werden. Dafür das Wasser weiter abzulassen, ist aufgrund der extremen Trockenheit in der Lausitz nicht möglich.
Denn die Spree braucht gut dosiert Wasser. Der Speicher ist dafür unverzichtbar. FOTO: Uwe Menschner
Quitzdorf/Bautzen. Aus der Talsperre Quitzdorf wird vorläufig kein weiteres Wasser abgelassen, um die Anlage weiter auf Vordermann zu bringen. Für zwingend erforderliche Sicherungsarbeiten kommen Taucher zum Einsatz. Das ist für die Spree wichtig.
…Wegen der anhaltenden Trockenheit und zum Schutz der noch im Stausee vorhandenen Fische ist das vollständige Entleeren des Stausees derzeit unmöglich…
…Für die dringendsten Arbeiten an der Talsperre Quitzdorf sind deshalb nun Alternativen geprüft….
…Ende Juni dieses Jahres (2019) wurde begonnen, die Talsperre Quitzdorf für die geplante Reparatur des Entnahmebauwerks abzustauen und gleichzeitig abzufischen…
…Mit dem abgegebenen Wasser wurde die Spree gestützt…
…Das ist zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg vereinbart….
…Aktuell ist die Talsperre Quitzdorf mit 6,4 Millionen Kubikmetern Wasser noch zu 39 Prozent gefüllt. Und das entspricht etwa dem Wasserstand des Trockenjahres 2018… Kathleen Weser
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 17.08.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/bautzen-taucher-aus-wassernot-an-talsperre-im-reperatur-einsatz_aid-45143309
Anm.: In der Annahme, dass die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind:
Talsperre Quitzdorf gibt mehr Wasser ab
PIRNA (sm) …Wegen der Trockenheit wird die Wasserabgabe aus der Talsperre Quitzdorf in die Spree und den Schwarzen Schöps erhöht,
teilt die sächsische Landestalsperrenverwaltung in Pirna nach Abstimmung mit der Flutungszentrale Lausitz in Senftenberg mit…
…Vorgesehen sei die Abgabe von 1,8 Millionen Kubikmetern Wasser.
…Zusammen mit der Talsperre Bautzen wird auch der Bedarf der sächsischen Teichwirtschaften sowie die Bewirtschaftung des Speichersystems Lohsa 2 und Bärwalde gedeckt…
Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 07.09.2019
Extreme Trockenheit in der Lausitz - Wasser-Reserve im Senftenberger See fast erschöpft

In etwa acht Tagen muss die Wasser-Abgabe aus dem Senftenberger See eingestellt werden, um die touristische Nutzung nicht zu gefährden. FOTO: LMBV/Peter Radke
Senftenberg/Elsterheide. Trotz Regen gibt es keine Entspannung der Wasser-Situation in der Lausitz.
Um die touristische Nutzung nicht zu gefährden,
muss die Abgabe aus dem Senftenberger See voraussichtlich in acht Tagen eingestellt werden.
Die Wasser-Situation in der Lausitz spitzt sich trotz des Regens am Montag (09.09.2019) zu.
Von der extremen Trockenheit besonders betroffen ist die Schwarze Elster.
Vom Pegel Neuwiese (Landkreis Bautzen) bis oberhalb des Wehres Senftenberg liegt der Fluss weiterhin vollkommen trocken.
Wasser-Abgabe muss in acht Tagen eingestellt werden

Gespeist wird die Elster im Raum Senftenberg aktuell nur noch durch die Rainitza-Überleitung. Nur wenige Meter weiter stromaufwärts ist der Fluss komplett trocken. FOTO: Torsten Richter-Zippack
…Nur durch die Hilfe aus dem Senftenberger See und der Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza
konnte der Abfluss am Pegel Biehlen 1 bisher mit etwa 0,4 Kubikmeter pro Sekunde stabilisiert werden….
…Der mittlere Abfluss im September liege normalerweise bei 2,25 Kubikmeter pro Sekunde...
..Im Senftenberger See betrage die Wasser-Reserve nur noch 0,32 Millionen Kubikmeter. die Abgabe aus dem Speicher muss voraussichtlich
in etwa acht Tagen, eingestellt werden, um die touristische Nutzung nicht zu gefährden….
…Dann werde ein Wasserstand von 98,40 Meter über Normalhöhennull erreicht sein. Diesen Wert hatte die AG nach der Rutschung an der Insel vor einem Jahr als sicheren Mindestwasserstand festgelegt….

In der Schwarzen Elster befindet sich bis zum Buchwalder Wehr nicht ein Tropfen Wasser. FOTO: Torsten Richter-Zippack
Ernste Lage auch im Spreewald
…Die Stützung der Schwarzen Elster soll dann ausschließlich aus dem Sedlitzer See über die Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza erfolgen.
Allerdings sei ab September (2019) die Reinigungsanlage wegen dringender Wartungsarbeiten in ihrer Kapazität eingeschränkt….
…Die Lage im Spreewald: Die Abgaben aus den sächsischen Talsperren und Speichern sowie der Talsperre Spremberg haben laut MLUL in der Spree am Unterpegel Leibsch
zuletzt einen Abfluss von etwa 2,5 Kubikmeter pro Sekunde. Normal seien jetzt 14,9 Kubikmeter pro Sekunde.
Von den vertraglich vereinbarten 20 Millionen Kubikmeter, die jährlich zur Niedrigwasseraufhöhung für Brandenburg und Berlin bereitstünden,
seien bereits 18,5 Millionen Kubikmeter abgegeben worden...
...Mit den noch vorhandenen Reserven könne jedoch bei weiterhin anhaltender Trockenheit eine Stützung der Spree auf abgesenktem Niveau gesichert werden...
Verbot der Wasserentnahme bleibt bestehen

In der Schwarzen Elster befindet sich bis zum Buchwalder Wehr nicht ein Tropfen Wasser. FOTO: Torsten Richter-Zippack /font>
…Wegen niedriger Pegelstände in Flüssen und Seen darf weiterhin kein Wasser aus vielen Gewässern Brandenburgs entnommen werden…. Jan Augustin
Quelle: zitiert lr-online.de, 10.09.2019
Ausführlich unter:
„Zwei trockene Winter schaden mehr als zwei trockene Sommer“
Der besonders heiße und trockene Sommer lässt in Deutschland die Wasservorräte schwinden. Städte und Kommunen reagieren mit Verboten der Wasserentnahme aus Seen und Flüssen.
Quelle: WELT/Eybe Ahlers
…Flüsse trocknen aus, Ackerfrüchte verdorren, Wälder sterben: In diesem Hitzesommer wurde an manchem Ort in Deutschland auch das Trinkwasser knapp…
…Deutschland ist eigentlich ein wasserreiches Land. Doch von der Dürre des vergangenen Jahres haben sich die Wasserspeicher noch nicht erholt. Dieses Frühjahr war trocken, der Sommer ungewöhnlich heiß...
Woher kommt das Trinkwasser der Deutschen?
…Rund 30 Prozent des Trinkwassers werden aus Talsperren, Seen und Flüssen gewonnen…
……70 Prozent kommen aus dem Grundwasser. Versorger dürfen nicht mehr Wasser fördern, als auf Dauer neu gebildet wird. Für die Neubildung des Grundwassers sind vor allem die Wintermonate wichtig, in denen der Regen ungehindert versickern kann..

Quelle: Infografik WELT
…Die größten Grundwasservorräte befinden sich in der Norddeutschen Tiefebene, wo oft zwei bis drei sogenannte Grundwasserstockwerke übereinanderliegen, die durch wasserundurchlässige Schichten voneinander getrennt sind. Tief unter dem nutzbaren Grundwasser lagert Salzwasser…
…Fast die gesamten globalen Wasserressourcen bestehen aus Salzwasser; nur 2,5 Prozent sind Süßwasser und damit potenziell als Trinkwasser nutzbar…
Drohen Engpässe bei der Versorgung?
…Der Wasserverbrauch in Deutschland ist seit Jahren rückläufig und lag zuletzt bei etwa 123 Litern pro Kopf und Tag. Im europäischen Vergleich steht Deutschland gut da;
nur Belgien, Tschechien und die baltischen Staaten verbrauchen weniger…
 Quelle: Infografik WELT
Quelle: Infografik WELT
…Der Hitzesommer 2003 und der Dürresommer 2018 haben aber gezeigt, wie schnell der Wasserverbrauch bei hohen Temperaturen und anhaltender Trockenheit in die Höhe schnellen kann….
Kann Trinkwasser dauerhaft knapp werden?
…Vor wenigen Jahren noch waren Engpässe bei der Trinkwasserversorgung kein Thema. Jetzt sind sie ein Vorgeschmack auf das, was auf Deutschland zukommen kann – wenn die Sommermonate von Jahr zu Jahr heißer und trockener werden….
…Trinkwasser wird zunächst dort knapp, wo die Versorgung schon heute angespannt sei – zum Beispiel in der östlichen Lüneburger Heide und in zentralen Regionen Ostdeutschlands. In der sachsenanhaltischen Altmark haben die Grundwasserpegel bereits einen historischen Tiefstand erreicht. Auch in Brandenburg sinken sie nahezu flächendeckend.
Zu wenig Regen: Mit einem Tankfahrzeug wie hier in Brandenburg werden Pflanzen an einer Straße bewässert
Quelle: picture alliance/dpa

…Anfang 2019 war fast in ganz Deutschland die Feuchtigkeit in den oberen Bodenschichten deutlich geringer als im Jahr zuvor. In diesem Sommer lagen die Niederschläge nach einer ersten Bilanz des Deutschen Wetterdienstes erneut knapp 30 Prozent unter dem langjährigen Mittelwert…
…Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unterhält bundesweit noch 5200 Brunnen für die Notversorgung mit Trinkwasser. Ursprünglich wurden sie während des Kalten Krieges für den Zivilschutz im Verteidigungsfall angelegt. In Friedenszeiten können sie nun aber auch genutzt werden, wenn es infolge einer Dürre zu Engpässen kommt…
…Industrien brauchen Wasser für die Produktion, Kraftwerke für die Kühlung. Und schließlich kommen noch die Bedürfnisse der Landwirtschaft hinzu…
Wie wichtig sind Talsperren?
…In Regionen ohne größere Grundwasservorräte – und das betrifft etwa ein Drittel des Bundesgebietes – sind Talsperren unverzichtbar. Dies gilt beispielsweise für das Ruhrgebiet, auch Sachsen und Thüringen gewinnen rund die Hälfte ihres benötigten Trinkwassers aus Talsperren…
…Fast alle deutschen Privathaushalte (99 Prozent) sind an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Das gesamte Leitungsnetz umfasst mehr als 500.000 Kilometer…
…Betreiber von Talsperren sollen möglichst viel Wasser für die Sommermonate speichern und dabei noch genügend Staureserven lassen, um ein Hochwasser zurückhalten zu können….
…2018 gab es wegen der Dürre für mehrere Talsperren eine Ausnahmegenehmigung für eine verminderte Abgabe…
Wird es Konflikte ums Wasser geben?
…Ob und wo das Wasser als Folge des Klimawandels knapp wird, hängt von der regionalen Verteilung der Niederschläge, den jeweiligen Bodenverhältnissen und der Intensität der Nutzung ab….
…Wenn Trinkwasser knapp wird, drängt sich die Frage auf, ob zumindest für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen auch aufbereitetes Abwasser genutzt werden kann.
Die Europäische Union erarbeitet dafür gerade eine Verordnung, in der hygienische Standards festlegt werden sollen…
Was macht die Politik?
…Angesichts des Klimawandels hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Wasserwirtschaft, Wissenschaft, Landwirtschaft und Verbände sowie Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen
zu einem „Wasserdialog“ eingeladen…
… Im Frühjahr 2021 soll der Entwurf einer umfassenden „Wasserstrategie“ vorgelegt und zur Diskussion gestellt werden…
….Der Bund schreibt im Wasserhaushaltsgesetz den Rahmen für den Umgang mit Wasser vor: Wasser muss geschützt und darf nachhaltig genutzt werden…
Ist die Qualität des Trinkwassers in Gefahr?
…Trinkwasser ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel…
Wie Wasserverschmutzung unseren Wohlstand bedroht
..Frisches, klares Wasser – Laut eines Reports der Weltbank ist Sorge um unser Trinkwasser angebracht. Auch auf reiche Länder hat die schleichende Verunreinigung der Wasserressourcen ihre Auswirkungen….
…Die Weltbank hat in einer globalen Studie vor den Folgen der schleichenden Verschmutzung des Wassers gewarnt. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser
verurteilt und droht jetzt mit Zwangsgeldern...
…Das Nitrat, das größtenteils aus der Landwirtschaft stammt, ist für die Versorger derzeit das größte Problem…
.
….Langfristig ist es da günstiger, die kostbare Ressource vor Verschmutzung zu schützen und sparsam damit umzugehen. …
Claudia Ehrenstein, Politikredakteurin
Quelle: zitiert aus welt-online, 06.09.2019
Ausführlich unter:
Naturschutz
Wassermangel macht Cottbus zu schaffen
…Cottbus. Fachleute (
Anm.: Welche Fachleute sollen das sein?) des Cottbuser Naturschutzbeirates sagen einen wachsenden Wettbewerb um die mageren Wasser-Ressourcen voraus.
Die Probleme der langen Trockenperioden kann die öffentliche Hand nicht allein lösen…

…Eigentlich hat Cottbus noch Glück - durch die Stadt fließt immerhin die volle Spree sagt der Bioenergie-Experte….
…Der Geologe Hans-Werner Schilling, Chef der Cottbuser Naturschutzbehörde ist da weniger zuversichtlich und sagt einen zunehmenden
Wettbewerb um die Ressource Wasser voraus. Das zweite trockene Jahr in Folge habe längst weitreichende Folgen für die Natur in der Stadt….
Grundwasserspiegel in Cottbus um einen Meter abgesunken
…Den Fachleuten (?) zufolge ist der Grundwasserpegel in Cottbus aufgrund der Dürre um mindestens einen Meter abgesunken…
Anm.:
Es ergibt sich die Frage: Woher stammen eigentlich die Messdaten, die zu dieser Aussage führen.
Eine seriöse Quelle für derartige Aussagen ist hierbei der wöchentliche Hydrologische Wochenbericht des MLUL Brandenburg:
http://www.luis.brandenburg.de/w/wochenberichte/W7100038/default.aspx
In der Woche 41/ 2019 lagen z.B. die Grundwasserstände im Raum Cottbus in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten
zwischen 25 und 60 cm unter ihrem langjährigem Mittelwert für den Monat Oktober,
und nicht wie oben zu lesen um mindestens einen Meter.
…Die Niedrigwassersituation in Spree und Schwarze Elster hält an.
In das Staubecken (
Anm.: Der Unterschied zwischen einem Staubecken und einer Talsperre scheint nicht bekannt zu sein) Spremberg fließen seit geraumer Zeit sieben Kubikmeter Wasser in der Sekunde.
Dagegen verlassen den Stausee acht Kubikmeter in der Sekunde. Ähnliche Bedingungen herrschen in den angrenzenden sächsischen Stauseen
(Anm: Auch hier handelt es sich um Talsperren).
Am Unterpegel der Spree bei Leibsch werden derzeit 1,95 Kubikmeter pro Sekunde gemessen statt zwölf….
…Die länderübergreifende Wassermanagementzentrale hat ein ausgeklügeltes Regime gefahren, damit die Spree als bedeutendes Gewässer nicht trocken falle.
Dagegen wurde die Zufuhr für fast alle Gewässer zweiter Ordnung drastisch reduziert. Dazu gehören die Landgräben, aber auch der Priorgraben…
Weitere Wasserrückhaltebecken müssen entstehen
…Der Geologe Hans-Werner Schilling stellt fest: „Der Nutzungsdruck auf die Ressource Wasser wird sich in nächster Zeit erhöhen…
Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Landwirtschaft einen erhöhten Wasserbedarf geltend machen wird.“
Anm.:
Derartige Äußerungen entbehren jeglicher Grundlage und beflügeln nur ein völlig unangebrachtes Konkurrenzdenken und Panikmache. Die Landwirtschaft sollte vielleicht ihr Augenmerk mehr auf den Anbau von weniger Wasser verbrauchenden Kulturen legen.
Außerdem sollte vielleicht vor einer derartigen Aussage diese Frage mit praxiserfahreren Landwirten aus der Region diskutiert werden.
…Neben den großen Speichern und Seen müssen daher auch zahlreiche, kleinere Wasserrückhaltebecken und dergleichen auf öffentlichem und privatem Grund und Boden entstehen…
Anm:.
Es bedarf nicht so sehr zahlreicher Rückhaltebecken mehr oder weniger großer Ausmasse, als vielmehr Maßnahmen zur Bewirtschaftung kleinerer Vorfluter, durch u.a. den Einbau von Wehranlagen
Peggy Kompalla
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 07.10.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/wassermangel-macht-cottbus-zu-schaffen_aid-46344111
Nach dem Regen – Entspannung für Spree und Schwarze Elster
Keine Entwarnung für die Spree

Die Spree rauscht am Kiekebuscher Wehr. Trotz der Regenfälle ist das Wasserdefizit im Einzugsgebiet des Flusses weiterhin groß. FOTO: Michael Helbig
Cottbus. Die Regenfälle der vergangenen Tage bringen eine leichte Entspannung für den Fluss. Der Hahn für den Ostsee bleibt trotzdem zu.
…Nach den teils ergiebigen Regenfällen der vergangenen Wochen gibt es für die Spree eine leichte Entspannung. Zu dieser Bewertung kommt die brandenburgisch-sächsische Arbeitsgruppe „Extremsituation“.
Darüber informiert das Brandenburger Umweltministerium….
…Trotzdem könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Auch für den Cottbuser Ostsee gibt es derzeit keine guten Nachrichten…
…Nach Informationen des Umweltministeriums hat das Auffüllen der Talsperren und Speicher bis zum Frühjahr 2020 oberste Priorität. Die Arbeitsgruppe empfiehlt deshalb,
dass das Abpumpen von Wasser aus Flüssen und Seen weiter eingeschränkt bleibt…
…Für die Spree kommt die Arbeitsgruppe zu folgender Einschätzung: Die Niederschläge haben zusammen mit den Stützungsabgaben aus der Talsperre Spremberg und dem Ablassen von Fischteichen bewirkt,
dass zuletzt ein Abfluss von etwa acht Kubikmetern pro Sekunde in der Spree am Unterpegel Leibsch gemessen wurde. Das sei ein allmählicher Anstieg des Abflusses in der Spree….
…Der Hahn für den Ostsee bleibt trotzdem geschlossen. Das Wasserdefizit der Spree sei noch immer zu groß, bestätigt Leag-Sprecher Thoralf Schirmer.
Der ehemalige Tagebau wird über den Fluss (
Anm.: Der Cottbuser Ostsee wird über den Hammergraben, der oberhalb des Großen Spreewehres Cottbus von der Spree abzweigt,geflutet) geflutet.Derzeit sei der Ostsee zu 13 Prozent gefüllt….
…Bislang sind 728 656 Kubikmeter Spreewasser dort hineingeflossen…
…Die Leag sieht das Flutungsziel bis Mitte der 2020er-Jahre nicht gefährdet.
Der Unternehmenssprecher versichert: „Unser genereller Flutungsplan ist durch die anhaltende Trockenperiode nicht in Gefahr,
weil wir solche längeren Trockenzeiten mit einkalkuliert haben.“… Peggy Kompalla
Quelle: lr-online.de, 09.10.2019
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/keine-entwarnung-fuer-die-spree_aid-46389365
Wasserhaushalt erholt sich
Wasser-Notstand in Spree und Schwarzer Elster beendet

Anfang September (2019) war die Situation noch kritisch. In der Schwarzen Elster befand sich bis zum Buchwalder Wehr nicht ein Tropfen Wasser. FOTO: Torsten Richter-Zippack
Cottbus. Der extrem angespannte Wasserhaushalt in der Spree und in der Schwarzen Elster erholt sich langsam. Das bestätigt Jens-Uwe Schade, der Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums.
Die Not ist aber weiter groß.
Der Herbst entlastet die extrem wasserarmen Lausitzer Flüsse.Denn die Verdunstung von Wasser ist in der Spree und der Schwarzen Elster naturgemäß deutlich gesunken.
Die Lage bleibt aber angespannt.
Verbote sollen aufgehoben werden
…Die länderübergreifende Arbeitsgruppe von Experten aus Sachsen und Brandenburg analysiert die Folgen der extremen Trockenheit in den Einzugsgebieten beider Flüsse seit dem Sommer laufend.
Den Wasserbehörden der Lausitzer Landkreise werde aber jetzt empfehlen, die im Frühsommer erlassenen Verbote des Nutzens von Wasser aus Oberflächengewässern wieder aufzuheben…
..Aber: Die Talsperren und Speicher wieder aufzufüllen, habe weiter oberste Priorität…
…Wasser aus den Talsperren und abgelassenes Wasser aus Fischteichen stützen die Spree…
…Am Unterpegel Leibsch kommen aktuell aber lediglich etwa 6,4 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an. Das liegt noch deutlich unter dem mittleren Abfluss für den Monat Oktober,
der liegt bei 18,4 Kubikmetern pro Sekunde…
Weiterhin magerer Wasserabfluss
…Die noch vorhandenen Wasserreserven in den Bergbauseen und der Talsperre Spremberg werden bei den gegenwärtig vorherrschenden klimatischen Bedingungen
auch in nächster Zeit nur einen mittleren Niedrigwasserabfluss in der Spree sichern…
…Die Talsperre Spremberg ist derzeit etwa zur Hälfte gefüllt...
…Auch an der Schwarzen Elster hat sich die Lage leicht entspannt. Der Fluss führt zwischen den Wehren Kleinkoschen und Senftenberg wieder Wasser.
Unterhalb von Senftenberg am Pegel Biehlen 1 liegt er derzeit bei 0,7 Kubikmetern Wasser pro Sekunde. Der mittlere Abfluss für diesen Pegel liegt im Oktober normalerweise bei 2,49 Kubikmetern pro Sekunde…
…Die Schwarze Elster erhält Wasser aus dem Sedlitzer See über die Grubenwasserreinigungsanlage Rainitza und dem Senftenberger See (Wasserspeicher Niemtsch).
Der See-Wasserstand wird deshalb nur knapp über dem unteren Grenzwasserstand gehalten, der wegen der Rutschungsgefahr nicht weiter abgesenkt werden darf….Kathleen Weser
Quelle: zitiert von lr-online.de, 29. 10.2019 | 14:47 Uhr
Ausführlich unter:
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/wasser-notstand-in-spree-und-schwarzer-elster-beendet_aid-46823713
Experten warnen Trotz Regen – Dürre bleibt dramatisch in der Lausitz
…Gut, dass es regnet in der Lausitz. Wirklich helfen kann das den ausgedörrten Böden aber nicht. ..
Bild 1

Dürremonitor Oberboden des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 1.2.2020. Bodenfeuchteindex des Oberbodens bis 25 cm Tiefe. Gelb bedeutet „ungewöhnlich trocken“, dunkelrot „außergewöhnliche Dürre“. Nur weiß wäre gut. © Foto: Helmholtz-Zentrum /font>
…Bis zu 20 mm Niederschlag erwarten die Meteorologen an diesem Montag in Cottbus.
Was manchem schon die Laune verdirbt, ist für Lausitzer Landwirte und die Natur nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Denn der Lausitz fehlt Wasser, sein Monaten….
…In den insgesamt äußerst trockenen Jahren 2018 und 2019 seien vor allem in Ostdeutschland nur rund zwei Drittel (66 Prozent) des üblichen Regens gefallen,
berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD)…
Dürremonitor: Lage in der Lausitz „außergewöhnlich“
….Das zeigt sich auch beim Blick auf den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ).
Der ist in Teilen Deutschlands – vor allem der Lausitz – seit Monaten tiefrot. Das Symbol steht für „außergewöhnliche Dürre…
…Die Oberböden sind schon wieder unter einer beginnenden Dürre…Auch das zeigen die Karten des UFZ nur allzu deutlich. Denn während sich die Lage im Rest Deutschlands entspannt,
bleibt rund um Cottbus die Warnfarbe rot für extreme Dürre, in Döbern-Land an der Neiße sogar weiter dunkelrot…
Grundwasser zuletzt in den 1990er-Jahren so niedrig
…Auswirkungen hat das zum Beispiel auf das Grundwasser. Seit 2013 sinken die Grundwasserstände in Sachsen und der Lausitz. Aktuell wird an rund 90 Prozent der 167 Messstellen
der für Januar typische Grundwasserstand um etwa 60 Zentimeter unterschritten…
Anm.:
Diese Angaben können so ohne einen Bezug auf die hydrogeologischen Einheiten nicht gemacht werden
Katastrophale Folgen für die Natur
…. Derzeit arbeitet ein BTU-Wissenschaftler als Koordinator an einem EU-Forschungsprojekt, in dem Niederschläge auf Ackerböden mit sogenannten Regenausschlussdächern künstlich reduziert werden…
…Der Wald ist ebenfalls betroffen: Vor allem stirbt die Fichte auf immer größeren Arealen ab, aber auch Kiefern, Eichen und Buchen geht es schlecht….“
…Die Schaffung von mehr Mischwäldern und die Aufforstung mit trockenresistenten Bäumen wie nordamerikanische Küstentannen oder Douglasien brauchen Zeit...
Es fehlt ein ganzer Jahresniederschlag
…Helfen könnten mehrere überdurchschnittlich nasse Monate in Folge mit großflächigen und länger anhaltenden Niederschlägen, die die Böden nachhaltig durchfeuchten….
…Das gesamte Regendefizit bezogen auf den Zeitraum 2018 und 2019 beträgt in bestimmten Landesteilen „schon einen ganzen Jahresniederschlag“…
…Dürren werden nicht zum neuen Normalzustand in Mitteldeutschland und auch ganz Deutschland werden. Man muss sich jedoch auf häufigere und größere Ereignisse dieser Art einstellen… Bodo Baumert
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 03.02.2020
Ausführlich unter:
Anm.:
Dazu eine Leserbrief zu dieser Thematik:
„Frühbeet schon gut durchfeuchtet"
Zum Beitrag "Experten warnen: Trotz Regen - Dürre bleibt dramatisch in der Lausitz", LR vom 4. Februar (2020).
Die Meinung von Herrn Baumert widerspricht all meinen Erfahrungen als Gartenbesitzer.
Im Januar 2020 sind in Cottbus 43,4 l/m2 gefallen im Gegensatz zum
Januar 2019 mit 41,8 l/m2, dem
Januar 2018 mit 17,2 l/m2 und dem
Januar 2017 mit 25,4l/m2.
Außerdem sind von diesen Mengen 100 Prozent in das Erdreich eingedrungen, im Gegensatz zu Jahren mit trockenem, gefrorenen Erdboden, auf den dann Schnee gefallen ist,
der im Frühjahr von der Sonne weggeleckt wurde, also kein Wasser in den Boden gelangt ist. Weiterhin regnet es in Cottbus das ganze Jahr ruhig ohne wolkenbruchartige Mengen,
von denen bis 80 Prozent weggeschwemmt wurden.
Woher Herr Baumert seine Weisheit von den 20 Litern und der beginnenden Dürre hat, ist mir rätselhaft, mein Frühbeet ist über spatentief durchfeuchtet.
Vielleicht sollte Herr Baumert sich mal von seinem Schreibtisch erheben und in die Natur gehen.
Gottfried Schneider, Cottbus“
Anm.:
Man muss trotz der „reißerischen Überschrift:
"Experten warnen: Trotz Regen - Dürre bleibt dramatisch in der Lausitz"
den Verfasser des Artikels, Herrn Baumert in Schutz nehmen, denn es ist nicht seine Weisheit, sondern die der „Experten“,
in diesem Fall die des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ).
Auch die von Herrn Schneider genannten Niederschlagsummen für Cottbus können so nicht bestätigt werden und entbehren jeglicher Grundlage.
An dieser Stelle die „richtigen“ Werte:
Januar 2020 26,7 l/m2 67% des Januar-Mittels (39,8 l/m2)
Januar 2019 62,1 l/m2 155% des Januar-Mittels (39,8 l/m2)
Januar 2018 46,8 l/m2 117% des Januar-Mittels (39,8 l/m2)
Januar 2017 27,5 l/m2 69% des Januar-Mittels (39,8 l/m2)
Die Jahresmittel der Niederschläge lagen für Cottbus.
2019 400,2 l/m2 70% des langjährigen Niederschlags (570 l/m2)
2018 428,9 l/m2 76% des langjährigen Niederschlags (570 l/m2)
2017 621,1 l/m2 109% des langjährigen Niederschlags (570 l/m2)
Die Angaben beziehen sich auf die Jahresreihe 1981- 2010
Quelle:
https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/monatswerte-station.asp?id=10496
Aus den Angaben der letzten Jahre kann man entnehmen, dass es in der Vergangenheit schon immer „trockene“ und „nasse“ Jahre gegeben hat.
Der Verfasser ist der Meinung, dass sich eine ernst zu nehmende Prognose für die Niederschlagsmenge aus den beiden Trockenjahren nicht ableiten lässt.
Abgesehen von allem, gehörte die Lausitz auf Grund ihrer geografischen Lage (Einfluss KontinentalKlima) schon immer zu den niederschlagsärmsten Gebieten Deutschlands.
Wassermangel / Körbaer Teich soll jetzt kreisübergreifend gerettet werden
Wo liegt denn eigentlich dieser Körbaer Teich
Die Ämter Dahme und Schlieben wollen mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe den Niedergang des Erholungsgebietes stoppen und Konzepte für die Zukunft entwickeln. Doch ganz neu ist die Idee nicht.
Der Körbaer Teich in diesen Tagen. Trotz der Niederschläge der vergangenen Wochen bleibt der Wassernotstand prekär. © Foto: Carmen Berg
…Die Ämter Dahme (Teltow-Fläming) und Schlieben (Elbe Elster) wollen den Zustand und die Zukunft des Erholungsgebietes am Körbaer Teich stärker zur gemeinsamen Sache…
Körbaer Teich ist in trostlosem Zustand
…Nach mehreren trockenen Jahren herrscht akuter Wassernotstand. Die Niederschläge der vergangenen Wochen haben daran nichts geändert….
…. Eine Bürgerinitiative zur Rettung des Gewässers macht sich Gedanken, wie die Wasserbewirtschaftung optimiert werden kann...
…Gut 90 Prozent der Wasserfläche einschließlich der Zuläufe liegen auf dem Territorium der Gemeinde Lebusa im Amt Schlieben. Zudem befindet sich das Areal in einem Schutzgebiet, was Eingriffe nicht leichter macht…
Bauvorhaben am Körbaer Teich lassen lange auf sich warten
…Die Wasserbewirtschaftung werde naturgemäß eine Aufgabe der Schliebener bleiben. … Dabei geht es darum, das Wasser aus den Zuläufen so schnell wie möglich in den Körbaer Teich zu bringen…
…Um eine Neugestaltung des Einlaufs vom Inselteich direkt in den Körbaer Teich, statt wie bislang über den Hundezagel, gehe es beispielsweise schon mehr als drei Jahre.
Doch jetzt sei für den Förderantrag Licht am Horizont..
…Eine Lösung werde sich auch für den Rundweg finden. Hier sind unter anderem starke Bäume heruntergebrochen, die aus Naturschutzgründen
per Hand ohne Einsatz von Technik beräumt werden müssten….
…Niedrige Wasserstände habe es auch früher immer mal wieder gegeben. Alte Fotos aus den 1950er Jahren zeigen, wie im Teich Kühe weiden.
Das Gebiet auch unabhängig vom Wasserstand touristisch wieder aufzuwerten… Carmen Berg
Quelle: zitiert aus lr-online.de, 03.03.2020
Ausführlich unter:
Anm.: Nicht immer ist der Klimawandel schuld an allem....
Der Klimawandel und die kaputte Wand
Körbaer Teich verlandet, weil in der Gegend inzwischen zu wenig Regen fällt. Aber es liegt nicht allein daran
… Viele erinnern sich noch an die guten alten Zeiten des Nacherholungsgebiets Körbaer Teich….
…Es erstreckt sich an der Grenze der Landkreise Elbe-Elster und Teltow-Fläming.
Die Ortschaft besteht fast ausschließlich aus Hütten und winzigen Häuschen, würde ohne den Tourismus gar nicht bestehen….
…Es gibt einen malerischen Naturlehrpfad und ein bronzezeitliches Hügelgräberfeld…

…Es sieht mittlerweile traurig aus im Ort - und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Teich zunehmend verlandet.
Der Schilfgürtel und die Bootsstege stehen weit weg vom Ufer auf dem Trockenen. Nach den beiden zurückliegenden heißen Sommern ist es besonders schlimm geworden…
…Hat der Teich überhaupt noch eine Chance, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht? Ja…, aber nur bei einem Umdenken und schnellen Maßnahmen, denkt Christian Hentrich (Biologe mit dem Spezialgebiet Gewässerökologie.)
von der Bürgerinitiative….
…Vier Zuläufe des Teichs, die im Moment alle kein Wasser führen, müssten reaktiviert werden. Außerdem habe die Absperrmauer zum Schweinitzer Fließ hin Risse, die durch den Frost noch größer werden könnten….
… Eine günstige Gelegenheit zur unkomplizierten und vergleichsweise kostengünstigen Sanierung wäre gegenwärtig kein Problem,
da der Wasserspiegel sowieso nicht an die Mauer heranreicht…
… Eine dichte Absperrwand wäre »essenziell« für den Teich…
Das zum Kreis Elbe-Elster gehörende Amt Schlieben plant Maßnahmen, um den Wasserzu- und -ablauf zu regeln…
…Auf jeden Fall müssten Fördermittel organisiert werden, denn aus eigener Kraft könne das Amt die notwendigen Baumaßnahmen nicht finanzieren... Andreas Fritsche
Fakten
Mit 27 Hektar ist der Körbaer Teich der größte See im Landkreis Elbe-Elster. Von Ost nach West erstreckt er sich im Normalzustand 800 Meter, von Nord nach Süd rund 400 Meter.
Der Teich ist auch in seinen besten Zeiten nie tiefer als 2,50 Meter gewesen.
Im Mittelalter ließen Karmelitermönche das Schweinitzer Fließ anstauen, um Karpfen für die Fastenzeit zu züchten.
1968 wurde das 510 Hektar große Landschaftsschutzgebiet »Körbaer Teich und Lebusaer Waldgebiet« eingerichtet.
2017 fürchteten Anlieger strenge Nutzungsauflagen durch die Eingliederung des Teichs in ein Naturschutzgebiet. Nun hoffen sie, den Badesee unter Berufung auf den Naturschutz retten zu können. af
Quelle: zitiert aus neus-deutschland.de, 29.12.2019
Ausführlich unter:
Anm.: ... und so geht das Klagen immer weiter. Mal ist es zu trocken, mal ist es zu nass
Viel Regen, volle Talsperren Südbrandenburg hofft auf feuchteren Sommer
Ernteeinbußen, Waldbrände, leere Flüsse: Der Sommer 2019 war in Brandenburg der zweite sehr trockene in Folge.
Hoffnung für dieses Jahr machen die vergangenen Wochen mit besonders viel Regen. Auch das Landesumweltamt gibt sich vorsichtig optimistisch.
…Die Wassersituation in Südbrandenburg hat sich entlang der Spree stabilisiert. Das sagte das Brandenburger Landesumweltamt rbb|24 am Mittwoch (05.03.2020). ..
…Die Talsperre Spremberg (Spree-Neiße) habe in den vergangenen Wochen das "Stauziel" nicht nur erreicht, sondern sogar mit 107 Prozent leicht übertroffen….

Wasserzufuhr wird vervierfacht - Zusätzliches Wasser für Cottbuser Ostsee
Fehlender Schnee im Winter ist zu spüren
…Im Februar (2020) hat es in Südbrandenburg sehr viel geregnet.
Zwei Beispiele: 90 Liter Niederschlag gab es rund um Klettwitz, mehr als 70 Liter in Bad Liebenwerda. Das ist doppelt so viel wie üblich….
…Es gebe insgesamt ein Defizit von einem Viertel der üblichen Niederschlagsmenge….
Dank Regen mehr Wasser für Cottbuser Ostsee
…Auf Grund der vielen Niederschläge konnte Ende Februar (2020) der „Wasserhahn“ für den künftigen Cottbuser Ostsee weiter aufgedreht worden.
Seit dem 25. Februar werden bis zu vier Kubikmeter pro Sekunde aus der Spree geleitet..
…In den letzten Februartagen (2020) musste die Menge ein wenig gedrosselt werden - auf rund 3,5 Kubikmeter pro Sekunde.
Februar 2020 Doppelt so viel Regen und sechs Grad zu warm
…Das Wasser für den Cottbuser Ostsee kommt zu rund 80 Prozent aus der Spree.. Der Rest wird aus dem Grundwasser bezogen. Im Moment ist der See zu 32 Prozent gefüllt….
Sehr trockener Sommer 2019
…Im vergangenen Jahr hatte die anhaltende Trockenheit spürbare Auswirkungen auf die Flüsse in Südbrandenburg.
Wochenlang war ein kilometerlanger Abschnitt der Schwarzen Elster ausgetrocknet…
…Aktuell wird laut Landesumweltamt kein Wasser vom Senftenberger See in die Schwarze Elster, um eine Reserve für die Sommermonate zu haben…
Quelle: zitiert aus
Ausführlich unter:
zurück zur Startseite
